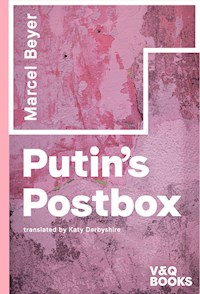Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Göttinger Sudelblätter
- Sprache: Deutsch
In seinen im November 2014 gehaltenen Poetikvorlesungen spricht Marcel Beyer über »die Löcher im Stoff der Wirklichkeit", über Wirklichkeit also, die kein kontinuierliches Ganzes bildet, sondern aus Inseln (und Löchern) zusammenzusetzen ist und sich nicht zuletzt aus medialen Fiktionen speist. Er spricht über einen Tag im Herbst, an dem er in einem Flugzeug aus Paris nach Frankfurt sitzt, in der Reihe vor sich eine fernsehbekannte Literaturkritikerin. Das Notieren der sehr konkreten Situation verkoppelt Beyer mit dem Nachdenken über Georges Perec, der 1974 drei Tage lang schreibend versuchte, einen Platz in Paris »erschöpfend zu erfassen". Perec, das Waisenkind jüdischer Einwanderer, musste sich seine Kindheitserinnerungen erst erschreiben, wohingegen in Cécile Wajsbrots Protokoll der geistigen Erkrankung ihres Vaters dieser allmählich alle Erinnerungen verliert. In den Blick nimmt Beyer nicht weniger als das 20. Jahrhundert, die »Faktenlage" - und die Imaginationsarbeit, die notwendig ist, will man sich eine eigene Lebensgeschichte schaffen. Ein Punkt, an dem »Alice im Wunderland" ins Spiel kommt, und sei es auch nur in Form weißer Kaninchen, die durch die Szene laufen und rufen: »Jemine, jemine, keine Zeit, keine Zeit."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Göttinger SudelblätterBegründet von Heinz Ludwig ArnoldHerausgegeben vonThorsten Ahrend undThedel v. Wallmoden
Marcel BeyerXX
Lichtenberg-Poetikvorlesungen
Marcel Beyer wurde mit derLichtenberg-Poetikdozentur 2014 ausgezeichnet.Die hier abgedruckten Vorlesungen hielt er am 12. und13. November 2014 in Göttingen.
Erster Abend
I
Der Tag, an dem der Lebensgefährte der Literaturkritikerin meine Tasche mit einem Buch auf den Boden wirft (einem Buch über das Verschwinden der Welt, das Verschwinden der Sprache, das Verschwinden der Erinnerungen), ist der 8. September 2014.
II
Derselbe Tag, an dem ich, im Verlauf des späteren Vormittags, irgendwann notieren werde: »Dies alles für Göttingen, genau dieser 8. September«, hastig, im Rausch, über mein Notizheft gebeugt, ohne mich dabei jedoch der Vorstellung hinzugeben, das Mitnotieren, das Mitschreiben der mich akut umgebenden Welt werde am Ende – in der Nacht, wenn ich in meinem Hotelbett liege und, kurz vor dem Einschlafen, den zurückliegenden Tag rekapituliere – ein lückenloses, sämtliche Eindrücke umfassendes Protokoll ergeben. »Dies alles für Göttingen, genau dieser 8. September«, in hingekrakelter Schrift: ein Tag, so scheint es mir, wie ein aus der Ferne in die Gegenwart hineinreichendes Zitat, »der Rest ist klar, ein Balg, Karnickelfell, steck deine Hand hinein und schließ die Augen«, ein Tag wie ein umgestülpter, mit Kaninchenfell gefütterter Handschuh. Ein Tag, an dem sich, ohne mein Zutun, die Fiktion nach außen kehrt. Wo aber wäre dann dieses ›Außen‹ anzusiedeln?
Indem ich schreibe, lasse ich mich ein auf die Welt, oder: Indem ich schreibe, nehme ich Distanz zu ihr ein. Ein unablässiges Wechselspiel vielleicht: Ich tariere den Abstand aus zwischen mir und der Welt. Wie aber, wenn dieses Protokoll, peinlich darauf bedacht, keine Lücke zu lassen, in einer widersprüchlichen Bewegung denjenigen auslassen, als Leerstelle auffassen würde, der notiert – als gäbe es diese Welt ohne mich?
Es gibt die Welt ohne mich.
Und es gibt, wie ich feststelle, da ich, heute ist der 19. Oktober 2014, anhand meiner Notizen vom 8. September auf jenen Tag zurückschaue, es gibt auch die Lücken, in denen ich mich selbst aufzuhalten imstande bin. Zum Beispiel das Hotelzimmer, in dem ich die Nacht vom 8. auf den 9. September verbracht habe, verbracht haben muß, ohne daß ich mich auch nur im Geringsten an dieses Zimmer erinnern könnte: Ich sehe mich nachmittags bei der Ankunft an der Hotelrezeption, und dann sehe ich mich am nächsten Morgen wieder vor dem Eingang, auf ein Taxi wartend, das mich zum Bahnhof bringen wird.
Keinerlei Erinnerung: War es ein Einzelzimmer, ein Doppelzimmer, stand das Bett rechts, stand es links, welche Farbe hatte der Boden, waren die Wände tapeziert, waren sie geweißt, hing ein – normalerweise scheußlicher, scheußlich geschmackssicherer – Kunstdruck über dem Bett, gab es ein Fenster oder zwei, schaute ich auf die Straße hinaus oder in einen Hof, und wie sah das Badezimmer aus? Weiße Kacheln, mattbraune Kacheln, sandfarbene Kacheln? – Nichts, als wollte meine Erinnerung leugnen, daß ich je eine Nacht in jenem Hotelzimmer verbracht habe, als gäbe es zwar die Figur (eine Figur, der es nicht gelingt, sich aus ihren Tagesaufzeichnungen weitgehend herauszuhalten), nicht aber den Raum, in dem sie sich aufgehalten hat.
Damit – es braucht nicht mehr als anderthalb Seiten Text, braucht nicht mehr als drei Minuten – verwandele ich mich vor meinen eigenen Augen in eine Figur, entstanden irgendwo im Raum zwischen meinen Notizen und meiner NichtErinnerung, entstanden zwischen dem 8. September (dem Tag des Notierens) und dem 19. Oktober (an dem ich diesen Satz schreibe), einem Datum zugleich, an dem sich der Versuch des französischen Schriftstellers Georges Perec zum vierzigsten Mal jährt, einen Platz in Paris erschöpfend zu erfassen, ihn auszuschöpfen, woraus sein rund fünfzig Seiten umfassendes Buch mit dem schlichten, sich selbst erklärenden Titel Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen hervorging.
Drei Tage verbringt Georges Perec, dessen Vorfahren noch den Nachnamen Peretz trugen, seinem Plan gemäß in den Cafés rund um die Place Saint-Sulpice, setzt sich einmal kurz auch auf eine Parkbank und notiert, was sich um ihn herum abspielt. Notiert, nahezu im Minutenabstand, am Freitag, dem 18., am Samstag, dem 19., und am Sonntag, dem 20. Oktober 1974, ohne damit einen anderen Plan zu verfolgen als eben diesen, ohne weitere Absicht (etwa die, Material zu sammeln für einen noch zu schreibenden Text), nicht einmal die Absicht, sich im Verlauf des Notierens in eine Figur zu verwandeln. Perec gibt sich, wie ein Rezensent bemerkt hat, dem Taumel des Gewöhnlichen hin, dem Taumel des Immergleichen: »Ein 96er fährt vorbei. Ein 87er fährt vorbei. Ein 86er fährt vorbei. Ein 70er fährt vorbei«, und: »der Leichenwagen fährt davon, gefolgt von einem Peugeot 204« und: »Ein Mann, der Teppiche trägt«, und: »Ein Mann mit schwarzer Umhängetasche ohne Pfeife«, und: »Es ist fünf nach vier. Müdigkeit der Augen. Müdigkeit der Worte.«
Einmal – am 19. Oktober 1974 – sieht er den Dromologen Paul Virilio über den Platz gehen, auf dem Weg ins Kino, wie Perec mitteilt, ohne daß ich, der Leser, in der Lage wäre, herauszufinden, ob es sich bei jenem Passanten tatsächlich um Paul Virilio gehandelt hat, oder ob der Autor sich an dieser Stelle erlaubt, in seine mit dokumentarischem Eifer und Ethos angefertigten Notizen ein fiktionales Moment einzuführen (Aufgabe von Regelsystemen ist es, den Regelverstoß zu ermöglichen), indem er einen Freund auftauchen und ihn damit zu einer Figur werden läßt.
Hat er, Georges Perec, sich darüber selbst – ohne Absicht – in eine Figur verwandelt? Keine einfache Frage. Möglich, er hat am ersten Morgen seinen Platz im Café bereits als Figur eingenommen, als eine von Georges Perec imaginierte, gestaltete, in die Wirklichkeit getretene Figur.
Merken wir uns einstweilen die Linienbusse. Das Badezimmer. Die namentlich genannte Person, über deren Erscheinen für uns Leser keine Gewißheit besteht. Den Mann mit der schwarzen Umhängetasche. Merken wir uns die von einem Mann über den Platz getragenen Teppiche.
III
Am Morgen des 8. September empfängt mich die Abfertigungshalle des Flughafens Dresden International mit einem überlebensgroßen, mir die erste Verwirrung des Tages bereitenden Porträt von Veronica Ferres. Verwirrend, weil das auf ungefähr einem Meter mal einem Meter abgebildete Gesicht der Schauspielerin Veronica Ferres unzweifelhaft genau dies ist: das Gesicht der Schauspielerin Veronica Ferres, wohingegen die Plakatwerbung im Wechseldisplay vor der Gepäckkontrolle ebenso unzweifelhaft nicht auf die Person, sondern auf deren Rolle als deutsche Bundeskanzlerin verweist, die sie in einem Fernsehfilm übernommen hat, der, und hiermit überrascht mich die Wirklichkeit, allerdings bereits vor rund einer Woche ausgestrahlt wurde.
Sollte nicht aber Werbung, den Gesetzen der Wirklichkeit gehorchend, mit dem Verschwinden des beworbenen Produkts – verschwinden? Hat der produzierende Fernsehsender die Werbefläche fälschlicherweise eine ganze Woche zu lang gebucht, oder will man aus unerfindlichen Gründen bei den – aus Sendersicht enttäuschend wenigen – Zuschauern jenes nach der Fernsehzeitrechnung eine Ewigkeit zurückliegende Fernsehereignis trotzig in der Erinnerung wachhalten, dessen zentrale Szene ausgerechnet im Souterrain spielt, in einer Waschküche mit niedriger Decke und gekachelten oder geweißten Wänden, wo die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident eine Besprechung abhalten, die in einem knappen, verhaltenen Wortwechsel gipfelt, nämlich, er: »Ich glaube, wir beenden das jetzt«, und sie: »Was? Meinst du jetzt …«, womit sie, die in der Rolle der deutschen Bundeskanzlerin agierende Fernsehschauspielerin Veronica Ferres, ihren Zweifel zum Ausdruck bringt, ob ihr Gegenüber nun lediglich die unter vier Augen geführten Geheimverhandlungen meint oder nicht doch die zwischen den beiden laufende Affäre. »Beides«, so die knappe Antwort des in einer deutschen Waschküche stehenden französischen Staatspräsidenten.
Notizbuch vom 8. September 2014
Die einzige mir plausibel erscheinende Antwort auf diesen Werbefehler im Zusammenhang mit einer romantischen Fernsehkomödie, die zugleich – ›ironisch‹, ›augenzwinkernd‹, fernsehdebil – die Möglichkeit umspielt, von einem politischen Anspruch ›getragen‹ zu sein, lautet: Hier wird die Schmach der noch die vorsichtigsten Erwartungen weit unterbietenden Einschaltquote auf das Gesicht der Hauptdarstellerin abgewälzt. Das macht sie, Veronica Ferres, langjährige Verlobte und seit kurzem Gattin eines engen Freundes eines früheren deutschen Bundeskanzlers in der Rolle der deutschen Bundeskanzlerin, auf dieser Plakatwand, an diesem Morgen, zu einem bedauernswerten Geschöpf.
Dem auf seinem Weg zur Gepäckabschnittkontrolle das Wechseldisplay überfliegenden Passagier wird suggeriert, ja, er kann fast nicht anders, als den grotesken Mißerfolg des in der vergangenen Woche ausgestrahlten Kanzlerinnenliebesaffärenfilms nicht der Rolle, nicht den Dialogen, nicht der Idee für diesen Film, sondern diesem Gesicht zuzuschreiben, das eben nicht das Gesicht einer – in einer bestimmten Weise geschminkten, frisierten, sonst wie für die Rolle zurechtgemachten – Fernsehfigur ist, sondern das Gesicht eines tatsächlich lebenden Menschen, dem man, wenn es der Zufall wollte, jederzeit an einem Flughafen über den Weg laufen könnte, sogar hier, am Dresden International Airport, etwa jenseits der Sicherheitskontrolle, im Wartebereich vor den Flugsteigen.