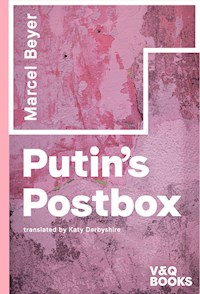19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Auf der Saftbühne wird etwas aufgeführt. Hildegard Knef steigt ins Auto. Rudolph Moshammer trägt seinen Yorkshire Terrier durch München. S. T. Coleridge macht einen Witz über Köln. Kunstwerke verschwinden. Etwas rüttelt am Fenster. Morgens, mittags, nachts. Der Amselpapst. Die Leute fangen an, Sachen zu reden. Am Wertstoffhof läuft Musik. Elvis fegt noch einmal die Einfahrt. Ich lese nur noch Pferdekrimis und suche die Sprache im grauen Bereich. Das Schlaflabor am Potsdamer Platz. Weißdorn, Majoran, Ginster...
Unerhörtes trägt sich zu in den lange erwarteten neuen Gedichten von Marcel Beyer. In jedem einzelnen der exakt vierzig Verszeilen langen Poeme nimmt sich eine andere Figur jede Freiheit, die die strenge Begrenzung ihr lässt, erzählt Geschichten, paraphrasiert Übersetzungen, stellt Reihungen an - kurz: Sie treiben es bunt, manchmal auch wild, so dass am Ende gesagt werden muss: Es wird ernst! Es wird Zeit, den Dämonenräumdienst zu rufen.
Laß deine mürben Knochen. Verharre. Der
Sohn ist der Vater, der Vater
ein Geist. Koste nicht von der Esche,
der Eiche, der Eibe, aber sag mir,
was Buchstaben sind. Löse dich von
deinen Vorlagen. Sprich schneller.
Niemand hier muß verstehen,
was du sagst. Wer würde dir denn eine
Knarre besorgen. Frag nicht, ob du
willkommen bist. Was in dir
singt, geht keinen Menschen etwas an.
Die Buchstaben glotzen. Bleibe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Marcel Beyer
Dämonenräumdienst
Gedichte
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Farn
Farn
Scheinfrucht
Papier
Bambi
In meines Vaters Haus
Benzin
Die Blutbude
Moshammer
Schwermut
Fünf Rezepte gegen Krötigkeit
Modell
Der Tod in den Büschen
Schrot
Englisch
Am See
Sprache im grauen Bereich
Druckstellen
Mulke
Mach
In der Lauschgrube
In Gesellschaft
November
Eternit
Orange
Ginster
Später dann
Haustiere
Panzerband
Orakel
Kältefuchs
In der Lauschgrube
Betet für die dunkle Jahreszeit
Tote Farben
Dämonenräumdienst
Mein Daumenabdruck
Coleridge, In Köhln
Majoran
Robbenträume
Kalk
Der Amselpapst
Schadbild
Der Mann mit dem schiefen Maul
Kosmos
Buchstaben
Bimini
Saftbühne
Weh mir
Dämonenräumdienst
Schlaflabor Potsdamer Platz
Die rote Schnur
Depot
Aus meiner Schamküche
Aus meiner Schamküche
Reno
Eines Tages
Verben
Was meine Feinde singen
Ventile
Rattansofa
Auf niemanden
Las Vegas
Flieder
Steinstaub
Libelle
Folgt mir
DDT
Die Message
Anrichte
Hölderlintage
Grubengedicht
Limbo
Ruh aus in deinem Plural
Meine Tintenstimme
Die Bunkerkönigin
Die Bunkerkönigin
I
II
III
IV
V
VI
Textnachweis
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Farn
Farn
Ich lebe dort, wo ich verbreitet bin,
bei meiner Farnverwandtschaft,
die sich auf Trockenfeldern
teils über Liebesnestern schließt
und teils seit langem schon zu Torf
geworden ist, also ein Buch,
in unentzifferbarer Schrift verfaßt,
wie jene Fährte, jene Spur eines
fremdartigen Geruchs, dem nur die
Hundenase folgen kann. Doch
immerhin ein Buch. Ich schreibe
das mit nassen Füßen, halber Hand
und einem um den Kopf drapierten
Lappen. Von nun an eine andere
Atemtechnik. Ich mache einen
Schritt und komm voran. Ich mache
einen zweiten Schritt und bin schon
da. Ich bin durch Herkünfte
gestapft, der Moorboden bebt,
das Wasser fiept und zischelt,
da ich Binse und Besenheide unter
mir begrabe, dem Hund gleich,
der seine Erinnerung ans Wildsein
auf der Küchenmatte stellt. Ein
Ritual. Ich schreibe dies mit kalten
Händen, schweren Füßen, mit
einem um den Kopf gewickelten
nassen Lappen. Ich habe die kühle
Stirn, ich knipse was an: Wildsein,
Erinnern, der Versuch einer
Schwarztorflektüre – schwarz auf
schwarz. Das bloße Auge kommt
den Hieroglyphen nicht bei. Fiepen
und Schmatzen. Ich laufe nicht
davon. Ich schreibe dies, um
dich zu grüßen, tief im Adlerfarn,
mit beiden Händen und einem um
den Kopf geschwungenen
Frotteetuch: Saufe den Mond, sauf
ihn doch, wenn du kannst.
Scheinfrucht
Und liegst du weinend unterm
Feigenbaum, und hörst du
eine Kinderstimme sprechen,
dann paß gut auf, nimm dich in
acht, denn nicht mehr lang, und
du wirst lesen. Liegst du dort
weinend unterm Feigenbaum
und hörst, wie oben Kerne sich
im Fruchtfleisch drehen, sternlose
Himmelsgloben im dichten,
leeren Raum, in roter Nacht,
und fragst du dich, wie weit
dein Ohr reicht, in die Nähe, in
die Ferne, da du nicht sagen
kannst, ob du ein Mädchen oder
einen Jungen singen hörst,
während du weinst, dann paß gut
auf, nimm dich in acht, denn
nicht mehr lang, und dir werden
die Feigenkerne zwischen
den Zähnen kleben, und du wirst
lesen. Denn du wirst, liegend,
weinend, Kinderstimmen hörend,
selbst ein Blütenboden, du
wirst ein Himmelsglobus und ein
schwarzer Stern, wirst leeres
Blatt und Buch, wirst Buch oder
auch keins, du wirst ein helles
Auge und ein dunkles Ohr, wirst
weher Zahn und rote Nacht,
wirst selber Scheinfrucht sein.
Denn du, nimm dich in acht,
und paß gut auf, wirst bald schon
an der aufgeschlagenen Stelle,
wirst fortan immer an derselben
Stelle lesen, immerzu den Raum
und immerzu den Kern, und dabei
immerzu die beiden Kinder
hören, die nehmen, lesen, nehmen,
lesen jenseits deiner Welt.
Papier
Wie unzerstört ich bin an diesem
Morgen, und ich kann wieder
liegen, unwissend wie ein
Stück Papier. Und alles an mir
ist ein einziger mattblauer Schein
und ein lässiger Faltenwurf
und ein handbreiter Saum und
alles ganz still und mit kleinen
toten Fliegen geschmückt, wie
es sich für einen echten
Morgenmenschen gehört. Und
ich weiß nichts von den Kriegen,
ich weiß nicht, wie man Hunde
auf Füchse hetzt, ich bin
heute weder der flennende
englische Greis, noch bin ich
jener rachitische Knecht unter
Knechten, der ich sonst
immer bin. Am Gaumen klebt
mir die nächtliche, gräßliche
seltsame Süße. Und mein Auge
trieft, ich seh meine Daumen,
und ich finde mich zurück,
und ich gehe ganz langsam im
Kreis, und der Wasserhahn tropft,
und ich bin wieder hier, wo
der Text stets auch der
Hausmeister ist, der nicht einmal
mit seinem Schlüsselbund grüßt,
und den Kittel im Wind
und den Werkzeugkasten sich
selbst auf die Füße. Ich
bin hier. Ich bin unverletzt. Nur
wenn ich niese, weiß ich
nicht, quiekt da in meinem Kopf
die brennende Mickymaus,
quiekt eine Mickymaus, die
niemals spricht, quiekt da
in meinem Kopf die Mickymaus,
die niemand löschen will.
Bambi
Der Dichter arbeitet als Reh im
Innendienst. Und Innendienst
bedeutet: man stellt den
Tisch, den Gang, man stellt
das Stiegenhaus, man stellt das
Mezzanin, den Mistraum, man
stellt die Welt mit Blumen
aus den österreichischen Alpen
voll. Von Zeit zu Zeit arbeitet
der Dichter auch mit Moos.
Er blutet nicht. Waldränder
steuert er nicht an. Er fürchtet
sich nicht vor dem Fuchs, nicht
vor dem Marder. Gläserner
Gärtner ist er, und der Tisch
des Blumengastes ist zugleich
der Tisch des Blumenwirts. Der
Dichter schläft als Hoch-
und Mittel- und als Niederwild
im Nebenkeller, wo sich das
eingekochte Obst zu roten Zeilen
fügt. Das Sonnenlicht dringt
niemals bis zum Boden. Da
knistert es. Da klirrts. »Zurück
zur Rautenklause«, ruft der Dichter
aus seinem bilderlosen Traum.
Der Hartriegel reibt sich
am Reh, das Reh reibt sich am
Einmachglas, in dichter Reihung
reiben die Einmachgläser
aneinander. Auf jedem Etikett
steht BAMBI, in einer Handschrift,
derart zierlich, derart akkurat –
dem Graphologen gefriert
das Blut in den Adern. So schreibt
ein Mensch nur nach der Tat. So
schreibt kein Reh. Mit Tinte nicht
und nicht mit Moos. Bald ist
hier Schluß. Der Dichter atmet
kaum. Er weiß, daß niemand lügt.
In meines Vaters Haus
In meines Vaters Haus sind viele
Wohnungen. Ich möchte keine
einzige von innen sehn. Parterre
steht man knöcheltief in Marzipan.
Man spürt, dies war die längste Zeit
ein Knochenheim. Man wird mit
abgebrochnen Füßen weitergehn.
Der Läufer auf den Stufen fühlt
sich an – man kanns schwer sagen:
wie ein eingeseifter Labrador,
ein Hüftbruch mit Meerschweinchen
nach Feierabend. Im ersten Stock
greift einem etwas in den Schritt.
Nichts Sichtbares – ein
Temperatursturz, ganz leicht. Hinten
im Gang macht Sylvia Plath sich
jeden Mittag an einen jungen, bleichen
Nazi ran. Im zweiten nur
Etagenbetten, heller Sand. Noch
mehr Etagenbetten. Muschelschalen.
Splitt. Der Knabenchor singt einen
Kanon, Tag und Nacht. Hinter
der Wand. Hinter der Wand. Hinter
der Wand. Auf halber Treppe ein
Verschlag, Dentallabor. Da lagern
Kettenraucherzähne, täuschend
echt. Im dritten die entmietete
Einkaufsmeile, die längste in
der ganzen Stadt. Noch in Betrieb
die Waschanlage für meines Vaters
Wagen, den kleinen Daimler, in
dem Yoko Ono starb. Die beiden
hatten sich gerade frisch verliebt.
Im Dach eine Schnappfalle mit
Belohnungen, für die ein jedes Kind
die rechte Hand hergibt – Muscheln,
Knochen, Zähne, Daimler, Labradore,
Etagenbetten, Meerschweinchen
aus Marzipan. In meines
Vaters Haus sind viele Wohnungen.
Benzin
Wie unter milden Drogen geht
der Tag dahin, Bergluft und
einige gedehnte Wolken, du wüßtest
nicht zu sagen, lebst du von einer
kosmischen Strahlungsvollkost,
lebst du von Morphin, denn
du sitzt da wie Hilde Knef in
Euphorie, wenn sie einmal drei
Wochen still im Zimmer saß. Die
Welt hängt voller Dackelhälften.
Überall Fichten. Über dir Gebälk. Du
liebst Benzin. Sei so gut, laß
die Servietten im Schrank. Und sei
so gut, spiel nicht an der
Slowfox-Taste. Kümmer dich nicht
um die Axt. Wie Hilde Knef
sitzt du am Nachmittag, kein Schnee
liegt drüben auf den Gipfeln,
es muß ein früher Nachmittag im
Sommer 1974 sein, bevor sie
aufsteht und kurz aus dem Fenster
sieht. Wie sie in den dämmrigen
Flur verschwindet, an einem losen
Faden reißt, noch einmal mit
den Schultern zuckt und sich das
Kopftuch bindet, wie sie
den leichten Mantel überstreift,
in der Schublade kramt, eine
passende Sonnenbrille findet und
nach ihren Autoschlüsseln
greift, wie sie das Haus verläßt,
wie sie die Tür zuzieht.
Sie steigt ins Cabriolet und kommt,
da sie den Innenspiegel richtet,
doch aus den Buchstaben
nicht raus, während sie, leise
fluchend, den Motor zündet und nun
endlich, endlich, sie hat einen
Termin, nach Berchtesgaden
zu ihrer Wunderheilerin aufbricht.
Die Blutbude
Geister sind das, hier in deiner
Bude, deren letzte Winkel
die Tchibo-Taschenlampe nicht
erfaßt. Das Paradies aber liegt
am Rückweg aus der Apotheke,
wenn man im Park die erste
Schachtel aufgerissen hat. Blitz
der Erkenntnis, Blisterglück und
Augenüberwältigung in einem,
die Sträucher, die Hecken,
Rabatten. Eine bodenlose, eine
vollkommen wortlose Blutliter-,
ich wollte sagen: eine Butterfly-
Literatur, wie sie vor dir zu
Boden geht. Wie sie sich senkt.
Und wieder hebt. Und dann das
alles noch einmal in Ultraviolett.
Das ist das Eisen, die Ekstase,
sind die Eisenpräparate. Denn
der Mensch lebt von seinem
Wahrnehmungswahnsinn und von
Vitaminen, er lebt von den
Farben dort draußen, er lebt
vom Erbeben, darum trägt er
auswärts gern Weiß oder Grau.
Der Mensch sieht zu Mittag