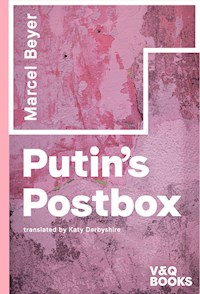Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Marcel Beyer geht der Frage nach, wie sich Schriftsteller:innen heute zur medialen Verarbeitung des Krieges verhalten können. Der Angriffskrieg auf die Ukraine als Zeitwende – nicht nur des Politischen, sondern auch des Erzählens? In seinen Vorlesungen zur Wuppertaler Poetikdozentur für faktuales Erzählen reflektiert Marcel Beyer die Bedeutung der Medien für die Konstitution von "Wirklichkeit" in Zeiten des Krieges: Wann berichte ich nur über das, was ich auf Bildern sehe, wann berichte ich und füge unbewusst meine Imaginationen hinzu? Wann berichte ich nicht mehr nur, sondern erfinde? Kann ich von dem berichten, was ich gesehen habe, ohne zu imaginieren? Was meint "Erfindung", was "Bericht" und welche Rolle kommt dem Schriftsteller dabei zu? Ausgehend von der persönlichen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung aus der Ukraine im Frühjahr und Sommer 2022 eröffnet Beyer so Einsichten in die Funktionen des Erzählens zwischen Fakten und Fiktionen. Der Band wird abgerundet durch die erste deutschsprachige Übersetzung eines zentralen Bezugstextes für Beyer, Viktor Schklowskis Beschreibung der Belagerung von Petersburg während des russischen Bürgerkriegs im Winter 1919/20, sowie ein Interview mit Marcel Beyer, in dem er auf die Besonderheiten seiner Schreibpraxis eingeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Beyer
Die tonlosen Stimmenbeim Anblick der Totenauf den Straßenvon Butscha
Wuppertaler Poetikdozenturfür faktuales Erzählen2022
Mit einem Essay von Viktor Schklowski,
Petersburg unter Blockade
Herausgegeben von
Christian Klein und Matías Martínez
Viktor Schklowski: Petersburg unter Blockade
(russischer Originaltitel: ПЕТЕБУРГ В БЛОКАДЕ)
© Viktor Shklovsky estate, all rights reserved.
Published by arrangement with ELKOST International literary agency, Barcelona, Spain.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2023
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Wallstein Verlag, Göttingen,
unter Verwendung eines Fotos von David Tipling
ISBN (Print) 978-3-8353-5362-6
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8450-7
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8451-4
Inhalt
Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von ButschaErste Vorlesung, Mittwoch, 18. Mai 2022
Mariupol unter Blockade Zweite Vorlesung, Mittwoch, 22. Juni 2022
Ein halbes Jahr später, Anfang Januar 2023
Viktor SchklowskiPetersburg unter BlockadeAus dem Russischen von Olga Radetzkaja
»Die Frage nach dem faktualen Erzählen ist die zentrale Frage seit 1945« Mailgespräch zwischen Marcel Beyer und den Herausgebern Christian Klein und Matías Martínez
Zu diesem Buch
Kurzbiographien
Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha
Erste Vorlesung, Mittwoch, 18. Mai 2022
I
Ich will nichts erfinden. Ich will berichten, was ich gesehen habe. Und das heißt, auch von dem zu erzählen, was ich nicht sehe. Ich bin dem Geschehen, das ich beschreibe, nicht ausgesetzt. Ich bin nicht Akteur, bin nicht Opfer. Ich nehme nicht einmal die Rolle eines unmittelbaren Beobachters ein, wie etwa ein Kriegsreporter, der damit sein Leben riskiert. Mein Leben ist nicht in Gefahr. Ich bin in Sicherheit.
Ich schreibe Anfang April, zu Frühlingsbeginn 2022. Wir erwarten die Rückkehr der Zugvögel.
Auf den Bildern, die ich seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine am Morgen des 24. Februar gesehen habe, ist mir etwas aufgefallen. Etwas, das es auf diesen Bildern nicht zu sehen gibt. Es fehlen die Krähen.
Ich sehe Felder, die bis an den Horizont reichen, sehe städtische Parks, sehe Grünanlagen in Hochhaussiedlungen, aber nirgendwo auch nur eine einzige Krähe. Auf dem Dach der Tankstelle könnten Krähen hocken. Dort beim Supermarktparkplatz. Krähen könnten zufällig durch das Bild fliegen, wenn die Smartphone-Kamera in den Himmel gerichtet wird. Aber nichts.
Seit dem 24. Februar habe ich vor allem Katzen gesehen und Hunde. Auch Schildkröten, Kaninchen. Einmal sogar ein Buschhörnchen. Exotische Vögel im Käfig. Haustiere allesamt, die von ihren Besitzern mitgenommen wurden auf die Flucht, oder Haustiere, die zurückgeblieben sind, weil ihre Besitzer nur einige Tage haben verreisen wollen, während die Nachbarn die Katze füttern, den Hund ausführen werden, doch dann gibt es keine Rückkehr, gibt es nur die überstürzte Weiterreise hinaus auf die Dörfer, wo der Krieg noch nicht angekommen ist, oder noch weiter in Richtung Westen, weiter ins Nachbarland, und wo sind nun die Nachbarn, ich weiß es nicht, sie sind so wenig zu sehen wie die Krähen, die im Frühjahr über dem Feld darauf warten, dass der Bauer mit der Aussaat beginnt.
Ich sehe Bäume am Feldrand, geborsten und schwarz. Geborstene, schwarze Bäume am Straßenrand. Sträucher, die keine mehr sind.
In einem Garten abseits der Stadt sehe ich Hausgänse, die vor einem zerstörten russischen Panzer umherlaufen.
Eine Handvoll Tauben, wie sie unter einer Staffel russischer Militärhubschrauber durchs Bild fliegen.
Zwei, drei Möwen im sonnigen Morgenhimmel über Mykolajiw, zufällig von der Überwachungskamera eingefangen, als eine russische Rakete im Gebäude der Gouverneursverwaltung einschlägt.
II
Es mag obszön klingen, auf die An- oder Abwesenheit von Krähen auf Fotografien und in Videosequenzen zu achten, wenn von Bildern aus einem Krieg die Rede ist, der jetzt, unmittelbar während ich diese Sätze schreibe, mit bestialischer Wucht gegen ein Land geführt wird, das zwei Flugstunden entfernt liegt. Oder, wie sich berechnen lässt, von meinem Wohnort Dresden aus mit dem Auto acht Stunden und 26 Minuten, sofern man die Strecke über Breslau, Kattowitz und Krakau wählt, um über die Entfernung von 851 Kilometern in die westukrainische Stadt Lwiw zu gelangen, oder neun Stunden und 59 Minuten für 1011 Kilometer, sofern man den Weg über Prag vorzieht.
Weit entfernt von meinem Schreibplatz, von Ihrem Schreibplatz liegt Lwiw nur im Kopf, lässt man sich zum Vergleich etwa die schnellste Route von Wuppertal nach Mailand berechnen: acht Stunden und 27 Minuten für 866 Kilometer, also sogar eine Minute und 15 Kilometer mehr als von Dresden nach Lwiw.
Lwiw, Kraków, Katowice, Wrocław, Praha, Lemberg, Krakau, Kattowitz, Breslau, Prag – alle diese Städte sagen mir etwas. Von Kattowitz abgesehen, woher meine Urgroßeltern stammten, habe ich alle diese Städte kennengelernt, habe sie besucht.
Es mag obszön klingen, von Tieren zu sprechen, die fehlen. Möglich, dass es so ist. Wir werden sehen. Ich will versuchen, die Obszönität zugleich zu vermeiden und sie zu thematisieren. Mir ist klar, ich betreibe Volksetymologie, wenn ich den Begriff »obszön« wortgeschichtlich nicht auf das lateinische ›obscenus‹ (schmutzig, schamlos) zurückführe, sondern ihn als eine Zusammenziehung auffasse: »obszön«, »auf offener Szene«, »vor aller Augen«, so wie Russland seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine vor aller Augen führt, vor den Augen der Welt.
III
In jener heute unendlich weit zurückliegenden Zeit, in jener mittlerweile zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder acht oder mehr Wochen zurückliegenden, ein für alle Mal abgeschlossenen Epoche, als man noch versuchen konnte, sich angesichts eines allgegenwärtigen, unentrinnbaren Grauens wenigstens geistig in Sicherheit zu bringen, wurde von Ukrainern immer wieder mit grimmigem, auch mit naiv befreiendem und albernem sowie, äußerst wirkungsvoll, drastisch obszönem Humor auf die imperialen Gelüste Russlands reagiert.
Eine Karikatur, die Wladimir Putin als Zentaur darstellt: der freie Oberkörper, wie ihn der russische Präsident in besseren Zeiten so gerne öffentlich zur Schau gestellt hat, montiert auf den Geschlechts-, Verzeihung: montiert auf den Gefechtsturm eines russischen Panzers, dessen Geschützrohr sich schlaff dem Boden entgegenneigt.
Auf einem Bild hält Wladimir Putin eine Nadel an einen Luftballon in den Nationalfarben der Ukraine. Auf dem nächsten Bild sieht man den Luftballon unversehrt, während der russische Präsident platzt wie ein Luftballon.
Die Collage einer Katze in ukrainischer Tracht, mit ebenjenem unversehrten Luftballon, nun in Herzform, in der Pfote.
Eine andere Katze, die auf die blau und gelb gefärbte Wand im Hintergrund den Schatten eines Löwen wirft. Man sollte dieses Haustier nicht unterschätzen. Zugleich setzt die Katze mit Löwenschatten aber auch eine Absage an die Raubtiermetaphorik ins Bild, derer sich kriegsliebende Staatsführer gerne bedienen. Staatsführer allesamt, die keinen Humor kennen, nur Schadenfreude.
Die Präsenz der Tiere in Zeiten der Bestialität.
Zwischendurch scheint es sogar, als breche erneut eine Ära der Bärenwitze an, wie man sie in der Sowjetunion kannte. Ein Cartoon zeigt den großen, sich allmächtig fühlenden russischen Bären, der allerdings nicht grimmig brummt, nicht markerschütternd brüllt, sondern winselt, weil seine Kronjuwelen, seine Hoden, seine Eier in einer Bärenfalle eingeklemmt sind, in den Nationalfarben der Ukraine bemalt.
Tierdarstellungen, um sich Mut zu machen. Um sich und anderen für einen Augenblick über das allgegenwärtige Grauen hinwegzuhelfen. Tierdarstellungen aber auch, um die russische Propaganda der Lächerlichkeit preiszugeben.
So rechtfertigte der Botschafter der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, am 11. März bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der UNO vor seinen versammelten Kolleginnen und Kollegen den russischen Einmarsch in die Ukraine mit einer Verschwörungsgeschichte, gleichermaßen haarsträubend und niederträchtig, gleichermaßen unverfroren und die Vernunft beleidigend. Demnach arbeite die Ukraine gemeinsam mit den USA insgeheim an einem Programm zur Entwicklung einer biologischen Waffe. Man sei damit befasst, ein gefährliches Virus zu züchten, genetisch in einer Weise manipuliert, dass sich an ihm ausschließlich Slawen mit einer tödlich verlaufenden Krankheit infizierten, gegen die es keine Therapie gebe und keinen Impfstoff.
Dieses Killervirus solle nicht nur von Vögeln, es solle auch von Fledermäusen und Reptilien verbreitet werden, und zwar während der Frühjahrs- oder der Herbstmigration dieser Zugvögel – und, wie man ergänzen muss: auch der Zugfledermäuse und Zugreptilien –, deren Route über das russische Staatsgebiet führt. Dort, so die geheimen Pläne der Ukraine und der USA nach den Worten des Botschafters der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen, würden die Vögel die russische Bevölkerung, offenbar nach seiner Überzeugung die einzige slawische Bevölkerung auf der Welt, heimtückisch dem Virus aussetzen, um auf heimtückische Weise Völkermord zu begehen.
Nachdem Russland der befremdeten Weltöffentlichkeit in anklagendem Ton seine sprachlos machende Killervögelverschwörungsgeschichte serviert hatte, mit bitterernstem Gesicht, ohne das leiseste Zucken im Mundwinkel, reagierten Menschen in der Ukraine darauf mit bitterem, schwarzem Humor. Jemand präsentierte eine kurze, woher auch immer und aus welcher Zeit auch immer stammende Filmaufnahme von einem Taubenschlag, der vermutlich anlässlich eines Brieftaubenwettbewerbs geöffnet wird, worauf sich nach und nach ein großer Schwarm Tauben in die Luft erhebt. Wenn Russland bekennt, sich nun schon vor gewöhnlichen ukrainischen Brieftauben zu fürchten, dann ist es um die Eier des russischen Bären tatsächlich nicht gut bestellt.
Ich sah das Smartphone-Video eines Mannes, der ein Huhn in den Händen hält und ihm zuflüstert, es solle sich einprägen, ab jetzt sei es kein gewöhnliches Huhn mehr, irgendwo auf dem Land Tag für Tag vor sich hin lebend, Eier legend, Futter pickend, im Boden scharrend, sondern ein gefährliches Killerhuhn. Ab sofort habe das Huhn eine Mission, die weit über alles hinausgehe, was ein Huhn üblicherweise vom Leben erwarten könne. Der Hühnerhalter flüstert – so wirken seine Sätze eindringlicher, und zugleich flüstert er, weil es darauf zu achten gilt, dass niemand Drittes von der bevorstehenden Geheimoperation erfährt. Außer weiteren Hühnern jedoch ist niemand in der Nähe.
Das Huhn betrachtet seinen Einflüsterer, scheint nicht ganz zu wissen, was es von dessen Ansprache halten soll, gackert ein wenig. Schließlich lässt der Besitzer es fliegen. Doch das Huhn verspürt offenbar gar nicht den Drang, sich in Richtung der russischen Grenze in Bewegung zu setzen. Es flattert auf, verschwindet für eine Sekunde aus dem Bildausschnitt, dann landet es wieder zu Füßen seines Besitzers. Dieses Huhn nimmt seine Mission anscheinend nicht sonderlich ernst, ihm ist anzusehen, es wird niemals nach Russland fliegen, um ein tödliches Virus auf die Menschen zu übertragen. Keinerlei Expansionsgelüste unter ukrainischen Hühnern beobachtbar.
Dass schwarzer Humor eine Waffe gegen den Ernst des Tötens darstellt – die Ukrainer haben es begriffen. Und selbst wenn dieser schwarze Humor das Töten nicht beenden kann, kann er doch helfen, sich für einen Moment lebendiger zu fühlen, während man Stunde um Stunde in Todesangst verbringt.
IV
Mag der innere Widerstand dagegen derzeit auch groß sein – gerade jetzt erweist es sich als aufschlussreich, wenn man den Abscheu überwindet und noch einmal die innere Bildergalerie abschreitet, in der – dicht an dicht, in Petersburger Hängung – die ikonographischen Fotografien der Putin-Ära versammelt sind.
Während seiner KGB-Zeit in Dresden Ende der achtziger Jahre sieht man Wladimir Putin als ganz gewöhnlichen Kaffee-Sachsen an einer Konditoreitheke stehen, sieht ihn als Beamtenmäuschen im schlecht sitzenden Anzug am Gasthaustisch hinter zwei bauchigen Flaschen Radeberger Pils und einem Dekostrauß Nelken, wie man sie nach der hierzulande verbreiteten Blumensymbolik einem Toten aufs Grab stellt. Später sieht man Wladimir Putin, den Besucher mit Machtfülle, auf der Brühlschen Terrasse stehen, der wie ein Tourist in der eigenen Stadt den Blick über die Elbe schweifen lässt.
Mit seiner auf Ewigkeit angelegten Präsidentschaft dann verwandelt sich Putins persönliche Eremitage nach und nach in eine Menagerie, zu der niemand außer dem Präsidenten selbst Zutritt hat.
Wladimir Putin, der Kraftvolle, wie er mit freiem Oberkörper und Sonnenbrille auf einem wuchtigen Rappen in der malerischen Berglandschaft von Tuwa umherreitet.
Wladimir Putin, der Geduldige, wie er als Angler still sitzt und abwartet, bis ein mächtiger Fisch angebissen hat, den er blitzschnell aus dem Wasser ziehen und an der Luft ersticken lassen wird.
Wladimir Putin, der versierte Jäger und fürsorgliche Veterinär in einer Person, wie er sich über einen am Boden liegenden Tiger beugt. Ob dieses Raubtier zahm ist und für den Fotografen ein Kunststück vollführt, ob es verletzt ist oder ob es erlegt wurde, spielt so genau keine Rolle – entscheidend ist, dass der Mann im Flecktarnanzug den Tiger, auf ihn herabschauend, unterworfen hat.
Wladimir Putin, der stillvergnügte Sadist, wie er Angela Merkel das Fürchten lehren will, als die beiden am 21. Januar 2007 nach einem Arbeitsgespräch in Sotschi am Schwarzen Meer vor der versammelten Presse erscheinen und mit einem Mal, wie zufällig, Putins Labradorhündin Kuni in den Raum gelaufen kommt, ein nicht mehr ganz junges, vermutlich durch und durch gutmütiges Tier, das in diesem Moment ohne eigenes Zutun die Rolle eines grobschlächtigen Fleischerhundes übernimmt.
Wenn ein Präsident sich über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg in derartigen Posen inszeniert, kann es gar nicht verwundern, ist es nur folgerichtig, dass er seinen Plan zur Vernichtung der Ukraine damit rechtfertigt, es gelte, »den Westen« als Ganzes zu treffen. Nach seiner Überzeugung ist »der Westen« – zu dem dummerweise heute auch ziemlich viel »Osten« gehört – dekadent, schwach, verweichlicht, unmännlich. Kurzum, wir sind, nach einer neu-russischen Wortprägung: Gayropa.
Man könnte glauben, Wladimir Putin, der Tigerbezwinger, gräme sich, dass er den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, um die Tigerfreunde Siegfried und Roy zu bombardieren.
»Der Westen« ist verweichlicht, ist unmännlich? Bitte schön, das können Wladimir Putin und seine vulgären kirchlichen Hilfstruppen gerne haben: In aller Welt feiern Tiermagazine in diesen Tagen den kleinen ukrainischen Minensuchhund namens Patron, der im Umland von Tschernihiw dabei hilft, russische Blindgänger aufzuspüren. Videoaufnahmen zeigen, mit welchem Feuereifer Patron, der braun-weiß gescheckte Jack Russell, kaum größer als eine Katze, sich im Gelände bewegt. Sein Geruchsinn ist darauf trainiert, Sprengstoff zu erkennen. Hat er eine nicht explodierte Granate entdeckt, verharrt er, bis sein Sprengmeister an der Fundstelle eintrifft. Kein Bericht versäumt es mitzuteilen, dass Patron eine Vorliebe für Käse hat. Und ein Stück Käse bekommt er am Ende jedes erfolgreichen Arbeitstages. – Friss das, russischer Bär.
Womit, fragt man sich, werden wohl Tiermagazine in Moskau und Petersburg in diesen Wochen aufmachen? Mit läppischen Kitschpathosartikeln über Killerdelfine?
Derweil sitzt der Präsident, der sich inzwischen die Beinamen Putler, Zar Lilliputin und Bunker King erworben hat, sitzt der ehemals kraftvolle, geduldige, der versierte Jäger und fürsorgliche Veterinär nicht einmal mehr als Zentaur mit hängendem Geschützrohr, er sitzt als zittriges Männchen mit krummen Beinen auf einem ein paar Zentimeter zu hohen Stuhl und klammert sich mit beiden Händen an der Tischplatte fest. Jemand erlaubt sich den Scherz, zu Füßen des Präsidenten zum Vergleich einen mit Hilfe einfacher Bildbearbeitungssoftware zu einer absurd knolligen Gestalt gestauchten Deutschen Schäferhund zu platzieren.
V
Dann beginnt die russische Armee, ukrainische Dörfer zu bombardieren, in denen Hühnerfarmen angesiedelt sind. Sie bombardiert Orte, die von der Rinderzucht leben. Zwischen den Trümmern der großen Ställe, zwischen geknickten Eisenträgern und Wellblechflächen, zwischen zerstörten Traktoren irren die überlebenden Kühe umher.
VI
Tiere sind Tatsachen. Tatsachen, die keinen Einspruch erheben. Was über sie gesprochen wird, kommentieren sie nicht. Tiere können nicht Zeugnis ablegen. Sie können lediglich selbst Zeugnis sein.
Vielleicht liegt hierin ein Grund, warum Tiere Eingang finden in Verschwörungserzählungen, warum sie in Verschwörungserzählungen die Rolle eines stummen Auslösers übernehmen, so wie auch Säuglinge zum festen Motivbestand von Verschwörungserzählungen gehören: als unartikulierte, der Sprache nicht mächtige Lebewesen. Nur im Märchen könnten sie einer Behauptung widersprechen, könnten sie sagen: So war es nicht.
Unter den zahllosen erfundenen Meldungen und Verschwörungserzählungen, die von russischer Seite im Zusammenhang mit dem Einmarsch in die Ukraine verbreitet worden sind, bleiben mir zwei fest im Gedächtnis haften. Die eine, unsagbar niederträchtig, wurde nach der Bombardierung einer Klinik in Mariupol in Umlauf gebracht. Auf Fotografien und Videoaufnahmen waren zwei hochschwangere Frauen zu sehen, die eine von ihnen wurde von Helfern auf einer Bahre durch die Trümmer getragen, die andere konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Die Russische Föderation gefiel sich darin, vermeintliche Beweise zu präsentieren, die Rettung der beiden Schwangeren sei eine Inszenierung gewesen, bei der eine einzige Frau, keineswegs schwanger, sondern zu diesem Zweck ›hergerichtet‹, beide Rollen übernommen habe. Sie sei, so verbreitete etwa die Botschaft der Russischen Föderation in London über Twitter, immerhin schon mehrmals als Schauspielerin in Erscheinung getreten, als versierte Selbstdarstellerin nämlich, wie man anhand von Aufnahmen aus ihrem Videoblog ›bewies‹. Eine Verschwörungsgeschichte, die um einen Säugling kreist, der unsichtbar bleibt, und, so die Behauptung, ›in Wirklichkeit‹ nicht einmal existiert.
Die andere Verschwörungserzählung ist jene um die vermeintliche Züchtung von Killerviren, die ich hier nacherzählt habe. Bei ihr greifen, wie bei den ungeborenen Kindern von Mariupol, ebenfalls Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ineinander. Gefährliche Viren haben auch darum etwas Bedrohliches, weil man sie mit bloßem Auge nicht wahrnehmen kann. Das Virus braucht einen Träger, um sich verbreiten zu können, und es muss Gestalt gewinnen, um als zentrales Moment einer Verschwörungserzählung Verbreitung zu finden. Die Rolle des Trägers übernehmen hier Reptilien, Fledermäuse und Zugvögel, bei denen es sich, wie später von russischer Seite konkretisiert wurde, um Wildgänse handeln soll.
Ob Wildgänse von der Ukraine in Richtung Russland ziehen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß doch, Wildgänse, auf deren Rücken man durch die Welt reisen kann, gehören zu den Sehnsuchtsfiguren in Geschichten, die man Kindern erzählt. Und nur in diesen märchenhaften Erzählungen verfügen sie über die Macht, sich der menschlichen Sprache zu bedienen. Es sei denn, der kleine Junge namens Nils Holgersson, der sich von einer Wildgans durch die Lüfte tragen lässt, hätte gelernt, wie eine Wildgans zu sprechen.
VII
Möglich, nicht allein das Sprechen über Tiere, Fotos und Videobilder von Tieren, sondern die Tiere selbst stellen im Krieg eine Obszönität dar. Wesen, die nichts von der historischen Herausbildung bürgerlicher Konventionen wissen, Wesen, denen die in der bürgerlichen Sphäre herrschenden Schicklichkeitsvorstellungen fremd sind.
Obszön mag es zudem erscheinen, dass man ausgerechnet in ihnen, diesen nichtmenschlichen Lebewesen, dass man in ihrem Blick aus zwei Augen, parallel angeordnet wie die Augen des Menschen, Menschlichkeit erkennen will, wenn Menschen Unmenschlichkeiten verüben. Im Tier sucht man eine Regung, deren Verlust einem droht und deren Verlust andere Menschen bereits erlitten haben, ohne dass sie sich fragen würden, ob ihnen damit etwas fehlt.
Wendet man sich im Krieg Tieren zu, sei es im konkreten Umgang mit ihnen, sei es auf bildlichen Darstellungen oder im Text, steht möglicherweise ihre Charakterisierung als ›unschuldig‹, als ›unschuldige Wesen‹, die Opfer dieses Krieges werden, gar nicht im Vordergrund, wie man annehmen würde. Vielleicht sucht man im Tier vielmehr Anzeichen einer Regung, die man dem Menschen, sich selbst, zuzuschreiben gewohnt ist. Das Tier nicht als Symbol der Unschuld, das Tier als Hüter der Menschlichkeit. Mag es sich um eine Katze handeln, um einen Hund, um eine Schildkröte, eine Kuh, ein Huhn, eine Krähe. Oder um einen Fisch, dessen zwei Augen nicht einmal so angeordnet sind wie bei einem Menschen.
Die geschundene, die gequälte, die verletzte, die verängstigte, die verendete Kreatur: Die einen ergötzen sich an ihrem Anblick, sehen sich in der trivialen Raubtiermetaphorik, nach der sie leben, bestärkt, während die anderen sich im Blick auf das Tier unter den Bedingungen des Krieges der eigenen Menschlichkeit versichern.
VIII
Die Fotografie ist ein stummes Medium. Setzt sie akustisches Geschehen nicht in Szene, indem etwa ein weinendes Kind, ein Helikopter am Himmel, eine sich im Wind blähende schwarze Plastikfolie gezeigt wird, bleibt der Betrachter über das Geräuschfeld eines Fotos im Unklaren.
Bei der folgenden Aufnahme könnte es sich demnach um eine stille Szene handeln: Man sieht eine in Zentralperspektive vor dem Betrachter dahinlaufende Straße, die im Hintergrund auf Wohnhäuser zuhält, auf einen mehrstöckigen Block mit Balkonen. Am linken und rechten Rand des Bildes stehen ebenfalls Häuser. Eine Stichstraße, dort hinten am Ende des Bildes könnte man nach rechts abbiegen oder nach links. Es ist noch nicht Frühling. Kein Laub an den Bäumen.
Der Mittelstreifen der Straße nimmt die Mitte des Bildes ein. Im Vordergrund hat sich ein sandbrauner Hund auf dem grauen Asphalt ausgestreckt. Seine Vorderläufe liegen quer über der Mittellinie, sodass er den Kopf einem Mann zuwendet, der vor ihm hockt, sich über ihn beugt. Links der Mann mit schwarzer Strickmütze, schwarzen Handschuhen, in einer dunkelblauen Wetterjacke und Jeans. Ein großer grünlicher Seesack auf seinem Rücken berührt den Boden. Dahinter ein Katzenkorb aus glänzendem Kunststoff. Rechts von der Mittellinie der Körper des Hundes.
Es könnte sich um eine stille Szene handeln, wären im Hintergrund nicht Trümmerteile auf der Straße verstreut, Wellblech und Ziegel, soweit man die leicht verschwommen im Bild liegenden Gegenstände erkennen kann, und stünde das hellblaue, türlose Auto vor dem Wohnblock nicht merkwürdig schief in der Welt, als hätte eine unsichtbare Hand es an die Mauer gedrückt.
Der Mann legt die Stirn an die Stirn des Labradors, er selbst hält die Augen geschlossen, und mit den Händen verschließt er auch seinem Hund die Augen.
Das Tier rührt sich nicht von der Stelle. Man sieht, die Muskeln seiner Hinterläufe sind angespannt, sein gesamter Leib steht unter Spannung, Starre und Sprungbereitschaft zugleich. Die Todesangst und der Fluchtreflex kämpfen in ihm gegeneinander. Mit jeder Faser bringt dieser Körper zum Ausdruck: Es herrscht höchste Not.
Man sieht, es geht um Sekunden. Jeden Augenblick kann die nächste Granate einschlagen, hier, auf offener Straße. Die Sekunden verstreichen. Man sieht, die beiden verharren in ohrenbetäubendem Lärm.
IX
Ich will berichten, was ich gesehen habe. Ich will nichts erfinden. Wenn ich mich aber, im Unterschied zu einem unartikulierten Tier, der Sprache bediene – wie sähe sie aus, eine sachliche, nüchterne, ›richtige‹ Reihenfolge der mitgeteilten Tatsachen, und wie sähe sie aus, die nichts verfälschende, nichts verschweigende, nicht manipulative Reihenfolge der Sätze?