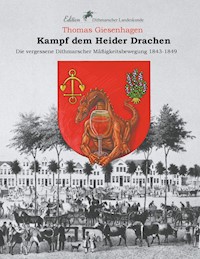
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heide in den 1840er Jahren - Hochburg von Schnapsbrennern und Bierbrauern. Unter den Augen des jungen Mädchenschullehrers Klaus Groth wütet die Branntweinpest. Beherzte Bürger, Pastoren, Moralapostel und Trunksüchtige sagen auch in Dithmarschen dem Alkohol den Kampf an. Ein tiefer Blick in die Heider Stadt- und Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts. Ein Who-Is-Who der Groth-Zeit, das die tiefen Spuren des Geschäfts mit dem Alkohol und des schwierigen Kampfes gegen den Branntweindrachen im heutigen Erscheinungsbild der Stadt frei legt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
Die Branntweinpest
Ein Apostel auf Heider Bühne
Dithmarschen wird erobert
Alkohol, der Landesfeind
Der Drache erwacht
In der Höhle des Drachen
Von Schule und Schnaps
Boysen und der Hahnenkampf
Paragrafierte Enthaltsamkeit
Der Anfang vom Ende
Vorhang auf für einen Mahner
Genießen statt enthalten
Der letzte Kampf
Zwei kurze Betrachtungen zum Beschluss
Quellennachweis
Bildnachweis
Personenregister
Dank
„De Brennerie is en wunnerlich Geschäft.“
Klaus Groth
„Es geziemt dem Menschen nicht,
Weltgegebenheiten zu richten, welche,
in dem Schoß der Zeit langsam vorbereitet,
nur teilweise dem Jahrhundert zugehören,
in das wir sie versetzen.“
Alexander von Humboldt, 18471
„Das Einzige, was ich von allen diesen Dingen besonders hervorheben will, ist die seit etwa 13 Jahren gestiftete „dithmarsische Zeitung“…
Je mehr solcher Localblätter ich kennen lerne, desto mehr erkenne ich, daß sie fast die vornehmsten Fundgruben und Quellen für die Erkenntnis des jetzigen Zustandes der Länder sind, und desto mehr fühle ich, wie wahr Lamartine sagt, daß in Zukunft die Bücher aus den Zeitungen und Journalen würden hervorwachsen müssen, während man früher die Journale mit Auszügen aus Büchern angefüllt habe.“
Johann Georg Kohl, 18462
Vorbemerkung
Am Anfang dieser Zeitreise ins Biedermeier steht ein gehobener Dokumentenschatz - die Wiederentdeckung des Protokollbuchs des 1845 gegründeten „Enthaltsamkeitsvereins gegen das Branntweintrinken e.c. im Kirchspiel Nordhastedt“3.
Mit grobem Strich skizziert ist dieser „vergessene“ Verein bereits in einem Fachbeitrag der Zeitschrift Dithmarschen sowie erstmals im Buch „Dithmarschen unterm Danebrog“. Dort wird er im Zusammenhang mit einem bereits im 18. Jahrhundert von einer besorgten Obrigkeit registrierten übersprudelnden Alkoholkonsum in Dithmarschen in den Kontext vorgehender lokaler Ereignisse in Nordhastedt gestellt, thematisch aber noch nicht tief durchdrungen, da es sowohl den inhaltlichen als auch zeitlichen Rahmen des Buches gesprengt hätte.
Hinter dem auf den ersten Blick profan bis kurios anmutenden dörflichen Vereinsbuch verbirgt sich ein beeindruckendes Stück in Vergessenheit geratener Zeitgeschichte, das an erstaunlich vielen Stellen Dithmarschens, insbesondere aber in Heide, bis heute verblüffende Spuren hinterlassen hat.
Eine umfassende Beschreibung der ab 1843 für gut sechs Jahre auch in Dithmarschen wirkenden „Mäßigkeits- und Enthaltsamkeitsbewegung“ soll hiermit erfolgen.
Vor der Zeit überrollt von den politischen, gesellschaftlichen und militärischen Erschütterungen der Schleswig-Holsteinischen Erhebung 1848-1851 sind diese ersten Mäßigkeitsvereine ein kurzlebiges und deshalb in der regionalen Geschichtsforschung bisher wenig beachtetes, in weiten Teilen sogar vergessenes Beispiel für die bürgerliche Denkwelt und einen von noch vielen politischen Fesseln gezähmten gesellschaftlichen Gestaltungswillen im Biedermeier.
Die Wahrnehmung eines erheblichen und für zahlreiche besorgte oder betroffene Bürger schwer erträglichen sozialen Missstandes und ein klassenübergreifendes gesellschaftliches Engagement im Kleid der Vereinsidee sind Ausdruck einer Zeit, die allerdings 1844 in den Augen zahlreicher Konservativer bereits „an Vereinssucht leidet“.4
Der Prozess von Meinungsbildung und Maßnahmendefinition erfolgt dabei organisatorisch und logistisch bisweilen sehr kontrovers. Der Kampf gegen das drängende familiäre und gesellschaftliche Problem der Zeit, der selbst die Jugend immer stärker bedrohenden „Branntweinpest“, führt zudem unter den Augen eines jungen Heider Mädchenschullehrers Klaus Groth die Pastorenschaft Dithmarschens in einen brisanten inneren Konflikt und mit diesem Stoff die noch junge lokale Presse auf erste Höhenflüge.
Groths geschäftiges und umtriebiges Heide der 1840er Jahre wird mit guten Gründen zur Arena der markantesten Kontroversen. Eine Geschichte der Dithmarscher Mäßigkeitsbewegung wäre weder vollständig noch verständlich, wenn sie nicht auch die familiären und ökonomischen Strukturen der sich um den Heider Markt in erstaunlich großer Zahl scharenden Brauer und Branntweinbrenner der Zeit einschließen würde.
In diesem Sinne ist die Geschichte der ersten Mäßigkeitsvereine auf dem Höhepunkt der eine ganze Generation prägenden Branntweinpest auch ein tiefer Blick hinter die Fassaden und in die Keller der Heider Stadtgeschichte des 19. Jahrhunderts.
Die Branntweinpest
Die Stellung des Alkohols im gesellschaftlichen Leben Dithmarschens, bis hin zu seinem Siedepunkt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Brauer und Brenner gehören auch in Dithmarschen zur bürgerlichen Elite. Eine erste Einführung in Heides Gewerbestruktur um das Jahr 1800, zunächst im Wesentlichen zu Osten des Marktes.
Den genauen Beginn des „Zeitalters der Branntweinpest“ festzulegen, fällt naturgemäß ebenso schwer, wie fast jede andere punktgenaue Verortung einer Ära. Alkoholgenuss, auch im Übermaß, ist frühes menschliches Kulturgut. Bereits Luther identifiziert die Deutschen ganz pauschal als „Wein- und Saufteufel“ und auch der Dithmarscher Chronist Neocorus berichtet von üppigen „Burgelaggen“ oder dem Schwelgen und Saufen „in Weertschoppen“ der stets auf Trunk erpichten Landeskinder. „Daß ist ein Landt, dar muß man sich auß freße und auß sauffe.“
Die Dithmarscher Ess- und Trinkfestigkeit wird zur Legende, ähnlich wie in anderen ländlichen Regionen: „Dithmarscher Magen is mit Blick (Blech) beslagen.“5 Es entwickeln sich sogar spezifische Dithmarscher Trinkbräuche, wie das Auffordern mit „krick“, dem mit „krack“ zu danken ist, das aus dem Meldorfer Raum gar bis ins Schleswigsche Hollingstedt exportiert wird.6
Dem stellt schon Neocorus etwas sehnsüchtig und mahnend zugleich die längst vergangenen Tugenden der Altvorderen gegenüber und schwärmt „van Metichkeit der Ditmerschen in Eten unde Drinkende“. Dabei waren auch in ältester Zeit Korn, Bier und Wein durchaus schon gebräuchlich: „…,dat ehr Gedrenke van Garsten edder Korne si gebruwet, unnd Ardt deß Wineß gehatt, …, ehn geleret, gutt Beer bruwen.“7
Die seinen Wert in einer ganz besonderen Weise schätzende sprachliche Wurzel des Alkohols findet sich allerdings jenseits des (Platt-)Deutschen in einem ganz anderen Kulturkreis und kann auf das arabische „al-kuhul“ für „das Edelste“ oder „das Feinste“ zurückgeführt werden, ursprünglich gebraucht im Zusammenhang mit fein gemahlenem Pulver bei der Herstellung von Schminke.
Für das ländliche Dithmarschen mit seiner über Jahrhunderte adelsfrei stabilen gesellschaftlichen Schichtung von Großbauern, Kätnern und Tagelöhnern kann man eine erstmals von der Obrigkeit registrierte Besorgnis über eine in der breiteren Bevölkerung spürbare überbordende Trinklust in den Zeiten nach dem Großen Krieg 1618-1648, den Anfängen des allgemein sinnenfreudigen Barock, festmachen. Nachkriegsgenerationen holen zum Ende des 17. Jahrhunderts auch hier lang Entbehrtes in vollen Zügen nach und leben sich aus: pure Freude am Leben.
Vielfältig sind die Liebesbeweise erhalten und analysiert, die die Dithmarscher auch noch im folgenden 18. Jahrhundert dem berauschenden Elixier erbringen. Als ihm das allgemeine Treiben allerdings zu bunt wird, sieht sich der von seinen deutschen Hofpredigern pietistisch getriebene Dänische König Christian VI. schließlich genötigt, 1736 eine Sabbatordnung zu erlassen, um Schankwirten und Saufenden mindestens an Feiertagen Einhalt zu gebieten. Majestät will die Seelen seiner von Geburt an sündhaften und deshalb erlösungsbedürftigen Landeskinder erretten.
Auch die Sperrstunde wird geboren, vornehmlich allerdings, um die von trunken heimkehrenden Rauchern ausgehende Feuergefahr einzudämmen.
Doch auch wenn die allgemeine Trinklust Geistlich- und Obrigkeit zunehmend besorgt, zum beherrschenden sozialen Problem werden Lust und Sucht noch nicht. Man trinkt auf dem Land überwiegend ein selbst gebrautes Bier, das von Gesetzes wegen jenseits der jeweiligen Dorfgrenzen nicht verkauft werden darf. Glaubt man den Berichten, dann wohl aus gutem Grund. Häufig sind diese lokalen Biere minderer Qualität. Einen überregional guten Ruf genießt im Nordelbischen allenfalls das bereits in professionellen Mengen gebraute Altonaer und Hamburger Bier. Doch auch der auf dem Land aus meist schlechtem Wasser eiligst obergärig zusammengebraute Gerstensaft ist nicht nur häufig eine gesündere Lebensnotwendigkeit als das gefährliche unbehandelte Wasser, sondern auch deutlich preiswerter als der nur in vergleichsweise geringen Mengen in Dithmarschen aus Getreide gebrannte oder gar teuer importierte Hochprozentige.
Das Bier ist deshalb auch über Jahrhunderte die bevorzugte Wahl, wenn es ans Feiern geht. Nicht von ungefähr hat sich das plattdeutsche „Beer“, wie im Heider „Hohnbeer“ oder dem Nordhastedter „Frunsbeer“, als regionaler Begriff für ein Fest im Allgemeinen erhalten.
Auch das zur Fertigstellung neuer Häuser gefeierte Dithmarscher Fensterbier – ein Vorläufer zum heute gebräuchlichen Richtfest - ist als traditionelles Brauchtum des 17. und 18. Jahrhunderts noch in weiteren Kreisen bekannt und im Dithmarscher Landesmuseum in Form dekorativer, handgemalter Fensterscheiben zu bewundern.
Und in der allergrößten, sprich festfreien alltäglichen „Not“ kann man das dann mit Brot angereicherte niederprozentige Bier in Dithmarschen seit Alters her als mit Zucker, Honig oder Sirup durchsüßte Biersuppe oder „Warmbeer“ zu sich nehmen.
Als ein Beispiel der Vielfalt traditioneller und häufig von Dorf zu Dorf scharf abgegrenzter Festbräuche mag auch der folgende gelten. In unseren Tagen in allgemeine Vergessenheit geraten ist das wohl im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert gebräuchliche, allerdings recht banal daherkommende „Looperbeer“. Die Chronisten Marten und Mäckelmann beschreiben ein Dithmarscher Trinkspiel, in dem bereits der Schnaps das ältere „Beer“ unterwandert hat und eine Hauptrolle spielt8:
„…ein Wettlauf zwischen einem Burschen und mehreren jungen Mädchen. ...Der Bursche begibt sich mit einem der Mädchen, der „Looperbrut“, an die Ablaufstelle, gibt seiner Partnerin einen leichten Stoß und läuft davon. Die junge Deern folgt ihm bis zur ersten Läuferin, übergibt dieser ein Tuch oder ein Fähnchen, und dann läuft diese zur zweiten und diese zur folgenden und so fort bis zur letzten, die nach dem Ziele läuft. Während die Mädchen den Stafettenlauf ausführen, durchläuft der Bursche die Bahn, muss aber mitten in dieser haltmachen und erst einen „Köm“ oder „Grog“ austrinken, dann darf er den Lauf fortsetzen. Am Ziel ist ein Kranz aufgehängt, in dem sich als Geschenk der jungen Mädchen eine Tabakspfeife befindet. Gewann der Bursche den Lauf, was gewöhnlich der Fall war, so erhielt er die Pfeife, lief das letzte junge Mädchen zuerst durchs Ziel, so musste sich der Bursche durch eine Trunkspende freikaufen.“
In weiten Teilen Dithmarschens kommen im 18. Jahrhundert auf einen gewerbsmäßigen Schnapsbrenner noch mehrere „Brauer“. Häufig brennen die Bierbrauer, die meist auch gleichzeitig als Bäcker tätig sind, in einem weiteren Nebengewerbe einfach mit. Man ist im traditionell an Brennstoff armen Dithmarschen auf höchste Effizienz angewiesen.
In Meldorf beispielsweise reihen sich vor 250 Jahren die Brauer des Geerviertels zeitweise wie an einer Perlenschnur über die Nordseite des Zingel aneinander, die Dührsens oder Lempferts, und legen hier ein materielles Fundament für einflussreiche Dithmarscher Familiendynastien jenseits der Landwirtschaft. Noch drängen sie einen spezialisierten und zugewanderten Brenner Hans Thiessen (1737-1780), Sohn des gleichnamigen Sarzbüttler Landesgevollmächtigten, an den östlichen Rand des Zingels beim Tor. Doch auch dem mit ausreichend familiärem Startkapital ausgestatteten Neuankömmling Thiessen beschert sein Gewerbe bald einen eigenen Wohlstand, der dem seiner auf umfangreichem Geestland sitzenden Bauernfamilie wenig nachsteht.
Brauer und Brenner gehören früh zur vermögenden bürgerlichen Elite aller Gemeinden. Dem Geld folgt unmittelbar Einfluss und Engagement. Man beteiligt sich umfangreich an der Selbstverwaltung der Landgemeinden und Fleckensviertel. Jedes der fünf Viertel Meldorfs hat seinen eigenen, meist nachbarschaftlich orientierten und florierenden Braubetrieb.
Im Norderviertel braut man pikanter Weise schon im 17. Jahrhundert genau an der Wohlstand bescherenden Stelle ein lokales Bier, an der Jahrhunderte später das Finanzamt entsteht. Hier hat bereits die für Meldorf bedeutende Familie Bütje ihre Finger im Spiel bzw. am Fass. Im 19. Jahrhundert lebt diese ältere Brautradition im Meldorfer Nordwesten zu Füßen der Nordermühle nach über hundert Jahren Pause in Sichtweite der alten Braustätte an der nahegelegenen Promenade wieder auf.
Rosen- und Burgviertel lassen über die Zeiten zu beiden Seiten auf mittlerer Höhe der Süderstraße brauen. Das Klosterviertel wird seit jeher durch das Klosterbrauhaus neben der alten Gelehrtenschule aus der Nähe versorgt. Hier sind zeitweise die aus Wilster zugewanderten und nun im Klosterviertel sesshaft gewordenen Bütjes aktiv.
Im Norderdithmarscher Heide ist man dagegen früher als anderenorts in Dithmarschen auch mit Branntweinbrennern hervorragend bestückt. Für das Jahr 1717 werden bereits 6 Destillateure genannt, dazu 9 Bierbrauer, 13 Bierzapfer und 4 weitere Gastwirte, bei denen man auch speisen oder nächtigen kann.9
Um 1800 hat sich diese beachtliche Zahl an Schnapsbrennern bei rund 3.500 Einwohnern weiter erhöht. In fast jedem der vier aus den älteren und nur in Teilen deckungsgleichen „Eggen“ hervorgegangenen Quartiere sind nun bereits zwei hauptberufliche Brenner zu finden und damit eben so viele wie die sieben Brauer. Man konkurriert in Heide bereits auf Augenhöhe um die Gunst des genusssüchtigen Publikums.
Dabei scheinen die Heider keine größeren Saufbolde oder Schluckspechte als ihre Dithmarscher Nachbarn. Sie sind in erster Linie geschäftsorientiert und versorgen kaufmännisch geschickt, trotz obrigkeitlicher Handels- (nicht Produktions-) beschränkungen, das an für die Herstellung notwendigem Feuerungsmaterial noch ärmere Umland der Marsch gleich mit.
Häufig ist der wöchentliche Markt Anlass für die kleinteilig unter dem großfürstlichen, später königlich dänischen Radar gehandelten Wochenrationen, die so auch gelegentlich im Gepäck der heimreisenden Händler selbst das nähere nordfriesische oder fernere holsteinische Umland erreichen.
Schnaps spielt aber nicht nur als Ware eine wesentliche Rolle im allgemeinen Markttreiben. Ein erfolgreicher Großviehhandel zu Osten des Marktes wird nicht nur mit traditionellem Handschlag, sondern regelmäßig auch gern mit einem guten „Köm“ besiegelt. Und zwischen ausgeläuteten erfolgreichen Markthandel und Heimreise passt eigentlich jeden Sonnabend noch ein guter Plausch und ein die Zunge lockernder Tropfen in einem der zahlreichen Gasthäuser rund um den Markt.
Bevorzugter, weil allein in ausreichendem Umfang verfügbarer Brennstoff ist im Dithmarschen des 18. und 19. Jahrhunderts der heimische Torf. Erhaltene Materiallisten der Heider Brennereien zeigen die herausragende Bedeutung des braunen Geestgoldes für die Produktion. In einer zur Effizienzsteigerung anregenden obrigkeitlichen Erhebung des Jahres 1810 geben alle inzwischen bereits neun Schnapsbrennereien in Heide an, ausschließlich mit „schwarzem gestochenen Torf“ zu feuern.10
Der Export ins regionale Umland sorgt für eine hohe Marktdurchdringung, stetig steigende Kaufkraft und gute Laune rund um den prosperierenden und in steten Torfrauch gehüllten Heider Markt.
Im Vergleich mit den über 200 Schnapsbrennereien allerdings, die z.B. 1815 in der rund 15.000 Einwohner zählenden nordischen Rum-Hochburg und Handelsdrehscheibe Flensburg genannt werden, ist selbst die Dithmarscher Brennermetropole nahezu asketisch zu nennen.11
Erst seit kurzer Zeit brennt in Heide 1810 auch der zuvor (z.B. noch 1803) nur als Bäcker in Erscheinung getretene und mit einer Enkelin des einstigen Heider Baumeisters Schott verheiratete Jacob Diedrich Peters (1770-1817) zu Norden des Marktes, genau gegenüber dem Viehmarkt, mit dem knappen lokalen Torf zusätzlich zum täglich Brot einen neuen Schnaps. An gleicher Stelle war bereits sein Vater Hans Peters nicht nur als erfolgreicher Bäcker tätig, sondern bekleidete zeitweilig auch das Amt eines Kirchen- und Kirchspielvorstehers.
Vormalige Bäckerei und Schnapsbrennerei Peters/Söth (Mitte) links das alte landschaftliche Haus (später Heider Hof) - Aufnahme um 1860
Nach Jacob Diedrich Peters vergleichsweise frühem Tod wandert diese aus einer örtlichen Traditionsbäckerei der Norderegge hervorgegangene junge Schnapsdestille durch Heirat zur alteingesessenen Heider Brennerfamilie Söth (Stammhaus in der Norderstraße/An der Weide), wandelt sich in der Folgegeneration zur Weinhandlung Söth und wird schließlich zur Weinhandlung Coltzau. Deren Weinkeller ist in Teilen noch heute im Untergeschoss der genossenschaftlichen Bank an der Ecke zum Schuhmacherort erhalten.
Ehemalige Branntweindestille Abraham/Arens (helles größeres Gebäude in Bildmitte über der Straße), Aufnahme um 1860
In der benachbarten Heider Österegge, nur einmal um die Ecke nach Norden und über die Straße, ist der Sohn eines aus Albersdorf zugewanderten Kornhändlers früh zu Vermögen gekommen und mehrt es im 18. Jahrhundert reichlich, auch durch die eigene Veredlung von Getreide. Johann Arens (1730-1809), der mit seinem Gewerbe bereits viele Jahrzehnte vor Peters im Schuhmacherort hochprozentig tätig ist, kommt neben umfangreichem Landbesitz schließlich sogar als Folge seines „erbrannten“ Vermögens als Landesgevollmächtigter zu größtem Einfluss in der Region.
Seine Nachkommen- und Verwandtschaft, auf die wir im weiteren Fortgang der Geschichte noch zahlreich stoßen werden, wird im 19. Jahrhundert wie keine andere Familie die wirtschaftliche und auch bauliche Entwicklung Heides bestimmen. Arens betreibt eine der ältesten Destillen Heides, die vermutlich aus dem Vorbesitz seines Großvaters mütterlicherseits stammt.
Vormalige Brennerei Thedens (ganz rechts) in der Bildmitte das fürstliche Haus an der Marktostseite, Aufnahme um 1920
Auch der zum Grand Seigneur Arens 27 Jahre jüngere Peter Thedens (1757-1826) hat bereits zur Jahrhundertwende als amtierender Kirchen- und Kirchspielvorsteher die Brennerei seines gleichnamigen verstorbenen Vaters übernommen und brennt bereits vor Peters routiniert seine Heider Schnäpse.
Der ältere Vater Peter Thedens war ebenfalls in exponierter Weise, wie fast alle Brauer und Brenner, als zeitweiliger Kirchspielvorsteher im Gemeindeleben besonders stark engagiert.
Thedens Junior ist nun an der Ostseite des Marktes sogar in Spuckweite schräg gegenüber von Jacob Diedrich Peters, der zudem ein Patenkind seines Vaters und damit mit der Familie Thedens auch freundschaftlich eng verbunden ist, zwei Häuser rechts des „fürstlichen Hauses“ (s.u.) in Ergänzung eines neuerdings aufgezogenen Pferdehandels als gewerblicher Branntweinbrenner aktiv. Er erzeugt damit ganz neue Synergien im örtlichen Gewerbe. Den zur Besiegelung manch Pferdekaufs üblichen Schnaps - der Viehmarkt findet direkt vor seiner Haustür statt - kann er aus eigener Familienproduktion gleich mitliefern.
Der um die Jahrhundertwende einzig noch aktive Brauer der alten Österegge, Zacharias Kruse (1754-1821), braut - ebenfalls in bester Familientradition und repräsentativer Lage - sein Bier nur wenige Schritte weiter an der Ecke zur Österstraße. Hier wirkte wohl auch schon sein Vater Michael Kruse als brauender und mit Brenner „Vullmacht“ Johann Arens aus dem Schuhmacherort gut befreundeter Kirchspielvorsteher und -deputierter in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts für das Gemeinde- und Wirtschaftsleben Heides und besonders der Österegge.
Das Gebäude der Traditionsbrauerei Kruse, das heute ein Café an der Ecke Markt/Friedrichstraße beherbergt, wird auch noch Jahrzehnte nach Kruses Tod im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts – und zur Blütezeit der Sturm laufenden Mäßigkeitsvereine - von seinen aus dem Wesselburener Raum zugezogenen geschäftlichen Nachfolgern Her(r)mann als Brauerei am Heider Markt genutzt. Da der gleichnamige Großvater Matthias des von den Vereinen bedrängten Brauers Her(r)mann einst nach dem Spanischen Erbfolgekrieg als Malzer und Kesselhändler aus dem niederländischen Herzogtum Brabant nach Norderdithmarschen kam, könnte der Enkel hier zur Mitte des 19. Jahrhunderts mit Bezug auf das Brabanter Wappentier nun ein Heider „Löwenbräu“ fabrizieren.
Vorgehender alteingesessener Brauer Zacharias Kruse ist – neben anderen Verbindungen, auf die wir noch stoßen werden - ein älterer Bruder des Hemmingstedter Pastors Peter Kruse (1757-1826), der ebenfalls hier an der Südostecke des Heider Marktes zwischen Bierfässern aufgewachsen ist. Pastor Kruse wird nicht der einzige „Seelsorger“ Dithmarschens bleiben, der sich in den kommenden Jahren mit den sowohl Freud als auch Leid bringenden Folgen seines familiären Gewerbes auseinanderzusetzen hat.
Im zweiten Heider Quartier (Fleckensviertel), das vormals ebenfalls in weiten Teilen zur alten Österegge gehörte, wird zur Jahrhundertwende Branntwein auch bereits von dem erst jungen gebürtigen Gaushorner Claus Ralfs (1774-1867), dem „Benjamin“ der Heider Brenner, in der Österstraße schräg gegenüber von Kruse destilliert. Zu gleicher Zeit betreibt dessen Vater Claus Ralfs Senior eine vom Durchgangsverkehr der Landstraße profitierende Krugwirtschaft in Gaushorn, in der seit wenigen Jahren bevorzugt die Erzeugnisse seines Sohnes ausgeschenkt werden dürften.
Ehemalige Brauerei Kruse/Hermann (ganz rechts) auf der Ostseite des Heider Marktes Aufnahme um 1900
Junior ist auf der Südseite der Heider Österstraße auf Höhe der heutigen Rosengasse tätig und damit an gleicher Stelle, an der bis in die jüngere Zeit hinein „Köm-(Heinrich) Off“ dem Gewerbe treu blieb.12 Der fortan in Heide nur „Clas“ gerufene Ralfs Junior hat 1798 die früh verwitwete und ihm gegenüber 20 Jahre ältere Tochter Sara (1754-1837) des Peter Thedens Senior geheiratet und ist nun also nicht nur ein Schwager sondern auch ein weiterer Konkurrent des Branntweinbrenners Peter Thedens, dem Jüngeren, vom Markt.
„Clas“ wird einige Jahre später noch in einer ganz anderen Funktion in Heide aktiv und allseits bekannt. Er bringt als Laienorganist in der St. Jürgen-Kirche mit seiner musikalischen Fingerfertig- und Feinfühligkeit auch andere hochgeistige Genüsse unters Heider Volk.
Nach dem Tod seiner deutlich älteren ersten Frau, die ohne Kinder aus dieser Ehe bleibt, wird der bereits 65-jährige Ralfs 1839 in zweiter Ehe die zu ihm über vierzig Jahre jüngere Nachbarstochter Margaretha Elsabe (1818-1881) heiraten und mit dieser auf dem Höhepunkt der Branntweinpest noch mindestens sechs späte Kinder zeugen.
Die nachbarschaftliche Heirat ist für den nun längst zum „Methusalem“ Gereiften in mehrfacher Hinsicht praktisch und bequem, denn sein neuer und ihm gegenüber sogar jüngerer Schwiegervater Christian Anton Friedrich Schreiner(t) (1786-1856) stellt auf der anderen Seite der heutigen Rosengasse Fässer her. Ralfs sämtliche Erzeugnisse sind im neuen Familienverbund somit bestens aufgehoben.
Nur wenige Schritte weiter westlich, auf Höhe des heutigen Böttcher-Rondells und damit genau gegenüber von Brauer Kruse, produziert an ebenfalls prominenter Stelle bereits der nächste Destillateur Lüdert Ludwig Schmidt (1755-1833). Schmidt ist ein in Weddingstedt geborener Pastorensohn mit älteren Heider Wurzeln, der im Laufe des Jahres 1793 nach Heide, auch der Heimat seiner zweiten Frau (und Cousine) Lucia Franziska Ohlsen (1761-1831), gekommen ist, nachdem er sich zuvor in erster Ehe zehn Jahre in Meldorfs Burgstraße als Gewürzhändler versuchte.
Ehemalige Brennerei Lüdert Schmidt (ganz links) am Übergang Österstraße-Markt, die drei folgenden Häuser sind die Vorgängerbauten von Böttcher/Ramelow auf der rechten Bildseite das Eckhaus der ehemaligen Brauerei Kruse Aufnahme um 1900
Schmidt ist somit auch in Heide von Anfang an bestens vernetzt. Als Kindspatin setzt er beispielsweise 1794 eine Anna Magdalena Christiana geb. Eggers (1760-1841) ein, eine späte Tochter des bereits 1764 verstorbenen vormaligen Heider Bierbrauers aus der Österstraße – zwei Häuser links von Brenner Ralfs - Hans Eggers und zu diesem Zeitpunkt Frau des ehemaligen Landesgevollmächtigten Paul Diedrich Koch.
Von dieser nun Witwe Koch erwirbt einige Jahre später (1799) der Groth‘sche „Duewelskerl“ Matthias Reinhold Nissen das wenige Schritte weiter gelegene Haus mit rückwärtiger Rossmühle am Markt. Hierzu mehr bei der später folgenden genaueren Schilderung der Zustände zu Süden des Heider Marktes im Kapitel „Von Schule und Schnaps“.
Ebenfalls eine Patenschaft bei Schmidt übernimmt die Frau des Brenners und Landesgevollmächtigten Johann Arens aus dem Schuhmacherort. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von seinem Sohn Lüdert Schmidt weiterbetriebene Destille ist im Heider Vergleich – mindestens in seiner baulichen Ausführung zur vorderen Österstraße hin - eher klein, dafür vielleicht aber exklusiver. Schmidts Erfahrungen mit Gewürzen lassen für seine Erzeugnisse eine besondere, den Rachen ordentlich putzende Note erahnen.
Einer der noch wenigen bedeutenden Bierbrauer Heides zur Wende auf das 19. Jahrhundert, der ältere Kirchenvorsteher Hinrich Magnus Wördenhoff (1726-1804) ist ein weiterer Schwager des Peter Thedens vom Markt und Ralfs aus der Österstraße. Er verzapft seine Bierfässer in der Süderstraße für das dritte und weitgehend mit der alten Westeregge deckungsgleiche Quartier und die umliegende trinkfreudige Marsch an der Ecke zur Peststraße (heute Süderstraße 10 und 12 an der Ecke Louisenstraße). Dessen Brauhaus und Fasslagerung befinden sich auf Höhe des heutigen „Heider Eiskellers von 1888“.
Nach dem Tod Wördenhoffs geht diese alte Heider Traditionsbrauerei im Verlauf der folgenden Jahrzehnte u.a. an den aus der Neuenkirchener Marsch zugewanderten jungen Johann Jacob Albers, der sich dann auch mit den entstehenden Mäßigkeitsvereinen auseinanderzusetzen haben wird.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts, nach Niedergang der Vereine und Tod des Jacob Albers, werden Teile der alten Brauerei schließlich zur Schlachterei Albers. Die noch in Teilen erhaltenen, einen guten Meter dicken Kellerwände des heutigen „Eiskellers“ an der Louisenstraße, die zuletzt die Kühlräume der Schlachterei umgürteten, dürften in ihrer Grundsubstanz die Umrisse der älteren Fasslagerstätte der Brauerei Wördenhoff bezeichnen.
Bereits in einem detaillierten Ortsplan von 1756 ist an gleicher Stelle ein rückwärtiges Gebäude der alten Heider Brauerei verzeichnet, an die sich um 1800 westlich erst in einiger Entfernung eine alte kleine Lohgerberei (Zismer) anschließt.
Doch vor weiterer Beschreibung der alkoholischen Gewerbebetriebe der Zeit in Heide, zunächst zurück zur Analyse des sich im Zeitablauf des 18. und 19. Jahrhunderts langsam wandelnden Geschmacks des Publikums.
Bier ist in Dithmarschen am Beginn des 19. Jahrhunderts - und v.a. außerhalb Heides - über alles gesehen immer noch die nachhaltig von der Masse bevorzugte Form von Trinkgenuss.
Den mit deutlich höherem Alkoholgehalt versehenen und ursprünglich ausschließlich auf Traubenbasis produzierten französischen Brannt-“Wein“ oder den karibischen Rum aus Zuckerrohr, den man in den Herzogtümern meist über Flensburg, aber auch aus Hamburg bezieht und früh nach englischem Vorbild als mit „Muskat und Zitrone“ gewürzten Punsch, mal warm, mal kalt genießt, kann man noch unter luxuriöser und teilweise ritueller Lebensfreude abtun.
Willkommspokal von 1764 des Meldorfer Schneideramts
Diese ist häufig genug noch einer überschaubaren gehobenen Schicht kleinstädtischer Bürger und Handwerksmeister vorbehalten. An entsprechend zünftige Aufnahmerituale erinnern u.a. deren „Willkommspokale“ des 18. Jahrhunderts, die im Dithmarscher Landesmuseum zu bewundern sind.
Während die Meister sich allerdings zu besonderen Anlässen mit dem exquisiten und häufig exklusiven Import vergnügen, trinken die Zünfte („Ämter“) regelmäßig bei größeren Zusammenkünften, bei denen auch die Gesellen anwesend sind, in „geselliger Runde“ also, überwiegend das günstigere Bier. Beliebtes Straf- und Trinkmaß bei vielfältig denkbaren und regelmäßig belegten Vergehen ist die Tonne (ca. 120 Liter), im Falle kleinerer Delikte der Anker (ca. 36 Liter).
Doch dann bringen die kriegerischen Wirren des napoleonischen Wirkens die bis dato immer auch beschwerliche, aber robuste Ordnung selbst im etwas abseitigen Dithmarschen ins Wanken. Vorbei ist es mit der 100-jährigen Ruhe des Nordens.
Im Gefolge des dänischen Staatsbankrotts erodieren Grundstücks- und Getreidepreise. Der Weizenpreis pro Tonne sinkt von 40 Mark (= ca. 1.500 Euro) Spitzenpreis im Boomjahr 1801 über 25 Mark im Staatsbankrottjahr 1813 zum absoluten Tiefpunkt auf unter 5 Mark im Agrarkrisenjahr 1825. Das stetig wachsende Armenwesen bekommt auch im ländlichen und vorindustriellen Dithmarschen eine neue soziale und gesellschaftliche Relevanz. Die Historiker haben das Schlagwort des „Pauperismus“ parat.
Mit der Niederlage Napoleons auf den Schlachtfeldern von Waterloo wurde auch das Schicksal der bereits bei Verkündung mehr wirtschaftlich denn militärisch intendierten „Kontinentalsperre“ besiegelt. Die zuvor über viele Jahre abgeriegelte und vor großer britischer (und das bedeutet globaler) Wirtschaftsdominanz „behütete“ kontinentale Landwirtschaft wurde quasi über Nacht wieder für überseeische und in der Mehrzahl über britische Kaufleute initiierte Rohstoffimporte geöffnet, mit katastrophalen Folgen auch für die Landwirtschaft im Norden.
Auch in Dithmarschen wird weitflächig Wohlstand in allen besitzenden Klassen vernichtet, rutschen im Zuge der großen kontinentalen Agrarkrise 1819-1829 zahllose der v.a. in der Marsch meist grundbesitz- und nun häufig auch noch arbeitslosen Tagelöhner an oder unter die Armutsgrenze. Vielerorts können Land besitzende Groß- und Kleinbauern Konkurse nicht mehr vermeiden. Zahlreichen alteingesessenen Familien droht Hofverlust und ein sozialer Abstieg bisher ungekannten Ausmaßes. Teile der noch ärmeren Bevölkerungsschichten rutschen immer häufiger ins perspektivlose Elend ab. Eine Industrie, die die in der rezessiven Agrarwirtschaft zunehmend freigesetzten Knechte, Tagelöhner und Kleinbauern aufnehmen könnte, ist noch nicht entwickelt.
Die Agrarkrise führt neben der allgemeinen Bedrückung der Landwirtschaft auch in Dithmarschen zu unterschiedlichen Entwicklungen, letztendlich aber zu einer gemeinsamen gesellschaftlichen Konsequenz. Die Landwirte gieren im Zuge des immer größeren Preisverfalls bei Getreide nach Alternativen. Schnapsbrennen wird nun allerorts sowohl als Gewerbe als auch rasant wachsender Absatzmarkt attraktiver, insbesondere weil der Rohstoff günstiger wird und die Abfallprodukte der Destillation zudem als Dünger in der Landwirtschaft wieder einsetzbar sind.
Und auch die Kartoffel und der daraus zu gewinnende Schnaps wird ab 1830 als bisher vernachlässigtes und eigentlich meist zuvor nur zur Viehfütterung herangezogenes Anbauprodukt neu entdeckt. Wenngleich der Kartoffelschnaps in Dithmarschen, im Unterschied zu östlicheren Landesteilen Holsteins, nach einer ersten allgemeinen Begeisterungswelle zur Mitte der 1830er Jahre zumindest nicht dauerhaft an die Verbreitung des nachhaltig bevorzugten Korns oder später Kümmels heranreichen wird.13
Die Heider Branntweinbrenner des Jahres 1810 verwenden noch ausschließlich Roggen und Malz für ihre Fabrikate. Einige setzen noch etwas Hafer zu. Die anderenorts übliche Zugabe von Bier beim Brennvorgang wird in Heide nicht praktiziert. Sinkende Preise für Schnaps und gleichzeitig stetig steigende Nachfrage verdrängen im norddeutschen Raum in der Folge zunehmend das niederprozentige und häufig noch qualitativ minderwertige Bier aus der Gunst des aus vielfältigem Frust rasch trinkfreudiger und zahlreicher werdenden Publikums.14
Erst in der Verbindung von Tradition mit diesem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts neuen Phänomen einer breiteren Armut der unteren Klassen, in der Kombination von Trinklust und Lebensfrust, von gelegtem Fundament aus althergebrachten Trinkgewohnheiten und einer neuen drückenden sozialen Not, entsteht auch im ländlichen Dithmarschen allmählich eine das ohnehin zunehmend depressive Gemeinwesen gefährdende „Branntweinpest“.
Der Blick der Biedermeier-Zeit ist geschärft für die gesellschaftliche Problemstellung und herausgefordert zugleich. Das von direkter politischer Einflussnahme noch weitgehend ferngehaltene Bildungsbürgertum will und muss etwas tun und weiß bald eine Form routiniert zu nutzen, die in diesen Tagen als legitimes Medium einer gestaltenden Kraft im kommunalen Bereich auch im absolutistisch-liberal geprägten dänischen Gesamtstaat gestattet und angesagt ist - den Verein.
Ein Apostel auf Heider Bühne
Die Anfänge der Mäßigkeitsbewegung auf dem Höhepunkt der Branntweinpest.
Die Bewegung betritt erstmals die Dithmarscher Bühne und diese liegt mitten im gesellschaftlichen Herz Heides zu Norden des Marktes.
Mehrere, teils überraschende amerikanische Bezüge bilden eine Klammer.
Die Anfänge der „Temperenz“, einer modernen und bewussten Enthaltsamkeits- und Abstinenzidee mit Rückbesinnung auf die urchristliche Tugend der „Temperatia“ finden sich in Nordamerika. Auf dem geistigen Fundament von Puritanismus und Calvinismus entsteht schon ziemlich genau 100 Jahre vor der auch cineastisch umfänglich nachbearbeiteten Prohibition des 20. Jahrhunderts bereits in den späten 1820ern eine erste breit basierte amerikanische Antialkoholbewegung, die „American Temperance Union“.
Als einer ihrer rührigsten Missionare tritt der aus Pennsylvania stammende Robert Baird (1798-1863) in Erscheinung. Der ausgebildete Lehrer und zunächst als Gelegenheitsprediger tätige Baird wird im Hauptberuf Bibelverkäufer für die American Bible Society und Agent der American Sunday School Union.
Sehr zügig entwickelt er einen Grenzen überschreitenden missionarischen Eifer, um das stetig wachsende Übel bei der Wurzel zu packen. Denn ein auffällig großer Teil des amerikanischen Alkoholismusproblems entsteht nicht vor Ort, sondern wird über die Scharen dem heimischen Frust entfliehender europäischer Einwanderer aus der alten in die neue Welt importiert.
Als „Reverend“ tritt Baird 1835 eine mehrjährige Propagandareise nach Europa an, auf der er u.a. 1837 am preußischen Hof empfangen wird und seine „präventiven“ Ideen und Schriften vorlegen kann.15Hier in Berlin wird auch seine „Geschichte der Mäßigkeitsbewegung in den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas“ noch im gleichen Jahr in deutscher Sprache veröffentlicht. Eine Initialzündung für die rasante Verbreitung der Mäßigkeitsidee auch in Deutschland.
Innerhalb kürzester Zeit werden zwei Männer, obwohl konfessionell getrennt, zu maßgeblichen und kooperierenden Trägern der vom preußischen Thron wohlwollend unterstützten Bewegung diesseits des Atlantiks. Während fortan im Süden Deutschlands der katholische Osnabrücker Kaplan Johann Matthias Seling (1792-1860) „ruhmreich“ wirkt, prägt der protestantische Pfarrer Heinrich Johann Böttcher (18041884) von Imsen bei Alfeld im Königreich Hannover aus mit seinem Wirken die Bewegung in Norddeutschland.
„Reverend“ Robert Baird
Früh ist er mit Bairds Schriften in Berührung gekommen und fühlt sich inspiriert. 1840 veröffentlicht Böttcher erstmals den „Branntwein-Feind“, eine „Zeitschrift für die Angelegenheiten der Mäßigkeitsvereine in Nordwestdeutschland“, die seit 1837 zahlreich aus dem Boden sprießen. Weitere Publikationen folgen, die ebenfalls wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in Holstein und Dithmarschen haben werden.
Böttcher ist es auch, der in seiner „Geschichte der Mäßigkeits-Gesellschaften in den norddeutschen Bundes-Staaten oder General-Bericht über den Zustand der Mäßigkeits-Reform bis zum Jahre 1840“ im Folgejahr 1841, auf der Grundlage von Daten aus dem kirchlich verantworteten Armenwesen, den Handlungsbedarf für das Herzogtum Holstein statistisch ausleuchtet16.
Für das „dänische“ Holstein werden auf die ca. 440.000 Einwohner rund 8.800 „Säufer und Trunkenbolde“ ausgemacht. Dazu kämen für Lauenburg bei 38.000 Einwohnern nochmals 760 starke Trinker.
Die Mäßigkeitsgesellschaften identifizieren in diesen Jahren 2% der Gesamtbevölkerung des Herzogtums als der Trunksucht erlegen. Deutschlandweit kommt die Erhebung sogar auf geschätzte rund 3%. Spitze eines Eisbergs und ein breites Feld zugleich für eine beginnende Lobbyisten-Arbeit, die landesweit v.a. im Bildungsbürgertum und Teilen der Geistlichkeit, die ohnehin zuständig für die Armenversorgung und damit direkt von dem Problem auch weltlich betroffen ist, auf lebhaftes Interesse stößt.
Auch im zum dänischen Staatsverbund gehörenden Herzogtum Holstein fasst die Bewegung bereits in den ersten Wochen Fuß. Schon im März 1837 entsteht im Gut Bothkamp bei Schillsdorf im Kirchspiel Kirchbarkau ein zunächst ausschließlich Männern vorbehaltener Mäßigkeits- und Enthaltsamkeitsverein mit 65 Gründungsmitgliedern. Das Gut befindet sich seit 1812 im Besitz des in Glückstadt als Landratssohn aufgewachsenen Geheimen Konferenzrats Detlev Heinrich von Bülow (1782-1855).
Unter dem Vorsitz dessen rührigen Gutsinspektors Hansen strahlt die Idee von hier zuerst im Osten des Herzogtums aus. Es folgen Vereinsgründungen in Lensahn (1838) und Oldenburg (1840), in den nächsten zwei Jahren weitere, u.a. 1841 auch ein reiner Frauenverein auf Gut Bothkamp.17
Eine wichtige Quelle der Ausführungen über die etwas später einsetzende Vereinsentwicklung in Dithmarschen sind die detaillierten Ausarbeitungen des 1862 in Bokel bei Nortorf geborenen Dr. phil. (Jürgen) Christian Stubbe, der als Sohn eines auch zahlreiche Brauer und Brenner mit Rohstoff beliefernden Müllers geboren, aber im nicht nur bezüglich Alkoholkonsums „sündigen“ Hamburg aufgewachsen ist.





























