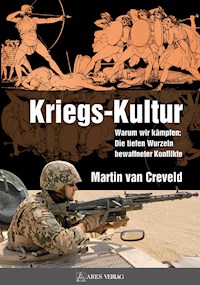Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ares Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Martin van Creveld gilt als der bedeutendste israelische Militärexperte. Seine Thesen über die Zukunft des Krieges haben international Beachtung gefunden. Sein Buch "Kampfkraft. Militärische Organisation und militärische Leistung 1939–1945" gilt als Standardwerk über den Zweiten Weltkrieg und wurde vom Rombach-Verlag in drei Auflagen herausgebracht. Mit einem aktuellen Vorwort des Autors versehen, liegt es nun in einer erweiterten Neuauflage vor. In diesem Werk vergleicht er die deutsche Wehrmacht in Sachen Organisation, Training, Lehre, Taktik und Operationskunst mit den Streitkräften der Alliierten und zeigt, dass sie ihren Gegnern in dieser Hinsicht überlegen war. Auch die Disziplin und Moral ihrer Soldaten bezeichnet Creveld in seiner überaus sachlich geschriebenen Studie als vorbildhaft. Als Jude, der Teile seiner Familie in nationalsozialistischen Konzentrationslagern verloren hat, liegt es Creveld fern, die Verbrechen des NS-Regimes in irgendeiner Weise zu beschönigen, doch hält er ebenso daran fest, dass die Wehrmacht als solche keine verbrecherische Organisation gewesen ist. Daher erklärte er auch in einem Interview mit der Zeitschrift "Focus" anlässlich des 60. Jahrestages des Kriegstages, dass hinsichtlich Strategie, Organisation und Doktrin keine Armee des 20. Jahrhunderts mehr der Wehrmacht ähnelte als die israelische. Ein Standardwerk zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist wieder lieferbar!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin van Creveld
KAMPFKRAFT
Militärische Organisation und Leistung der deutschen und amerikanischen Armee 1939–1945
6. Auflage
Umschlaggestaltung: DSR – Digitalstudio Rypka, Dobl / Markus Österreicher
© Titel und Rechte an der amerikanischen Originalausgabe und des englischen Originaltextes: Martin van Creveld, Fighting Power. German and U.S. Army Performance, 1939–1945, Greenwood Press, Westport, Connecticut, USA 1982 (Contributions in Military History, Number 32)
Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
Aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Tilla Stumpf (Hauptteil) und Nils Wegner (Vorwort 2020)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Ares Verlag GmbH
Hofgasse 5/Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.ares-verlag.com
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem, unter den Richtlinien von ISO 9001 hergestelltem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
ISBN 978-3-99081-068-2
eISBN 978-3-99081-126-9
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright der deutschen Ausgabe by Ares Verlag, 6. Auflage Graz 2020
Layout: Ecotext Verlag, Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein, A-1010 WienDruck und Bindung: Livonia Print Ltd., Lettland
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur deutschen Ausgabe 2020
Vorwort zur deutschen Ausgabe 2005
Vorwort des Autors zur deutschen Erstausgabe
1. Das Problem
2. Die Rolle des Nationalcharakters
3. Militär und Gesellschaft
Der soziale Status des Militärs
Das deutsche Heer – Die US-Army
Die Sozialstruktur des Heeres
Das deutsche Heer – Die US-Army
Eine Leiter für soziale Mobilität?
Das deutsche Heer – Die US-Army
4. Kriegslehre und Kriegsbild
Das deutsche Heer – Die US-Army
5. Führungsprinzipien
Das deutsche Heer – Die US-Army
6. Heeresorganisation
Allgemeine Grundsätze
Das deutsche Heer – Die US-Army
Die Struktur der Stäbe und Kommandobehörden
Das deutsche Heer – Die US-Army
Die Gliederung der Divisionen
Das deutsche Heer – Die US-Army
Divisionsanteile
Das deutsche Heer – Die US-Army
7. Heerespersonalwesen
Allgemeine Grundsätze
Das deutsche Heer – Die US-Army
Einteilung und Zuweisung des Personals
Das deutsche Heer – Die US-Army
Ausbildung
Das deutsche Heer – Die US-Army
Personalersatz
Das deutsche Heer – Die US-Army
8. Die Erhaltung der Kampfkraft
Truppenindoktrination
Das deutsche Heer – Die US-Army
Truppenaustausch
Das deutsche Heer – Die US-Army
Psychiatrische Fälle
Das deutsche Heer – Die US-Army
Das Sanitätswesen
Das deutsche Heer – Die US-Army
9. Belohnung und Bestrafung
Besoldung
Das deutsche Heer – Die US-Army
Urlaub
Das deutsche Heer – Die US-Army
Auszeichnungen
Das deutsche Heer – Die US-Army
Militärgerichtsbarkeit
Das deutsche Heer – Die US-Army
Beschwerden von Soldaten
Das deutsche Heer – Die US-Army
10. Die Unteroffiziere
Das deutsche Heer
Auswahl und Ausbildung
Dienstverhältnisse
Stellung und Leistung
Die US-Army
11. Führung und Offizierkorps
Image und Position
Das deutsche Heer – Die US-Army
Auswahl der Offiziere
Das deutsche Heer – Die US-Army
Ausbildung
Das deutsche Heer – Die US-Army
Beförderung
Das deutsche Heer – Die US-Army
Exkurs: Das Generalstabssystem
Das deutsche Heer – Die US-Army
Anzahl und Verteilung der Offiziere
Das deutsche Heer – Die US-Army
Verluste
Das deutsche Heer – Die US-Army
12. Schlußfolgerungen
Betrachtungen über das deutsche Heer
Betrachtungen über die US-Army
Betrachtungen über das Wesen der militärischen Organisation
Betrachtungen über die Auswirkungen der Technologie
Betrachtungen über die Kampfkraft
Anmerkungen zur Methode
Anmerkung
Quellen und Literatur
I. Quellen
1. Archivmaterial
2. Ungedruckte Quellen
II. Literatur
Vorwort zur deutschen Ausgabe 2020
Dieses Buch wurde in den Jahren 1979/80 geschrieben. Ich erinnere mich noch gut an die Wochen und Monate, die ich damals als junger und unbekannter Forscher in Freiburg im Breisgau verbrachte, vor allem im Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) und im Bundesarchiv-Militärarchiv (BArch-MA). Durch die Fenster des letzteren konnte ich französische Soldaten beim Exerzieren beobachten. Zu jener Zeit glaubte man allgemein noch daran, daß der nächste Krieg ganz ähnlich wie der Zweite Weltkrieg ablaufen werde. Das heißt, als ein gigantischer Kampf zwischen zwei gigantischen bewaffneten Mächten, oder besser: zwischen zwei gigantischen Bündnissen bewaffneter Mächte. Jedes davon mit weit über einer Million sofort kampfbereiter Soldaten. Jedes davon mit Boden-, Luft- und Seestreitkräften. Jedes davon ausgerüstet mit den mächtigsten modernen Waffen, von Panzern über Flugzeugträger und Unterseeboote bis hin zu Jagdflugzeugen und Bombern und Raketen aller Arten und Größen. Das eine Bündnis, mit der Farbe Rot versehen und als sehr, sehr böse bekannt, würde von Osten her angreifen. Das andere Bündnis, mit der Farbe Blau versehen und als sehr, sehr lieblich und herzensgut bekannt, würde sich bemühen, im Westen abzuwehren. Sie würden hierhin oder dorthin manövrieren, hier und da eine Schlacht schlagen, vorstoßen oder sich zurückziehen, Siege erringen und Niederlagen erleiden. Wenn sich der Staub gelegt haben würde, dann wäre der Preis für den Sieger kein geringerer als Deutschland – vorausgesetzt, es bliebe überhaupt etwas davon übrig.
Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Statt dessen begann die groß angelegte konventionelle Kriegführung, in sich zusammenzuschrumpfen und zu verschwinden, wie ich in meinem erstmals 1991 erschienenen Buch The Transformation of War vorhergesagt hatte. Tatsächlich hatte dieser Schrumpfungsprozeß schon eine ganze Weile früher begonnen; die meisten Menschen wollten es bloß nicht wahrhaben. Der bei weitem wichtigste, eigentlich beinahe der einzige Grund für diese Wandlung waren die drohenden Atomwaffen, von denen zur damaligen Zeit die USA angeblich über 30.000 und die Sowjetunion angeblich über 20.000 verfügen sollten. Mehr als genug, um die ganze Welt viele Male in die Luft zu jagen. Im Schatten einer solchen Bedrohung wirkte jede Art konventioneller Kriegführung mehr und mehr unbedeutend, ja sogar albern.
Ich will damit nicht sagen, daß der Krieg an sich begonnen hätte, zu verschwinden, oder daß er jemals verschwinden wird. Was ich meine, ist, daß er sich verändert hat und sich auch weiterhin verändern wird. Von groß hin zu klein. Von zwischenstaatlich hin zu innerstaatlich. Vom Krieg auf Grundlage einer Arbeitsteilung zwischen einer herrschenden Regierung, einer kämpfenden und sterbenden Streitmacht und einer zahlenden und leidenden Zivilbevölkerung hin zu einer Art von Krieg, in dem alle drei Elemente fast ununterscheidbar miteinander vermischt sind. Von hoher Intensität hin zu niedriger Intensität. Die Gestalt des Krieges verändert sich, doch seine grundlegenden Prinzipien bleiben die gleichen und sind es schon immer gewesen.
Das vorliegende Buch wurde nicht in der Absicht verfaßt, die grundlegenden Prinzipien des Krieges zu ergründen. Die können Sie in meinem Werk More on War von 2017 nachlesen. Kampfkraft unternimmt vielmehr den Versuch, anhand eines Vergleiches zwischen Wehrmacht und US-Armee 1941–1945 die Grundsätze der effektiven Verwaltung und Führung militärischer Stärke in Kriegszeiten herauszuarbeiten, einschließlich der Bereiche „Militär und Gesellschaft“, „Kriegslehre und Kriegsbild“, „Führungsprinzipien“, „Heeresorganisation“ und etlicher anderer. Die zugrunde liegende Annahme ist, daß sich weder das Wesen des Mannes – bitte verzeihen Sie die Nichtbeachtung, meine Damen! – noch das Wesen des Krieges ändert. Daraus folgt, daß die besagten Grundsätze heute genauso bedeutsam sind, wie sie immer schon waren.
Zuletzt noch etwas Persönliches. Seit 1976 haben meine Frau und ich viele, viele Male Deutschland und Österreich besucht. Wir haben auch in diesen Ländern gelebt, und zwar nicht nur in einer einzigen Stadt, sondern in zahlreichen. So gut wie überall, wohin wir kamen, wurden wir herzlich empfangen und/oder haben Freunde gewonnen. Ihnen allen möchte ich in meinem eigenen Namen und im Namen meiner Frau Dvora danken.
Martin van Creveld
Mewasseret Zion, Israel, im Juni 2020
Vorwort zur deutschen Ausgabe 2005
Als dieses Buch 1979/80 geschrieben wurde, befand sich der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt. Leonid Breschnew herrschte im Kreml und die Sowjetunion war auf dem Gipfel ihrer Macht. Und hatten nicht die sowjetischen Streitkräfte gerade die Landung kubanischer Truppen in Angola gedeckt, den Äthiopiern geholfen, die Somalis zu besiegen und Afghanistan überrannt? Währenddessen schienen auf der anderen Seite des Atlantiks die USA unter Präsident Jimmy Carter von einer Krise zur nächsten zu schwanken. Insbesondere hatte der Vietnamkrieg tiefe Spuren hinterlassen, die Amerikas Selbstbewußtsein unterminiert und die Fähigkeiten seiner Streitkräfte in Zweifel gezogen hatten.
Als das Pentagon nach Lösungen suchte, war eines der Dinge, die es tat, die Hinwendung zur Militärgeschichte. Wie jede Geschichte ist die Militärgeschichte ein ganz besonderes Tier. In guten Zeiten wird sie oft bestenfalls als Randthema behandelt; was haben einem schließlich Leute, die schon lange tot sind, zu sagen, das wir nicht schon längst wüßten? Andererseits hat sie, wenn die Zeiten schlecht sind, die Tendenz, aus ihrem Versteck in den Mittelpunkt zu treten und ihre Muskeln spielen zu lassen. Und gegen Ende der Regierungszeit Carters sahen die Dinge so schlecht aus.
Die Gruppierung, die die Antworten zu haben schien, war bekannt als die „Militärreformer“. Ihr wohl wichtigstes Mitglied war Steven Canby, Oberstleutnant der Reserve und in Harvard ausgebildeter Ökonom. Dann gab es Edward Luttwak, Politologe und Autor des Buches Coup d’État oder Wie man einen Staatsstreich inszeniert (dt.: 1969), das so gut war, daß man sagt, jeder Offizier eines Entwicklungslandes habe es gelesen; dann Oberst John Boyd, ein früherer Kampfpilot, der zum militärischen Denker wurde; Pierre Sprey, ein Flugzeugingenieur; Bill Lind, ein brillanter Einzelgänger und Störenfried, der einen großen Einfluß auf die Militärdoktrin der USA haben sollte – und ich selbst, der einzige Nicht-Amerikaner und einzige akademisch ausgebildete Historiker der Gruppe. Unsere Hauptunterstützer im Pentagon waren Andy Marshal, der intellektuelle Kopf des Office of Net Assessment, der direkt für den Verteidigungsminister arbeitete, und der Kommandant des Marine Corps, General Alfred (Al) Gray. Unsere Hauptverbindung im Kongreß war Senator Gary Hart, der später Präsidentschaftskandidat der Demokraten wurde, aber durch eine außereheliche Affäre mit einer schönen Frau auf einer Yacht, die angemessenerweise Monkey Business (Unfug) hieß, aus der Bahn geworfen wurde. Ein anderes Mitglied dieses militärischen Reformzirkels im Kongreß war ein junger Abgeordneter aus Wyoming namens Dick Cheney.
Es folgte eine außergewöhnlich produktive Zeit, die von etwa 1979 bis 1987 andauerte. Ich weiß nicht mehr, wie oft wir uns mit oder ohne Kaffee oder Bier getroffen haben. In unzähligen Diskussionen, Büchern, Artikeln und Briefen (es gab damals noch keine Computer, und selbst Faxgeräte waren Zukunftsmusik) versuchten wir herauszufinden, was mit dem US-Militär falschgelaufen war und wie man es ändern konnte. Während wir nach Anhaltspunkten suchten, überprüften wir militärgeschichtliche Ansichten. Alles war Wasser auf unsere Mühlen: amerikanische Militärgeschichte, auswärtige Militärgeschichte, Strategie, Ausbildung, Taktik, Führung, Personalwesen, Technologie und alles Mögliche.
In den späten 1980er Jahren begann der Zauber zu verblassen. Zum Teil war gerade unser Erfolg daran schuld. Ein paar Leute, bewaffnet mit Schreibmaschinen, hatten einen enormen Einfluß ausgeübt und ließen alle in der Armee und im Marine Corps über maneuver warfare reden, wenn sie es auch nicht immer verstanden. Später, als die US-Streitkräfte in den Golfkrieg zogen und ihn gewannen, brach das Interesse an der Militärgeschichte wieder zusammen. Ihren Platz nahmen alle möglichen Arten von Theorien aus Sozialwissenschaft und Betriebswirtschaft ein. Mit diesen Theorien ausgerüstet, gingen die Streitkräfte in den Zweiten Golfkrieg, mit den desaströsen Resultaten, die schon bald deutlich wurden. Ich für meinen Teil habe keinen Zweifel, daß die Militärgeschichte, wenn dieser Krieg schließlich beendet sein wird, erneut gefordert ist, in die Bresche zu springen; in der Tat sind erste Anzeichen dafür bereits sichtbar.
Aber das ist alles Schnee von gestern. Das Buch „Kampfkraft“, das hier der deutschsprachigen Öffentlichkeit in einer neuen Auflage präsentiert wird, ist ein Produkt seiner Zeit. Zwei weitere bedeutende Werke dieser Zeit waren William Linds Maneuver War Handbook (1985) und mein eigenes Buch Command in War (1985). Obwohl einiges an Forschung hierfür in Deutschland geleistet wurde, insbesondere am Militärgeschichtlichen Forschungsamt, das damals in Freiburg i. B. ansässig war, so war moderne deutsche Politik doch das letzte, woran ich gedacht hatte. Was ich im Sinn hatte, waren der Vietnamkrieg und die Schwäche der US-Armee sowie die Faktoren, die sie verursacht hatten, und die Möglichkeiten, wie diese geändert werden konnten. Mit einem vergleichenden Forschungsansatz wollte ich die alles überragende Frage beantworten: Was hat dazu geführt, daß die deutsche Wehrmacht so gut kämpfte, wie sie es getan hatte? 25 Jahre später glaube ich immer noch, daß diese Frage für einen Militärhistoriker nicht nur legitim, sondern auch wichtig ist. Und ich glaube immer noch, daß wenigstens einige der gegebenen Antworten richtig sind.
Da 25 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung auch die englische Originalversion dieses Buches, Fighting Power, nach wie vor verlegt wird, scheinen die meisten Leser mir darin offenbar zuzustimmen. Im deutschsprachigen Teil der Welt hassen das Buch einige, andere mögen es. Zu meinem Ärger habe ich bemerkt, daß einige Teile der letzteren Gruppe einen hohen Prozentsatz jener einschließen, die es als eine Entlastung der Wehrmacht bezüglich ihrer Verwicklung in Kriegsverbrechen, den Holocaust, usw. sehen. Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, diesen Leuten klar und deutlich zu sagen: Ich will weder mit ihrer Interpretation noch mit ihnen selbst etwas zu tun haben. Im Gegenteil scheint die Faktenlage mir zu zeigen, daß große militärische Leistungen und die Verwicklung in eines der schrecklichsten Verbrechen, die je begangen wurden, sich nicht notwendigerweise ausschließen. Dies ist allerdings ein erschreckender Gedanke und einer, dessen Bedeutung weit über die Wehrmacht und den Zweiten Weltkrieg allein hinausgeht.
Ich war und bleibe ein Wissenschaftler und Historiker, dessen Anliegen die historische Wahrheit ist. Für eine bestimmte Zeit überschnitten sich meine Interessen mit denen anderer Menschen als auch mit denen des Pentagons. Jedoch war mein Hauptinteresse, die Frage zu beantworten, die mir so wichtig erschien. Diese Frage bleibt trotzdem aus mehreren Gründen auch heute wichtig und wird solange wichtig bleiben, wie Männer gegen andere Männer in den Krieg ziehen. Ich hoffe, daß ich erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe. Sollte das der Fall sein, habe ich den von mir gewünschten Zweck erreicht.
Martin van Creveld
im September 2005
Vorwort des Autors zur deutschen Erstausgabe
Das Buch, das hier dem deutschen Leser vorgelegt wird, entstand 1979–1980 als technische Fachstudie zur Verwendung im amerikanischen Verteidigungsministerium. In jenen letzten Jahren der Präsidentschaft Carters befanden sich die amerikanischen Streitkräfte, vor allem aber das Heer, in einem schlechten Zustand. Die niedrige Besoldung und der ungünstige Ruf, in dem das Militär nach Vietnam stand, führten zu Rekrutierungsproblemen, denn die Streitkräfte waren nicht einmal mehr für einen Querschnitt der amerikanischen Gesellschaft attraktiv, von den besten Elementen ganz abgesehen. Die Folge davon war, daß die Qualität des verfügbaren Personals, das ausschließlich aus Freiwilligen bestand, abnahm und weithin für ungenügend gehalten wurde. Dieser Faktor wirkte sich wiederum sowohl als Ursache wie auch als Ergebnis eines entstehenden Personalproblems aus, da sich viele der erfahreneren und besser qualifizierten Offiziere und Angehörige der anderen Dienstgrade weigerten, ihre Verträge zu verlängern und aus der Armee ausschieden, um einer einträglicheren zivilen Beschäftigung nachzugehen. Schließlich war die Moral, jener schwer faßbare, aber überaus wichtige Bestandteil jeder Streitkraft, die diesen Namen verdient, auf einem Tiefpunkt angelangt, und diese Tatsache stand in der Vorstellung mancher Leute in engem Zusammenhang mit dem Fehlschlag der Befreiungsaktion für das amerikanische Botschaftspersonal, das in iranischer Geiselhaft gehalten wurde. Man kann die Situation in einem Wort zusammenfassen: Krise. Vor diesem Hintergrund und als Teil ausgedehnter Bemühungen um die Einführung von Reformen entstand die vorliegende Studie. Mit Hilfe der Militärgeschichte und besonders eines detaillierten Vergleichs zwischen den amerikanischen und deutschen Streitkräften im Zweiten Weltkrieg wurde eine Antwort auf die Frage gesucht: Wie sollte eine moderne gefechtstaugliche Streitkraft aufgebaut sein, und wie kann ihre Kampfkraft im Krieg aufrechterhalten werden?
Wie aus der Frage hervorgeht, war der gewählte Standpunkt begrenzt. Gegenstand der Untersuchung war nicht die Ideologie der Wehrmacht (außer in dem Maß, wie ihre militärische Leistung davon beeinflußt wurde), auch nicht ihr Verhältnis zur deutschen Gesellschaft oder ihre Verwicklung in die Verbrechen, die vom nationalsozialistischen Regime begangen wurden, sondern allein ihre Kampfkraft, die nach dem Urteil von Laien und Fachleuten gleichermaßen außergewöhnlich hoch bewertet wurde. Anders ausgedrückt: Die Probleme, die sich aus der Tatsache ergeben, daß die Wehrmacht nicht irgendeine Armee war, sondern die des nationalsozialistischen Regimes und seiner Gesellschaft (ganz zu schweigen davon, daß sie den Krieg verlor), wurden soweit wie möglich bewußt beiseite gelassen. Diese isolierte Betrachtungsweise war zwar künstlich, aber notwendig. Sie war eine Vorbedingung für die Offenlegung der Faktoren, die hinter der Kampfkraft der Wehrmacht standen, und, was sogar noch weit wichtiger war, für die Übertragung einiger dieser Faktoren in die völlig unterschiedliche amerikanische Umgebung.
Dem Leser sei das Urteil darüber überlassen, ob der Versuch, die außerordentlich hohe Kampfkraft der Wehrmacht zu verstehen und zu erklären, erfolgreich verlaufen ist. Doch lege ich Wert auf die folgende Feststellung: Nichts in dieser Studie sollte als Freispruch der Wehrmacht von ihrer Mitverantwortung für die Geschehnisse von 1933 bis 1945 verstanden werden. Im Gegenteil, gerade die herausragende Organisation der Wehrmacht (auf jeden Fall in den unteren Ebenen), das durch und durch professionelle Offizierkorps und Stärke und Geschlossenheit ihrer Gesinnung ermöglichten, daß sie als Instrument bei der Durchführung einer rücksichtslosen Aggressionspolitik, die von vielen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begleitet war, gebraucht und mißbraucht werden konnte. Eine große Mehrheit der Offiziere und Mannschaften, die ihre Qualität bei Angriff und Verteidigung auf jedem Kriegsschauplatz und überall, wo der Krieg ausgetragen wurde, bewiesen, war auch dazu bereit, den schrecklichsten Befehlen zu gehorchen und sie auszuführen. Obwohl die Wehrmacht selbst den Angriffskrieg nicht begann, obwohl sie nicht primär für die Konzentrationslager und die Ausrottung der Juden verantwortlich war, wären diese und andere Verbrechen ohne ihre aktive oder passive Wirkung unmöglich gewesen. Auch wenn man zu dem Eingeständnis bereit ist, daß die Wehrmacht ausschließlich ein militärisches Instrument war, bleibt doch eine schwere Schuld, von der sie nicht freigesprochen werden kann und von der die meisten heutigen Deutschen, so hoffe ich, sich auch nicht freizusprechen versuchen.
Daher verfolgt die deutsche Ausgabe dieses Buches ein Ziel, das in gewissem Sinn dem ursprünglichen genau entgegengesetzt ist. Vor neun Jahren bestand meine Absicht darin, den Amerikanern Methoden vorzuschlagen, die der qualitativen Verbesserung ihrer Streitkräfte dienen sollten. Diese Studie fand im Pentagon eine positive Aufnahme und leistete einen bescheidenen Beitrag zur Einführung des sogenannten „Kohortensystems“ (eine Methode der Personalverwaltung, bei der die Mannschaften nach der Grundausbildung nicht verteilt werden, sondern langfristig in ihren Einheiten und unter denselben Offizieren zusammenbleiben). Insoweit war diese Studie erfolgreich. Nun aber lese ich das Buch eher von einem anderen Standpunkt aus. Es untersucht die Art und Weise, wie man eine vorzügliche Organisation dazu bringen kann, jedweden Zielen zu dienen, wie furchtbar sie auch sein mögen; gleichzeitig sollte es auch als Warnung gegen die Macht der menschlichen Organisation an sich verstanden werden. Und diese Warnung bezieht sich auch nicht auf Deutschland allein, denn fast ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges besteht in der heutigen Welt kein Mangel an Organisationen zur Planung und Ausführung furchtbarer Dinge. Gegen sie, fast noch mehr als gegen die Wehrmacht an sich, richtet sich dieses Buch in Wirklichkeit.
Martin van Creveld
Jerusalem 1988
1. Das Problem
Im Verlauf der gesamten Geschichte sind manche Armeen besser als andere gewesen: die Römer zur Zeit Caesars, die Mongolen zur Zeit Dschingis Khans, die Franzosen zur Zeit Napoleons – sie alle sind Beispiele überlegener Kampforganisation. Obwohl militärische Leistung ohne Sieg unvorstellbar ist, ist doch der Sieg keinesfalls das einzige Kriterium der militärischen Leistung. Eine kleine Armee kann von einer größeren überwunden werden. Angesichts unglaublicher politischer und wirtschaftlicher Nachteile können qualitativ überlegene Streitkräfte ohne eigenes Verschulden vor einer Niederlage stehen. Bei dem Versuch, militärische oder andere Leistungen zu bewerten, darf deshalb nicht nur das Ergebnis zählen, sondern es müssen auch innere Werte herangezogen werden, andernfalls kann nicht einmal der Begriff der Qualität aufrechterhalten werden. Innerhalb der durch ihre Größe gesetzten Grenzen entspricht der Wert einer Armee als militärisches Instrument der Qualität und Quantität ihrer Ausrüstung, multipliziert mit ihrer „Kampfkraft“* wie dieser Faktor in der vorliegenden Studie genannt wird. Sie beruht auf geistigen, intellektuellen und organisatorischen Grundlagen und findet ihren Ausdruck in Disziplin und Zusammenhalt, Kampfmoral und Initiative, Mut und Härte, im Willen zum Kampf und der Bereitschaft, notfalls zu sterben. Die „Kampfkraft“ läßt sich, kurz gesagt, als die Summe der geistigen Qualitäten definieren, die Armeen zum Kämpfen bringen.
Während sich Waffen und Methoden der Kriegführung ändern, ist dies beim Wesen der Kampfkraft nicht der Fall; auch wenn sich der relative Anteil der oben angeführten Einzelwerte von Zeit zu Zeit verschiebt, sind die Werte selbst doch heute größtenteils dieselben wie für Caesars Veteranen vor 2000 Jahren.1 Obwohl gute Ausrüstung bis zu einem gewissen Grad fehlende Kampfkraft ausgleichen kann (was auch umgekehrt gilt), so ist doch eine Armee ohne Kampfkraft bestenfalls ein zerbrechliches Instrument. Die Geschichte bis in die neueste Zeit bietet eine Fülle von Beispielen für Armeen, die – wenn auch scheinbar stark und gut ausgerüstet – allein aufgrund der fehlenden Kampfkraft beim ersten Gefechtsschock Auflösungserscheinungen zeigten.
Worin liegt das Geheimnis der Kampfkraft? Seit Xenophon haben Schriftsteller versucht, diese Frage unter anderem durch den Hinweis auf den Nationalcharakter, auf das Verhältnis zwischen Armee und Gesellschaft, auf den starken Einfluß religiöser und ideologischer Überzeugungen oder auf den Primärgruppenzusammenhalt zu beantworten. Es ist in der Tat leicht, das Bild einer idealen Armee heraufzubeschwören: Sie müßte aus Männern bestehen, die geborene Kämpfer sind, von ihrer Gesellschaft hoch geachtet, gut ausgebildet und diszipliniert sowie gut geführt. Wesentlich schwieriger ist es jedoch, eine Organisation zu beschreiben, die diese Eigenschaften pflegt und bewahrt. Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch, dies am Beispiel einer historischen Organisation zu tun, die in fast schon erschreckender Weise Kampfkraft entwickelte: des deutschen Heeres im Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte, so sagt man, besteht aus Reputationen; und wenn der Ruf einer Armee ein Maßstab für ihre Qualität ist, so ist das deutsche Heer mit Sicherheit unübertroffen.2 Die meisten Historiker nehmen seine Überlegenheit en passant zur Kenntnis, aber einige haben doch versucht, ihre Ursprünge zu erklären.3 Manche haben sie auch dazu benutzt, sonst unverständliche Tatsachen zu erklären, wie zum Beispiel, daß „Ultra“ nicht die große Wirkung auf den Zweiten Weltkrieg hatte, die zu erwarten gewesen wäre.4 Der hohe Gefechtswert des deutschen Heeres hat dazu geführt, daß man es als Maßstab benutzte, an dem andere, weniger erfolgreiche Armeen gemessen werden können.5 Und schließlich hat zumindest ein Historiker ein ganzes Buch in der ausdrücklichen Absicht geschrieben, zu beweisen, daß die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg nicht besser war als andere Armeen, nur um zu dem Schluß zu kommen, „daß sie [die Wehrmacht] sich in den ersten Jahren des Sieges als so sensationell erfolgreich und in den Jahren der Niederlage als so zäh in der Verteidigung erweisen sollte, daß ihr ein hoher Rang in der Geschichte der Kriegsführung sicher ist“.6 Wenn man den Sieg als Maßstab für militärische Qualität nimmt, dann hatte die Wehrmacht sicherlich einen hohen Anteil davon aufzuweisen. Ihre Feldzüge in Frankreich 1940, in Rußland 1941 und Nordafrika 1941 und 1942 gelten immer noch als Meisterstücke der Kriegskunst und sind fast schon legendär. Ihre Feldzüge in Norwegen 1940 und Kreta 1941 sind Beispiele für Triumphe im kleineren Maßstab, die durch haarsträubende Kühnheit errungen wurden. In der Auseinandersetzung mit Gegnern, die schwächer waren als sie selbst, bewies die Wehrmacht eine beispiellose Selbstsicherheit und Entschlossenheit.
Bei den wichtigsten dieser Siege sollte man bedenken, daß die Deutschen sie – weit entfernt von materieller Überlegenheit – angesichts beträchtlicher zahlenmäßiger Unterlegenheit und häufig genug unzureichender logistischer Vorbereitungen errangen.7 Wie schon viele Autoren gezeigt haben, war die Wehrmacht 1939 nicht auf einen Konflikt vorbereitet; er hätte nach Hitlers Zeitplan erst vier Jahre später ausbrechen sollen. Teils aus Zeitdruck und teils gemäß einer bewußten Entscheidung der nationalsozialistischen Führung hatte keine tiefgreifende Aufrüstung stattgefunden; so war ein großer Teil der Ausrüstung der Wehrmacht veraltet und 80 Prozent ihrer Einheiten blieben auf Pferdebespannung angewiesen. Selbst bei den berühmten Panzerdivisionen, um nur ein Beispiel zu nennen, waren zwei Drittel der Panzer ausschließlich zu Trainingszwecken entwickelt worden. Den Nachteil, einen „Arme-Leute-Krieg“ führen zu müssen, glich die Wehrmacht durch die Entwicklung eines hohen Maßes an Kampfkraft aus, die sie dazu befähigte, Frankreich trotz zahlenmäßiger und materieller Unterlegenheit innerhalb von sechs Wochen zu besiegen, im Gegensatz zu den vier Monaten, die die erdrückend überlegenen alliierten Kräfte benötigten, um sie wieder zu vertreiben. In Rußland brauchte eine stark unterlegene Wehrmacht nur fünf Monate, um die Tore Moskaus zu erreichen; um sie auf ihre Ausgangslinie zurückzuwerfen, brauchte der bis dahin grenzenlos überlegene Gegner volle zweieinhalb Jahre. Der Ruf der Kampfkraft der deutschen Wehrmacht beruht jedoch in der Hauptsache nicht auf ihren Siegen, so glänzend sie auch waren. Hier wird nämlich der Historiker mit einer Armee konfrontiert, deren zahlenmäßige Unterlegenheit in einem Verhältnis von eins zu drei, zu fünf, ja sogar zu sieben stand, je nachdem, welche Front oder Waffengattung man betrachtet. Und doch lief sie nicht davon, und sie löste sich nicht auf oder ermordete ihre Offiziere. Stattdessen kämpfte sie verbissen weiter. Sie kämpfte weiter, obwohl Hitlers Krieg zu keiner Zeit in Deutschland wirklich populär war.8 Sie kämpfte weiter, auch wenn in ihrem Rücken die Heimat in Trümmer gebombt wurde. Sie kämpfte weiter, obwohl viele ihrer Generale – und später auch zahllose Historiker – ihren Obersten Befehlshaber nur als rasenden Geisteskranken betrachteten.9 Sie kämpfte bei Narvik und El Alamein. Sie kämpfte noch Jahre, nachdem alle Hoffnung auf einen Sieg vergangen war. Selbst im April 1945, so eine nachrichtendienstliche Übersicht der Alliierten10, kämpften ihre Truppenteile weiter, wo immer die örtliche taktische Lage überhaupt noch erträglich war. Zu dieser Zeit hatte sie schon 2.000.000 Soldaten durch den Tod und mehr als 1.000.000 durch Gefangenschaft verloren, Soldaten, die für immer in sowjetischen Gefangenenlagern verschwinden sollten.11 Trotzdem bestanden ihre Einheiten, auch wenn sie nur noch 20 Mann aufwiesen, weiter und leisteten Widerstand, eine unvergleichliche Leistung für jede Armee.12 Auf der Suche nach einem endgültigen Kriterium der Leistung hat Trevor N. Dupuy, Oberst a. D. der US-Army, zwei verschiedene Versuche unternommen, die Kampfkraft der Wehrmacht mit quantitativen Mitteln zu bestimmen. Beim ersten Versuch wird ein mathematisches Modell der Schlacht konstruiert, das bedeutet eine Reihe ziemlich komplizierter Gleichungen, die solche Faktoren berücksichtigen wie die Zahlen auf beiden Seiten, ihre Waffen, das Terrain, die Gefechtsart und die Wirkung der Luftstreitkräfte, wo sie eingesetzt waren. Setzt man in die Formeln Daten aus 78 Gefechten des Zweiten Weltkriegs ein, so ergab sich, daß das tatsächliche Ergebnis (d. h. Sieg oder Niederlage, die jeweils einen mathematischen Wert erhielten) nur dann vorausgesagt werden konnte, wenn man von der Annahme ausging, daß die Deutschen – Mann für Mann und Einheit für Einheit – um 20 bis 30 Prozent effektiver waren als die britischen und amerikanischen Kräfte, die ihnen gegenüberstanden. Anders gesagt: Auch wenn man im Modell alle materiellen Faktoren berücksichtigt, die den Ausgang eines Gefechts beeinflussen, klafft zwischen den deutschen und den alliierten Einheiten eine Lücke, die man erklären muß.13 Die zweite und viel einfachere Art, die deutsche Leistung an der anderer Streitkräfte zu messen, besteht darin, die Verlustziffern auf beiden Seiten Mann für Mann zu vergleichen. Zu diesem Zweck ist es zunächst einmal notwendig, die Anzahl der Soldaten zu bestimmen, die auf beiden Seiten gekämpft haben. Zweitens muß die Zahl der Verluste – hier definiert als Gefallene, Verwundete und Vermißte, aber abzüglich derjenigen, die nach dem Gefecht in Gefangenschaft gerieten – aus den Kriegstagebüchern und Verlustlisten beider Seiten verglichen werden. Drittens wird die „Trefferquote“ berechnet, d. h. die Durchschnittszahl der Verluste, die sich je 100 Feinde gegenseitig zufügen. Schließlich ergibt sich die „Trefferwirksamkeit“ daraus, daß man die „Treffer“ durch eine Konstante dividiert, die für unterschiedliche Gefechtsarten je andere Werte aufweist, z. B. 1 für Angriff, 1,6 für Verteidigung aus einer befestigten Stellung heraus.14 Dupuys Zahlen können auf verschiedene Weise analysiert werden. Dabei muß betont werden, daß die deutsche Überlegenheit nicht auf die mangelnde Erfahrung der Alliierten zurückzuführen ist. Wir begnügen uns damit, Dupuys Zusammenfassung zu zitieren: „[Die] Tabelle zeigt, daß die Deutschen durchweg die zahlenmäßig weit überlegenen alliierten Armeen, denen sie schließlich unterlagen, übertrafen […]. Rechnet man die einzelnen Soldaten gegeneinander auf, so fügten die deutschen Bodentruppen den ihnen gegenüberstehenden britischen und amerikanischen Truppen unter allen Gefechtsbedingungen ständig Verluste zu, die um etwa 50 % höher lagen als ihre eigenen. Dies traf zu, ob sie im Angriff oder in der Verteidigung waren, ob sie nun örtlich zahlenmäßig überlegen, oder, was die Regel war, unterlegen waren, ob sie die Luftüberlegenheit hatten oder nicht, ob sie gewonnen oder verloren hatten.“15 Die Tatsache, daß Hitler und sein Oberkommando zahllose strategische Fehler machten, von Dünkirchen über Stalingrad bis zur Ardennenschlacht, beeinträchtigt diese Schlußfolgerung nicht. Vielleicht trifft tatsächlich das Gegenteil zu, denn einer der erstaunlichsten Aspekte ist, daß die Wehrmacht in Sieg und Niederlage, vor den Toren von Tobruk und in der Todesfalle von Tunesien, gleich gut kämpfte. Das Geheimnis dieser beständig hohen Leistung, nicht die Höhen und Tiefen in Hitlers militärischem „Genius“, ist das Thema der vorliegenden Studie.
Um das Geheimnis der deutschen Leistung herauszuarbeiten, brauchte man einen Hintergrund, vor dem man sie darstellen konnte. Dafür wurde die US-Army des Zweiten Weltkrieges ausgewählt, und zwar nicht deshalb, weil zwischen beiden ein großer Unterschied gesehen wurde – sie hatte, wie andere Armeen in der ganzen Welt, große Teile ihrer Organisation, insbesondere das Generalstabssystem von dem deutschen Modell übernommen –, sondern einfach deshalb, weil über sie mehr gedruckte Informationen verfügbar waren als über jede andere vergleichbare Armee. Diese Wahl erwies sich später insofern als ausgezeichnet, als die US-Army, gestützt auf riesige wirtschaftliche und technologische Ressourcen, einen völlig anderen Stil der Kriegführung entwickelte. Das Urteil darüber, ob es der vorliegenden Studie gelungen ist, das Geheimnis um die Kampfkraft der deutschen Wehrmacht zu lüften, bleibt allerdings dem Leser überlassen.
Anmerkungen
*AdÜ: In der entsprechenden Vorschrift der Wehrmacht: „Gefechtswert“. H.Dv. 300, Truppenführung (T. F.), Teil 1 und 2, Berlin 1936 und 1934.
1Hier ist nicht der Ort für eine Erörterung der im Lauf der Zeit wechselnden Anforderungen an die Soldaten. Das müßte in einem eigenen Buch geschehen. Jedenfalls könnte man Kampfkraft sehr wohl als den Teil der geistigen Veranlagung eines Soldaten definieren, der sich im Laufe der Zeit nicht ändert.
2Bei einer Meinungsumfrage über die militärische Leistungsfähigkeit der Roten Armee, der US-Army, der Bundeswehr und der Wehrmacht stuften 74,0 Prozent der befragten Bundesdeutschen die Wehrmacht an der ersten Stelle der Liste ein. Dazu Weltz, Wie steht es um die Bundeswehr?, S. 31.
3Madej, Effectiveness and Cohesion of the German Ground Forces in World War II, in: Journal of Political and Military Sociology, 6 (1978), H. 2, S. 233–248.
4Lewin, Entschied Ultra den Krieg? Alliierte Funkaufklärung im 2. Weltkrieg, S. 22 f. und 343 f.
5Gabriel/Savage, Crisis in Command, bes. Kap. 1 und 3.
6Cooper, The German Army 1933–1945, Kap. 12 und S. 166.
7S. van Creveld, Supplying War, Kap. 5 und 6.
8Messerschmidt, Wehrmacht, S. 480 f; Steinen, Hitlers Krieg und die Deutschen, S. 588 ff. Daß Hitler sich dieser Tatsache bewußt war, wird dargestellt bei Haffner, Anmerkungen zu Hitler, S. 56 f.
9Ich habe meine Ansicht zu dieser Frage dargelegt in: Warlord Hitler. Some Points Reconsidered. Ob Hitler wirklich ein militärischer Dilettant war, ist umstritten; sicher ist dagegen, daß sich die Streitigkeiten zwischen ihm und seinen Generalen negativ auf die deutschen Kriegsanstrengungen auswirkten.
10SHAEF (Supreme Headquarters, Allied European Forces), Weekly Intelligence Summary for Psychological Warfare, No. 28, 9. April 1945, file 332/52/268, National Archives (NA) Washington D.C.
11Zahlen bei Müller-Hillebrand, Heer, Bd 3, S. 261 ff.
12Barnett, The Education of Military Elites, S. 15–35, bes. S. 26.
13Dupuy, Numbers, Predictons and War, passim.
14Weitere Einzelheiten in der amerikanischen Ausgabe dieses Buches, S. 6 f. mit Tabelle 1.1.
15Dupuy, A Genius for War, S. 234 f. Warum sich bei der zweiten Methode ein größeres Differential ergibt als bei der ersten, war Gegenstand einer Korrespondenz zwischen Oberst Dupuy und mir. Die Erklärung dafür liegt vielleicht bei zwei Faktoren:
a) Die zweite Methode berücksichtigt nicht die qualitative Überlegenheit vieler deutscher Heereswaffen, wie z. B. den Panzer Panther, die 88 mm Panzerabwehrkanone, die Maschinenpistolen MG 38 und 40 und das Maschinengewehr MG 42 (das noch immer verwendet wird, weil es eine so ausgezeichnete Waffe ist).
b) Die Einsatzeffektivität, die durch die erste Methode errechnet wird, berücksichtigt im Gegensatz zu der Treffsicherheit, die durch die zweite errechnet wird, das Ergebnis. Das hat Oberst Dupuy zu dem Schluß geführt: „Die Fähigkeit der Streitkräfte, Verluste zuzufügen, steht im quadratischen Verhältnis zu dem ihrer relativen Einsatzeffektivität.“ (Brief an M. van Creveld, 15. Mai 1981). Insgesamt ist die Einsatzeffektivität wahr scheinlich ein besserer Maßstab für die Kampfkraft einer Truppe, wie sie in diesem Kapitel definiert wird, als die Trefferwirksamkeit.
2. Die Rolle des Nationalcharakters
Schon ein flüchtiger Blick auf die Geschichte enthüllt, daß es immer Gesellschaften gegeben hat, die „kriegerischer waren als andere“. Allerdings haben Versuche, diese Eigenschaft zu anderen Faktoren (wie z. B. Geographie, Klima, Gesellschaftsleben und sexuelle Unterdrückung) in Beziehung zu setzen, bisher nicht zu greifbaren Erfolgen geführt.1 Das Problem wird dadurch kompliziert, daß jede nationale Gruppe notwendigerweise Männer vieler verschiedener Typen umfaßt und die Kriegsführung viele unterschiedliche und manchmal gegensätzliche Eigenschaften erfordert. Darüber hinaus kann es irreführend sein, moderne Truppen in demselben Sinn als „kriegerisch“ zu bezeichnen, wie der Begriff auf primitivere Gesellschaften angewandt wird, da in der modernen Kriegführung der Verstand genauso wichtig ist wie die Muskelkraft. Eine beträchtliche Anzahl von nicht allzu empfindlichen Draufgängern in der Truppe mag zwar noch immer wesentlich sein, aber das reicht nicht mehr aus. Ein weiterer erschwerender Faktor ergibt sich durch die Tatsache, daß sich die kämpferischen Eigenschaften eines Volkes ändern können, gelegentlich sogar mit beachtlicher Geschwindigkeit. Die Deutschen, Gegenstand dieser Untersuchung, galten bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts nicht als besonders gute Soldaten, und dann erschienen sie plötzlich als die gewaltigste Militärnation der Welt. Die Vietnamesen, vor 1939 von ihren französischen Beherrschern als mehr oder weniger nutzlos angesehen, besiegten eben diese Beherrscher im Jahr 1954 entscheidend, um sich dann sofort in zwei Hälften zu spalten, deren eine in der Tat nutzlos war, während die andere zwei Jahrzehnte lang großartig weiterkämpfte. Die arabische Niederlage von 1967 hatte ein Wesen ins Leben gerufen – bekannt als „amoralischer Familist“ – dessen soziale Natur es angeblich unfähig machte, mit anderen zusammenzuarbeiten: und obwohl die amoralischen Familisten bis 1973 wahrscheinlich nicht ausgestorben waren, kämpften die arabischen Armeen zweifellos.2
Wenn man diese methodischen Schwierigkeiten voraussetzt, überrascht es vielleicht nicht, daß wissenschaftliches, d. h. statistisches Material über den „kriegerischen“ Charakter dieser oder jener Gesellschaft außerordentlich schwer erhältlich ist. Deshalb erheben die folgenden Seiten auch nicht den Anspruch, das Problem abschließend zu behandeln.
Tabelle 2.1: Kriege in der deutschen und amerikanischen Geschichte
Neubearbeitung der Tabelle 2.1 der amerikanischen Ausgabe dieses Bandes, die auf der Basis von Wright, A Study of War, S. 644 f., berechnet wurde.
Wenn die Neigung, Krieg zu führen, ein Indiz für den Gefechtswert eines Volkes ist, dann gäbe es den Daten von Quincy Wright zufolge kaum einen Unterschied zwischen Preußen/Deutschland einerseits und den Vereinigten Staaten andererseits. Bei der Betrachtung von Tabelle 2.1 sollte man jedoch keinesfalls übersehen, daß Deutschland im Zentrum Europas liegt, und die Lage der Vereinigten Staaten so isoliert ist, daß sie faktisch die einzige Macht in der gesamten Hemisphäre darstellen.
Wären die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch berücksichtigt worden, hätten sich die Zahlen für die Vereinigten Staaten auf 13 Kriege und 37,9 Jahre erhöht. Im Vergleich erweisen sich also die Deutschen nicht als „kriegslüsterner“ als die Amerikaner. Direkte Vergleiche zwischen Deutschen und Amerikanern gehören meist zu der Art von Untersuchungen, die unter dem Begriff „Jagt die Nazis“ („hunt the Nazi“) in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr bekannt waren und für unseren Zweck nicht viel beitragen. Eine Serie von Umfragen unter Jugendlichen beider Länder fand heraus, daß die Deutschen den Gehorsam gegenüber einer Autorität deutlich befürworten, während die Amerikaner zu unabhängigen Entscheidungen und Handlungen neigen;3 allerdings hat eine andere Studie dieses Klischee, das mindestens zweihundert Jahre alt ist,4 verworfen und überraschenderweise ermittelt, daß deutsche Jugendliche mehr als die amerikanischen nach dem Grund für einen Befehl fragen.5 Da der moderne Krieg intelligente Kooperation auf allen Ebenen verlangt und nicht so sehr bedingungslosen Gehorsam (s. dazu Kap. 5), kann man jedenfalls bezweifeln, ob eine Nation von Automaten gute Soldaten hergeben würde. Auf Grund von Umfragen hat man auch behauptet, die Deutschen seien gefühlloser als die Amerikaner, da sie den Ungehorsam gegenüber einer etablierten Autorität und den Verlust des Gesichts, nicht aber gewalttätiges Vorgehen gegen andere Personen, für die schlimmsten aller vorstellbaren Verbrechen halten. Diese Schlußfolgerung wird aber mit Sicherheit nicht durch die Zahl der Tötungsdelikte für beide Länder erhärtet, wenn man auch bedenken muß, daß während der fraglichen Zeit die übelsten Mörder in Deutschland Uniformen trugen und ihren Beruf unter offiziellem Schutz hinter Stacheldraht ausübten.6
Schließlich kam eine vergleichende Studie zu dem Schluß, deutsche Jugendliche, im Gegensatz zu den amerikanischen, hielten harte Arbeit für ein Ziel an sich, „weil sie beweist, daß der Mensch seine egoistischen Triebe wie Faulheit usw. unter Kontrolle hat“.7 Das „usw.“ ist natürlich besonders aufschlußreich.
Die vorhandenen vergleichenden Studien lassen also, mit anderen Worten, nicht den Schluß zu, daß die Deutschen bessere Soldaten sind als die Amerikaner, ja vielleicht lassen sie überhaupt keinen Schluß zu. Wir wollen versuchen, die Frage zu beleuchten, und uns als nächstes den zahlreichen Versuchen zuwenden, die wiederum in der unmittelbaren Nachkriegszeit unternommen wurden, die „kollektive Seele“ des deutschen Volkes zu verstehen.8 Man hat beispielsweise behauptet, die sozialen Verhaltensmuster der Deutschen unterschieden sich von den übrigen in der westlichen Welt durch den „stark autoritären Charakter der Vater-Sohn-Beziehung. Es gab auch ein viel strengeres formalistisches und hierarchisches Berufssystem.“9 Deutsche Kinder fürchteten die Autorität, entwickelten zwanghafte Züge der Ordnungsliebe und – wenn es Jungen waren – gelangten zu einer „Männlichkeit“, unter der „Unterdrückung aller Impulse der Zärtlichkeit, des Mitleides oder des Bedauerns“ verstanden wird.10 „Partialkonstanten des deutschen Nationalcharakters“ entdeckte ein Autor in „Schaffensdrang“, „Gründlichkeit“, „Ordnungsliebe“, „Formabneigung“, „Eigensinn“ und „Schwärmerseligkeit“.11
All dies ist zweifellos das Ergebnis einer verfrühten Erziehung zur Sauberkeit, zu der deutsche Mütter angeblich neigen.12 Unter Verwendung der Gedanken von Wilhelm Reich sind einige Psychologen zu dem Schluß gelangt, die Deutschen hätten einen zwanghaften analerotischen Charakter. Das führt zu Starrheit, Disziplin und Unfähigkeit zur Entspannung. Ihr Verhältnis zu Frauen wird „oft durch bewußte und unbewußte Furcht, Aggression und Verachtung bestimmt.“13 (Interessanterweise findet sich in einer Studie die Feststellung, daß die amerikanischen Männer, die angeblich in noch höherem Ausmaß als anderswo von Frauen erzogen werden, genau die gleichen Züge aufweisen).14
Der „Reichsdeutsche“ im Sinne Eriksons, um in unserem Überblick fortzufahren, hat, so wird gesagt, einen strengen und zurückhaltenden Vater, der den Haushalt beherrscht und sich über die erfreuliche und zärtliche Bindung des kleinen Jungen an seine nachsichtige Mutter ärgert, die wiederum als Vermittlerin zwischen Kind und Vater wirkt, und von beiden in ambivalenter Weise gehaßt und geliebt wird. Beim Heranwachsenden führt das zu einer heftigen romantischen Rebellion, und er entwickelt dann alle Symptome des „einsamen Genies“. Das Endergebnis ist angeblich eine „merkwürdige Kombination von idealisierter Auflehnung und gehorsamer Unterwerfung“, ein Mensch, der „hart mit sich selbst und mit anderen“ ist.15
Ein Psychiater faßte seine Untersuchungen über den „deutschen Nationalcharakter“ in dem Ergebnis zusammen, die Deutschen hätten „psychotische Neigungen“. Auf diese Weise kann man sicher nicht erklären, warum die Deutschen gute Soldaten sind oder nicht.16
Da die verfügbare Literatur den Beweis nicht ermöglicht, ob die Deutschen eine besonders kriegerische Veranlagung haben (oder nicht), wie steht es dann eigentlich mit den Amerikanern? Hier besitzen wir glücklicherweise eine quantitative Studie, wenn auch auf schmaler Basis, die interessante Schlüsse zuläßt.17 1971 veröffentlicht, besteht sie aus einem Versuch, das sozio-psychologische Profil zweier klar eingegrenzter Gruppen von Amerikanern zu bestimmen, nämlich von Kriegsfreiwilligen („Green Berets“) einerseits und Kriegsdienstverweigerern aus Gewissensgründen andererseits. Methodisch ist die Studie in mancherlei Hinsicht modellartig: Repräsentanten beider Gruppen wurden identifiziert, nach Altersgruppen verglichen, mit Fragebogen versehen und gründlich interviewt.
Abbildung 2.1: Durchschnittswerte für den Edwards Personal Preference Schedule nach Rangordnung der Werte für den Kriegsfreiwilligen
Quelle: David Mark Mantell, Familie und Aggression. Zur Einübung von Gewalt und Gewaltlosigkeit. Eine empirische Untersuchung, Frankfurt a. M. 1972, S. 360.
Abbildung 2.2: Die Gruppenergebnisse der Verweigerer, Freiwilligen und Eingezogenen auf den Skalen über Faschismus, traditionelle Familienideologie, politisch-ökonomischen Konservatismus, Rigidität und Dogmatismus
Quelle: David Mark Mantell, Familie und Aggression. Zur Einübung von Gewalt und Gewaltlosigkeit. Eine empirische Untersuchung, Frankfurt a. M. 1972, S. 348.
Im Vergleich zu der Kontrollgruppe der Kriegsdienstverweigerer wuchsen die „Green Berets“ – nach Auffassung der meisten Leute ausgezeichnete Soldaten – typischerweise in weniger harmonischen Familien auf. Ein Elternteil neigte gewöhnlich dazu, den anderen zu beherrschen. Auf Achtung vor materiellem Besitz, Sozialstatus, Arbeit und Fleiß, Ordnung und Sauberkeit, Disziplin, Anpassung, Gehorsam und körperliche Ertüchtigung wurde mehr Wert gelegt als auf Werte wie Güte, Freude am Leben und persönliche Leistung, die in den Familien der Kriegsdienstverweigerer in hohem Ansehen standen. Stehlen, Lügen, Vandalismus und Ungehorsam galten bei den Eltern der „Green Berets“ als Sünden, wohingegen bei den Kriegsdienstverweigerern dasselbe für Rücksichtslosigkeit zutraf. In den Familien der „Green Berets“ waren Strafen und Drohungen viel weiter verbreitet.
Die Kriegsdienstverweigerer betrachteten Frauen als gleichberechtigte Partner und die Sexualität als gemeinsame Erfahrung. Obwohl zu oberflächlicher Beziehung fähig, lachten sie doch nie über Frauen oder verachteten sie. Im Gegensatz dazu waren die „Green Berets“ „bemerkenswert skrupellos und gefühllos“ in ihren Beziehungen zu Frauen. Auch waren sie männliche Chauvinisten in dem Sinne, daß sie die sexuelle Freiheit nur auf die Männer beschränken wollten. Das wiederum bedeutete, daß eine Frau, mit der sie schliefen, automatisch zu einem Gegenstand der Verachtung wurde.
Um herauszufinden, welche der beiden Gruppen für die amerikanische Lebensweise repräsentativ war, wurden sie mit einer dritten Gruppe verglichen, die aus Wehrpflichtigen bestand. Fünf Tests wurden durchgeführt, zwei davon werden in den Abbildungen 2.1 und 2.2 dargestellt.