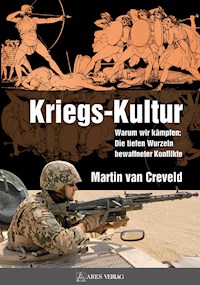Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ares Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Terror ist in Europa angekommen und unsere Regierungen scheinen hilflos dagegen. Nicht einmal die primäre staatliche Aufgabe der Grenzsicherung gelingt der EU. Könnte sich Europa heute überhaupt noch militärisch verteidigen? Der Autor ist skeptisch und bezieht die ganze westliche Welt in seine Analyse ein. Das Problem beginnt schon bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die viel stärker kontrolliert und überwacht, zugleich aber weniger gefordert werden als dies in früheren Zeiten der Fall war. Auch Politik und Medien tun, was sie können, um die Verteidigungsbereitschaft zu schwächen. Detailliert beleuchtet der Militärexperte, wie den Streitmächten Schritt für Schritt die Zähne gezogen wurden, sodass sie heute kaum noch funktionsfähig sind. Auch dem Thema Frauen in Kampfeinheiten widmet er sich kritisch auf der Basis umfangreichen Dokumentationsmaterials. Bezeichnend ist, dass immer mehr westliche Soldaten – etwa in den USA – nach Einsätzen unter "posttraumatischen Belastungsstörungen" (PTBS) leiden, eine Erkrankung, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg fast keine Rolle gespielt hat, obwohl die Kämpfe und damit auch die psychische Belastungen damals viel höher waren. Das Fazit des weltbekannten israelischen Militärhistorikers: Europa ist mittlerweile unfähig zur Selbstverteidigung geworden. Das wird unvermeidliche Rückwirkungen auf seine Stellung in der Welt haben. Kann die westliche Welt, kann das Abendland noch gerettet werden? Nach Ansicht Martin van Crevelds nur, wenn eine Reihe von dringend nötigen Maßnahmen ergriffen und entsprechende Schritte eingeleitet werden. Solange bei uns jedoch die Rechte über die Pflichten der Staatsbürger dominieren, werden diese nicht möglich sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin van Creveld
Wir Weicheier
Warum wir uns nicht mehr wehren könnenund was dagegen zu tun ist
2. Auflage
Umschlaggestaltung: DSR – Werbeagentur Rypka, A-8143 Dobl, www.rypka.at
Umschlagabb. Vorderseite: Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker
Titel der englischen Originalausgabe: Martin van Creveld: Pussycats: Why the Rest Keeps Beating the West and What Can Be Done About It, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016 | Kindle Edition, Amazon Digital Services LLC, 2016. © Martin van Creveld
Aus dem Englischen ins Deutsche übertragen von Dr. Claudia Tancsits (Hauptteil) und Nils Wegner (Rückblick 2023)
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
ARES Verlag
Hofgasse 5 / Postfach 189
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.ares-verlag.com
ISBN 978-3-902732-67-5
eISBN 978-3-990811-20-7
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, des auszugsweisen Nachdrucks oder der Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright der deutschen Ausgabe by ARES Verlag, 2. Auflage Graz 2023
Layout: Ecotext-Verlag, Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein, Wien
Inhalt
Vorwort
EINLEITUNGChronologie eines Scheiterns
KAPITEL IDie gebändigte Jugend
1. Zwei Kindheiten
2. „Sie schaffen es nicht“
3. Verbieten und zensurieren
4. Nivellierung nach unten
5. „Aus Österreich kam ein Mann“
KAPITEL IIEin Heer wird zum Papiertiger
1. „Aufs Pferd, aufs Pferd!“
2. Krieg den Männern
3. Der Juristenstaat
4. Das entmilitarisierte Militär
5. Vom Soldaten zum Söldner
KAPITEL IIIVerweiblichung der Streitkräfte
1. Der Kampf um die Gleichheit
2. Amazones antianeirai
3. Privilegien bewahren
4. Im Lande des „Doppeldenkens“
5. Das Ende der Männlichkeit
KAPITEL IVDie Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) – ein Konstrukt?
1. „Suchet und ihr werdet finden“
2. Achill in Vietnam
3. Vom Soldatenherz zur Kampfmüdigkeit
4. Die Epidemie
5. Beschädigte Ware?
KAPITEL VDie Delegitimierung des Krieges
1. Recht und Macht
2. Der Siegeszug des Rechts
3. Der Niedergang der Pflicht
4. Nein sagen lernen
5. Das absolute Böse
CONCLUSIOHannibalintraportas
NACHWORTRÜCKBLICK 2023
Anhang
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Danksagung
Namenregister
Erwecket die Starken! Lasset herzukommen undhinaufziehen alle Kriegsleute! Macht aus eurenPflugscharen Schwerter und aus euren SichelnSpieße! Der Schwache spreche: Ich bin stark!
Joel 3, 9–10
Vorwort
Das Eine bin ich, das Andere sind meine Schriften. Einige meiner Verwandten, Freunde und Schüler sind im Krieg umgekommen; ich weiß daher manches über das Leid und den Kummer, den ein Krieg immer mit sich bringt. Ich stand einige Male im Feuer und habe eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt. Und ich habe aus nicht allzu großer Entfernung das schönste, wohlklingendste Geräusch gehört, das es gibt – den Lärm unserer eigenen Geschütze, wenn sie endlich beginnen, das feindliche Feuer zu erwidern. Aber ich habe nie die Uniform meines Landes getragen, nie in seiner Armee gedient, ich habe an keinem seiner zahlreichen – großen und kleinen – Kriege teilgenommen und schon gar kein Kommando ausgeübt. Dass ich, anders als die meisten meiner Mitbürger, nicht einmal den Militärdienst abgeleistet habe, liegt daran, dass ich mit einer Gaumenspalte geboren wurde. Im Jahr 1964, als ich den Einberufungsbefehl erhielt, sah man dies als so schwerwiegend an, dass mich die IDF (Israelische Verteidigungsstreitkräfte) aus medizinischen Gründen für untauglich erklärten.
Damals hatten nur wenige Israelis (und schon gar nicht die jüngeren) den geringsten Zweifel, dass die IDF der schönste, größte und beste Teil der Schöpfung wären. Dass ich abgelehnt wurde, war daher ein schwerer Schlag für mein Selbstbewusstsein. Es brachte auch einige mehr oder weniger unangenehme und mehr oder weniger demütigende gesellschaftliche und verwaltungstechnische Probleme mit sich. Später jedoch, als ich Militärhistoriker geworden war, hatte ich Gelegenheit, ernsthaft darüber nachzudenken, was ich versäumt oder nicht versäumt hatte. Einige dieser Gedanken möchte ich in diesem Buch zu Papier bringen.
Krieg führen ist vor allem eine praktische Tätigkeit. Es geht dabei nicht darum, unter die „Intellektuellen“ zu gehen oder wissenschaftliche Aufsätze zu schreiben. Es kommt eben „auf das dumme Gesiege hinaus“, wie es der deutsche Feldmarschall Alfred von Schlieffen einmal ausgedrückt hat.1 Zweifellos gehört zum Krieg auch vieles, was man nur aus Erfahrung lernen kann. Der beste Kriegslehrmeister ist der Krieg. Jedoch ist Erfahrung nicht alles. Um einen anderen, viel größeren preußischen Krieger, Friedrich den Großen, zu zitieren: Wäre es nur auf die Erfahrung angekommen, so wäre nicht Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736), der die Franzosen und die Türken besiegt hatte, der beste Feldherr, sondern dessen Maulesel. Kriegserfahrung ist auch nicht notwendigerweise gleichzusetzen mit der Fähigkeit, den Krieg zu verstehen, zu analysieren und zu beschreiben. Besser als dem blinden Dichter Homer ist dies wohl niemandem gelungen.
Außerdem ist die Erfahrung eines Einzelnen selten umfassend genug, um alle relevanten Bereiche abzudecken. Daher ist es eine Dummheit, sich nicht mit den Erfahrungen anderer zu beschäftigen. Nur dadurch können wir unsere Erfahrungen richtig in das Gesamtbild einordnen und aus der Betriebsblindheit herauskommen, nur dieses Studium kann unserem Denken jene Flügel verleihen, ohne die wir mit dem Neuen und Unerwarteten nicht zurechtkommen. Je komplexer das Phänomen des Krieges im Lauf der Jahre wurde, desto mehr setzte sich die Erkenntnis durch, dass für die Theorie und Praxis des Krieges mehr vonnöten war als die Fähigkeit, ein Schwert zu führen, ein Gewehr abzufeuern, ein Kampfflugzeug zu steuern oder eine Rakete abzuschießen.
Die fortschrittlichsten Streitkräfte der Welt zogen daraus die Konsequenzen und bauten beeindruckende Ausbildungsprogramme auf, für die es im nichtmilitärischen Bereich kein eigentliches Gegenstück gibt. Um 1740 entstanden Militärakademien für Subalternoffiziere. Um 1780 folgten die Generalstabsakademien, am Anfang des 20. Jahrhunderts die Kriegsakademien.2 Es gibt jedoch noch zahlreiche weitere Ausbildungskurse, die viele junge Offiziere absolvieren müssen, bevor sie ihren Dienst antreten.
Je höher die Anforderungen einer Ausbildung und je höher die Dienstgrade der Teilnehmer, desto mehr theoretisches Wissen wurde vermittelt und desto stärker wurden andere Gebiete wie Politik, Wirtschaft, Soziologie, Technik, Kultur etc. eingebunden. Ziel dieser Maßnahmen war einerseits, den Teilnehmern die konzentrierte Erfahrung sowohl der eigenen als auch fremder Streitkräfte zu vermitteln und sie andererseits mit dem Handwerkszeug auszustatten, das sie brauchten, um neuen und unerwarteten Herausforderungen selbständig zu begegnen. Die zunehmende Anzahl an Nichtmilitärs, die an diesen Ausbildungsprogrammen – vor allem in den höheren Studienabschnitten – teilnehmen, zeigt, dass militärische Erfahrung dazu nicht unbedingt notwendig ist.
Außerdem sollte man nicht übersehen, dass das Militär die hierarchischste und disziplinierteste aller von Menschen gegründeten Organisationen ist und alle Lebensbereiche seiner Mitglieder regelt. Oft ist es vom Rest der Gesellschaft durch gewaltige Barrieren abgeschottet. Ohne derartige Organisationen wäre es völlig unmöglich, einen Krieg zu führen.
Andererseits kann es zur Unterdrückung jeder Originalität und jedes Innovationsgeistes führen, wenn die Mitglieder einer Organisation in dieser zu viel Zeit verbringen und die Außenwelt völlig vernachlässigen. Dies führt zu Pedanterie, Konformismus und Gruppendenken – nicht selten auch zu einer schwer zu beschreibenden Kombination aus übertriebenem Professionalismus und Engstirnigkeit. Das alles hat eine populäre Bezeichnung, nämlich „Kumpanei“. Auch die besten Armeen und die besten Militärs können davon betroffen sein – manchmal sogar in besonderem Maße. Über die israelischen Luftstreitkräfte, eine weltweit geachtete Elite, gibt es das böse Wort, dass sie Achtzehnjährige einzieht, um sie zwanzig Jahre später im gleichen Alter zu entlassen.
Ich habe fast mein ganzes Leben in Israel verbracht, habe also etliche Kriege erlebt und kann nur hoffen, dass ich dadurch eine bessere Gelegenheit für Beobachtungen und Studien zu diesem Thema vorgefunden habe als viele andere, insbesondere Europäer. Dass ich nicht gedient habe, hat mir zwar Probleme eingebracht, hat aber – so hoffe ich – auch dazu geführt, dass ich einigen der erwähnten Fallgruben ausweichen konnte. Dabei bin ich zweifellos in andere hineingetappt. Aber das muss der Leser entscheiden.
EINLEITUNG
Chronologie eines Scheiterns
In den letzten Tagen des Weströmischen Reiches und während des gesamten Mittelalters lebte Westeuropa mit der Bedrohung durch fremde Heere, die auch immer wieder Einfälle auf europäisches Gebiet unternahmen. Zuerst kamen die Hunnen, dann die Araber, dann die Magyaren, dann die Wikinger, dann die Mongolen und schließlich die Türken. Sie alle wurden als wilde Krieger beschrieben, denen niemand widerstehen könne. Sie alle brachten Blutvergießen, Zerstörung und maßloses Leid über einen Kontinent, der durch die herrschenden sozio-ökonomischen und politischen Strukturen und die dadurch verursachten inneren Kämpfe praktisch wehrlos war.
Immer wieder schien das Schicksal der westlichen Zivilisation auf Messers Schneide zu stehen: im Jahr 451 auf den Katalaunischen Feldern, dann 732 bei Tours und Poitiers, 955 auf dem Lechfeld, 1241 bei Liegnitz und 1529 vor Wien. Eine Entscheidung eines der beiden Heerführer oder ein Wetterumschwung hätten der Geschichte eine andere Wendung geben können. Hätte, um es zugespitzt zu sagen, ein Hufnagel gefehlt, wären die Schlachten womöglich verloren worden. 1683 marschierte der türkische Großwesir Kara (= der Schwarze) Mustafa mit seinem Heer von Istanbul gegen Österreich. Auf dem Marsch vergrößerte sich das Heer bis auf eine Zahl zwischen 90.000 und 300.000 Mann. Er belagerte Wien, verlangte die Übergabe der Stadt und drohte, andernfalls die Kinder zu versklaven.1
Inzwischen hatte das Pendel jedoch nach der anderen Seite ausgeschlagen. Der erste dauernde Stützpunkt Europas in Afrika war Ceuta, eine nordafrikanische Küstenstadt, die 1415 von den Portugiesen erobert worden war. 1492 hörte das letzte muslimische Königreich auf der Iberischen Halbinsel zu bestehen auf. 1571 markierte die Schlacht bei Lepanto den Anfang der Jahrhunderte dauernden Epoche, die manchmal als „kolumbianisches Zeitalter“ bezeichnet wird – eine Zeit, in der niemand auch nur den Versuch machte, mit den europäischen Flotten zu wetteifern. Europas militärische Vormachtstellung wuchs durch politische, wirtschaftliche, soziale, wissenschaftliche, technische und möglicherweise auch kulturelle Entwicklungen, denen die Bewohner anderer Kontinente nichts entgegenzusetzen hatten, immer stärker an.2 Angetrieben von ihrer Gier nach Reichtum, vom Wunsch, die „wahre“ Religion zu verbreiten, von strategischen Überlegungen und nicht zuletzt aus Abenteuerlust machten sich kleine Gruppen von Europäern auf den Weg.
Zwei der ersten und wagemutigsten Expeditionen waren jene unter der Führung von Hernán Cortés und Francisco Pizarro. Ihr folgten noch viele andere. Die Seefahrer waren oft wochen- und monatelang unterwegs, um unbekannte, unwegsame Gebiete zu erreichen, die Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt waren – mit kleinen, den Elementen schutzlos ausgelieferten Segelschiffen, ohne Möglichkeit, dem Auftraggeber eine Nachricht zukommen zu lassen, geschweige denn in einer Notlage Verstärkung zu erbitten oder zu erhalten. Einmal ging Cortés so weit, seine Schiffe zu verbrennen, um seinen Männern nur die Wahl zwischen Sieg oder Tod zu lassen. Sie alle waren bekannten und unbekannten Krankheiten ausgeliefert, standen einer vielfachen Übermacht von Eingeborenen gegenüber und hatten schwere Verluste. Viele kehrten nie zurück – Magellan wurde auf den Philippinen, Cook auf Hawaii getötet.
All dies hinderte diese Männer nicht, mit einer Entschlossenheit und Unerbittlichkeit vorwärtszudrängen, die uns im Rückblick fast übermenschlich erscheint. Weder die endlosen Weiten stürmischer Weltmeere noch die riesigen Räume Nordamerikas oder Sibiriens, die Urwälder Mittel- und Südamerikas, Südostasiens und Afrikas konnten sie abschrecken, nicht einmal das afghanische Gebirgsland – obwohl die kriegerischen afghanischen Stämme mehr Erfolg hatten. Von einem der berühmtesten Afrikaforscher des 19. Jahrhunderts, Henry Morton Stanley, stammt der Satz: „Wo der zivilisierte Weiße auftritt, hat jede Schwierigkeit zu weichen.“3 Kein Wunder, dass diese Männer überall Hochachtung oder Schrecken – oft beides – auslösten.
Ob in all diesen Jahrhunderten der Handel den Heeren folgte oder umgekehrt, ist umstritten. Wie dem auch sei, fünfhundert Jahre nach der Besetzung von Ceuta wurden weltweit etwa 80 % der Landmasse und so ziemlich alle Meere von fünf europäischen Mächten beherrscht: England, Russland, Frankreich, Deutschland und Italien. Dazu kamen die USA, die von Europa „abstammten“, und Japan, das Europa erfolgreich nachahmte und ebenfalls den Weg zu Expansion und Kolonialherrschaft beschritt. Die beiden wichtigsten Ausnahmen waren Lateinamerika, das jedoch als beinahe exklusives Revier der USA galt und von der Monroe-Doktrin als solches erklärt wurde, und China, das schon große Gebiete an Russland und kleinere an andere europäische Mächte verloren hatte und nur durch die Zwistigkeiten unter den europäischen Mächten und durch seine eigene ungeheure Größe und Bevölkerungszahl vor dem Zusammenbruch bewahrt wurde.
Der „Westen“ – damit sind ab sofort die Länder Westeuropas und Nordamerikas, nicht aber Russland und Japan gemeint – erreichte kurz vor 1914 den Höhepunkt seiner Macht. Später fiel es ihm – teils wegen der riesigen Menschenverluste im Ersten Weltkrieg und teils wegen seines geschwächten Selbstvertrauens – immer schwerer, die Herrschaft über unterworfene Völker aufrechtzuerhalten. In der Zwischenkriegszeit erlangten mehrere Länder im Nahen Osten, wie Ägypten, der Irak und Jordanien, zumindest de jure ihre Unabhängigkeit. Es dauerte länger, bis sie auch de facto unabhängig wurden, aber in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre war auch das erreicht.
Wir beschäftigen uns hier mit dem strategischen, nicht mit dem moralischen Aspekt. Um bei der Zwischenkriegszeit zu bleiben: Auseinandersetzungen wie der Rifkrieg in Marokko, bei dem etwa 250.000 gut ausgerüstete, bestens ausgebildete französische und spanische Soldaten mehrere Jahre brauchten, um einen losen Zusammenschluss von marokkanischen Stammeskriegern zu besiegen, die größtenteils Analphabeten waren und nicht einmal Schuhe trugen, warfen ein bezeichnendes Licht auf die allgemeine Entwicklung.4 Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bereiteten sich schon viele Kolonialvölker auf der ganzen Welt darauf vor, sich gegen ihre Beherrscher aufzulehnen – obwohl erst der Krieg, in dem diese Beherrscher einander zerfleischten, den Boden für den Aufstand bereitete.
Seither hat es nur einen klaren Sieg westlicher Staaten über einen nichtwestlichen Gegner gegeben – nämlich den Ersten Golfkrieg. 1991 war die NATO, das mächtigste Militärbündnis der Geschichte, als Sieger aus der 45-jährigen Auseinandersetzung hervorgegangen, die wir den Kalten Krieg nennen. Aber die Mitgliedstaaten hatten noch nicht begonnen, ihre Streitkräfte in größerem Maße zu verkleinern, was vor allem die europäischen NATO-Staaten später tun sollten. Daher waren sie wie zu keinem früheren oder späteren Zeitpunkt in der Lage, ihre Truppen nach Belieben an jeden Ort zu schicken und gegen jeden Gegner Krieg zu führen. Obwohl es nur wenige zum damaligen Zeitpunkt begriffen,5 war es eine unglaubliche Dummheit von Saddam Hussein, mit einer konventionellen Armee die NATO herauszufordern, die von weiteren Staaten unterstützt wurde. Trotzdem führten die USA und ihre Verbündeten die Sache nicht zu Ende. Mit gutem Grund, wie sich später herausstellen sollte.
Von dieser Episode abgesehen wurde der Westen (oder bestimmte westliche Länder) bei jedem Kampf gegen einen nichtwestlichen Gegner geschlagen. Den Gegnern, die diese Kriege führten und an den Kämpfen teilnahmen, gelang es jedoch, ganze Kontinente mit Hunderten Millionen Einwohnern zu „befreien“ – was immer das auch heißen mochte. Die Briten scheiterten zuerst in Palästina und dann in Malaysia, wo sie trotz eines angeblichen „Sieges“ dessen Unabhängigkeit anerkennen und sich zurückziehen musste. Auch in Kenia, Zypern und Aden scheiterten die Briten und mussten sich zurückziehen. Danach gaben sie den traurigen Rest ihres Kolonialreiches, das bis 1946/47 das größte der Geschichte gewesen war, praktisch kampflos auf. Die Franzosen scheiterten in Indochina und in Algerien. Zuvor hatten sie nicht weniger als 230.000 Mann (Stand November 1955) und das bis dahin größte Hubschrauberkontingent der Geschichte in das nordafrikanische Land geschickt – alles ohne Erfolg.
Kleineren Kolonialmächten ging es nicht besser. 1949 mussten die Niederlande auf Indonesien verzichten. Sechsundzwanzig Jahre später gab Portugal nach jahrzehntelangen, erschöpfenden Kämpfen Angola und Mozambique auf. Man könnte sagen, dass in den zwei Jahrzehnten nach 1945 nur jene europäischen Länder keine Niederlagen einstecken mussten, die das Glück gehabt hatten, ihre Kolonien schon im Ersten Weltkrieg zu verlieren, oder die – noch besser – nie welche besessen hatten.
Viele Amerikaner zogen aus diesem Geschehen den Schluss, dass ihre europäischen Verbündeten der Verweichlichung und der Dekadenz anheimgefallen waren.6 Voller Tatendrang und mit ungebrochenem Selbstbewusstsein schickten sie sich an, die Kipling’sche „Bürde des weißen Mannes“ zu übernehmen. Der damalige israelische Ex-Generalstabschef Moshe Dayan urteilte bei einem Besuch in Washington im Jahre 1966, die Amerikaner versuchten Freund und Feind folgende Botschaft zu übermitteln: Wir sind das A-Team – die cleverste, bestorganisierte und stärkste Streitmacht der Geschichte, die nichts und niemand aufhalten kann.7
Das Ergebnis war der Vietnamkrieg. Nach den aufgewendeten Mengen an Material und der Anzahl der Toten zu schließen, war noch nie zuvor ein Kolonialkrieg mit größerer Erbitterung geführt worden. Und das alles, um einen Gegner zu überwinden, der ein so kleines Stromnetz betrieb, dass es zu 87 % zerstört wurde, ohne dass sich dies negativ ausgewirkt hätte, und dessen Anführer wie ein armer Verwandter des Weihnachtsmannes aussah, ein schwarzes pyjamaartiges Gewand und Sandalen aus alten Autoreifen trug und von der sprichwörtlichen Handvoll Reis lebte.8
Ein Vierteljahrhundert später wiederholten die Amerikaner, ermutigt durch den schon erwähnten Sieg über Saddam (und durch den kleineren Sieg über Serbien im Kosovokrieg), ihren Fehler, indem sie zuerst in Afghanistan und dann im Irak einmarschierten. Beide Staaten waren nicht in der Lage, sich zu wehren, wobei Afghanistan kaum als „Staat“ im eigentlichen Sinne zu bezeichnen war. Beide wurden schnell und unter geringen Verlusten überrannt. Während Präsident George W. Bush, Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und ihre Berater einen leichten Sieg erwartet hatten, zogen sich beide Kriege in die Länge. Die Verluste gingen in die Zehntausende; inzwischen wurden die meisten westlichen Truppen abgezogen, ein Ende ist jedoch nicht in Sicht. Die Kosten, einschließlich der Hilfe für verwundete Kriegsveteranen und die Auffüllung der dezimierten Einheiten, sollen zwischen vier und sechs Billionen Dollar gelegen haben.9 Diese finanzielle Bürde ist so schwer, dass sie wahrscheinlich nie zur Gänze bezahlt werden wird. Und all das hat keinen ersichtlichen Nutzen gebracht.
Zehn Jahre, nachdem ein bekannter Autor die USA als „Koloss“, als dominierende Weltmacht geschildert hatte,10 schienen sie sich nun in vollem Rückzug zu befinden. Zugleich wurde der von einem anderen Buchautor so genannte „neue amerikanische Militarismus“11 über Bord geworfen. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts konnte man die USA absolut nicht mehr als „vom Krieg verführt“ bezeichnen. Vielmehr versuchten sie nun, bewaffnete Konflikte – und umso mehr den damit verbundenen Blutzoll – um fast jeden Preis zu vermeiden. Wenn die USA überhaupt in einen Krieg eingriffen, geschah dies fast nur mehr durch den Einsatz von Flugzeugen, Marschflugkörpern und Drohnen, gegen die der Gegner keine Chance hatte.
Die NATO-Verbündeten der USA schienen fast noch mutloser geworden zu sein. Während des gesamten Kalten Krieges war ihr Militärbudget, am BIP gemessen, deutlich niedriger gewesen als jenes der USA. Nach dem Ende des Kalten Krieges reduzierten die meisten dieser Staaten ihre Militärausgaben so weit, dass sie gerade noch Streitkräfte besaßen.12 Das Personal wurde extrem reduziert. Die Ausrüstung wurde so sehr vernachlässigt, dass bald ein Großteil veraltet und/oder nicht mehr einsatzfähig war.13 Angesichts dieser Tatsachen ist die seinerzeitige Behauptung des späteren israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der Westen könne gewinnen, gelinde gesagt als optimistisch anzusehen.
Noch dazu waren die Sieger in fast allen Fällen keine regulären Streitkräfte. Sie hatten keine Militärdoktrin, keine moderne Ausrüstung und Ausbildung aufzuweisen, schon gar keine Dienstautos oder schneidige Uniformen voller glänzender, wenn auch oft bedeutungsloser Orden. Von Sanaa bis Saigon und von Kuala Lumpur bis Kabul standen den westlichen Heeren – zumindest am Anfang – meist nur bunt zusammengewürfelte irreguläre Truppen gegenüber. Die Männer waren manchmal von einer Anzahl Frauen begleitet, die allerlei Hilfsdienste übernahmen. Die Kämpfer hatten ihre Jugend bei der Feldarbeit verbracht oder Ziegen gehütet; viele hatten keine richtige Ausbildung durchgemacht, manche waren Analphabeten. Der Blutzoll war hoch, bevor sie richtig zu kämpfen lernten.
Kaum ein Angehöriger dieser Truppen hatte eine höhere militärische Ausbildung genossen. Das wäre allerdings auch nicht sinnvoll gewesen. Schließlich gehörten die meisten der in Frage kommenden Bildungsinstitutionen sogenannten „modernen“ Armeen angeblich „moderner“ Staaten. Wenn sich der Unterricht auf Texte von Guerillaführern wie T. E. Lawrence, Mao Zedong, Che Guevara oder Võ Nguyên Giáp erstreckte, dann nur, damit die Studenten „den Feind kennenlernten“. Wie man ein guter Terrorist, Guerillakämpfer, Aufständischer oder auch Dschihadist wurde, konnte man in diesen Bildungsanstalten nicht lernen.
Im Aussehen und im Verhalten erinnerten die irregulären Kämpfer oft eher an Banditen und Geächtete als an Soldaten. Die kleinen, beweglichen und flexiblen Guerillaeinheiten nahmen sich im Vergleich zu regulären Armeen aus wie Flöhe im Vergleich zu einem Nashorn. So leistete die Organisation IS im Irak Anfang 2017 nach einjährigem Kampf immer noch allem Widerstand, was die USA, die einzige Supermacht der Welt, gegen sie aufboten. Der IS begann sich sogar zu einem richtigen Staat zu entwickeln; und Präsident Obama musste einen seiner Verteidigungsminister feuern, weil er mit diesem Problem nicht fertiggeworden war.
Dabei verfügte der IS, eine relativ kleine Organisation mit einigen zehntausend Kämpfern,14 nicht annähernd über die gleichen territorialen, demografischen, wirtschaftlichen, fiskalischen, organisatorischen und technischen Möglichkeiten wie seine zahlreichen Feinde und besaß auch keine der modernen Waffen, die die westlichen Gegner, vor allem die USA, ständig neu entwickelten und ins Gefecht warfen.
Meist vermieden die kleinen, dezentralen Organisationen starke Truppenkonzentrationen. So stellten die Taliban während des gesamten Krieges in Afghanistan nie eine Einheit zusammen, die stärker als ein Bataillon gewesen wäre. Sie vermieden große konventionelle Operationen und verlegten sich auf den „langanhaltenden Krieg“ (der Begriff stammt von Mao) bzw. „nichttrinitarischen Krieg“ (der Begriff stammt von mir) oder „Krieg niedriger Intensität“ (dieser Terminus wurde in den 1970er Jahren eingeführt), nämlich auf Aufstände, Guerillakrieg, Terrorismus oder „Volkskrieg“. Der letzte Begriff spricht für sich; er weist auf die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten hin und erklärt, warum die Opferzahlen manchmal so immens waren, dass beinahe von einem Genozid gesprochen werden kann.
In gewisser Weise ist die Schwäche der irregulären Truppen eine Erklärung für ihren Erfolg. Zu lange hatte der Westen es für selbstverständlich gehalten, dass er seine Truppen weiter auf dem gesamten Erdball einsetzen konnte, wie er es jahrhundertelang getan hatte – auch in Ländern, von denen die Menschen im Westen nichts wussten und die ihnen herzlich gleichgültig waren.
Da der Westen zur See noch stärker ist als zu Land, hat eine von einem anderen Kontinent ausgehende Invasion auf westliches Territorium immer noch keine Aussicht auf Erfolg. Lange bevor die Invasionstruppen ihr Ziel erreicht hätten, würden sie von der weit überlegenen westlichen Feuerkraft vernichtet werden. Der Westen war sich seiner Überlegenheit allzu bewusst und vernachlässigte daher die Verteidigung, vor allem gegen jene Gegner, die keine Staaten sind und die die klassische „trinitarische“ Trennung zwischen Regierung, Streitkräften und Bevölkerung nicht einhalten, und gegen „geistige“, nicht ausschließlich militärische Gegner. Überdies erkannte er nicht – und wollte oft nicht zur Kenntnis nehmen –, dass um ihn herum eine neue Welt entstand.15
Was die Zukunft bringen wird, weiß keiner. Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass das nukleare Gleichgewicht des Schreckens, das die Staaten der ersten und zweiten Welt seit 1945 davon abgehalten hat, gegeneinander Krieg zu führen, weiterbestehen wird, auch im Falle – manche meinen: besonders im Falle –, dass noch mehr Länder diese Waffen erwerben. Wenn Nuklearwaffen allerdings zum Einsatz kommen, dann werden wir uns tatsächlich in einer neuen Welt wiederfinden – oder es wird keine Welt mehr geben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden, so wie bisher seit 1945, die allermeisten Kriege, an denen der Westen teilnehmen wird, Kriege gegen irreguläre Truppen sein, die über Staatsgrenzen hinweg oder innerhalb von Staatsgrenzen aktiv sind (der letztere Fall wird immer häufiger).
Angesichts der düsteren Aussichten haben manche, die in der Vergangenheit an derartigen Feldzügen teilgenommen haben, ernsthafte Gewissenserforschung betrieben. Sie haben auf schwerfällige, kopflastige Kommandostrukturen hingewiesen, auf komplexe und undurchsichtige Befehlsketten, schlechte Geheimdienstarbeit aufgrund ungenügender Kenntnis des Landes, seiner Bevölkerung, Sprache und Kultur, und ein Personalsystem, das die Lasten nicht gerecht verteilte und zu Unzufriedenheit und Protesten führte; auf zu lange oder zu kurze Stationierungszeiten, unzureichende Ausbildung, für die nichtkonventionelle Kriegführung ungeeignete Ausrüstung, und Ähnliches.
Andere sahen die Schuld bei den Politikern, die sich ihrer Meinung nach in Details einmischten und den Militärs nicht die nötige Freiheit ließen – oder die nur an die nächsten Wahlen dachten und denen es an Stehvermögen und Entschlossenheit fehlte, um den Krieg bis zum Ende durchzuziehen. Wieder andere sahen ebendiese Defizite bei der Bevölkerung. Auch die profitgierigen, giftspritzenden Medien wurden als Schuldige ausgemacht, die sowohl die Politiker als auch die Bevölkerung gegen die Militärs aufbrachten.16 Schließlich und endlich kommt von vielen Seiten immer wieder das Argument, dass ein solcher Krieg nicht mit militärischen Mitteln allein gewonnen werden kann, sondern dass man dazu auf politische Mittel zurückgreifen muss. Diese Meinung übersieht allerdings, dass nach Mao „die Macht aus den Gewehrläufen kommt“.17 Abgesehen von der völligen Vernichtung, die nur selten eintritt, ist das Ziel eines Krieges ein sehr einfaches: Genug Tod und Zerstörung zu verursachen, um den Willen des Feindes zu brechen, sodass er seinen Widerstand aufgibt und tut, was wir von ihm verlangen – wenn nicht zur Gänze, dann zumindest zum Teil, und wenn nicht in alle Zukunft, dann zumindest für einige Zeit. Wenn das erreicht ist, kommt die Politik meist allein zurecht.
All diese Erklärungen gehen am Wesentlichen vorbei: Die „Schlitzaugen“, die „Kameltreiber“ oder welche abwertende Bezeichnung sie sonst von ihren Gegnern erhielten, haben deshalb gesiegt, weil sie besser waren. Oft mussten sie unter Bedingungen leben und kämpfen, die sich die meisten Bewohner entwickelter Länder nicht einmal vorstellen können. Aber das hielt sie nicht davon ab, bessere Propaganda zu machen, besser zu mobilisieren, besser zu organisieren, besser zu planen, stärker zu motivieren, besser zu führen, besser zu manövrieren, besser zu kämpfen, länger durchzuhalten und auch mit Leiden und Tod besser fertigzuwerden als ihre Feinde.
Mark Bowden, der Autor des Buches Black Hawk Down, erklärt: „Zivilisierte Staaten [haben] gewaltfreie Methoden der Streitbeilegung, aber das hängt vom Willen aller Beteiligten ab, einzulenken. Hier in der rauen Dritten Welt hatten die Menschen nicht gelernt einzulenken, jedenfalls nicht, bevor eine Menge Blut geflossen war.“18 Ein amerikanischer Soldat mit Afghanistan-Erfahrung meinte, neben den „Kameltreibern“ hätten „die westlichen Soldaten wie Weicheier gewirkt“.19 Ihre Fähigkeit und Entschlossenheit, bei all dem mitzumachen, war ihr wichtigster Pluspunkt – oft ihr einziger, wie sie selbst sagten. Ob sie wollten oder nicht, sie taten es in der Absicht, um damit alles andere zu kompensieren.
Wie konnten die besten, kampfesmutigsten Soldaten, die jahrhundertelang alle und jeden besiegt haben, bis sie die ganze Welt beherrschten, zu Weicheiern werden? Wie konnte Stanley glauben, vor dem „zivilisierten“ weißen Mann müssten alle Schwierigkeiten weichen, während jetzt das Gegenteil der Fall zu sein scheint? Und warum werden in den westlichen Medien Geschichten von allerlei Rambos breitgetreten, die in selbstmörderischer Mission in der Dritten Welt ihr Unwesen treiben und Scharen von Eingeborenen überwältigen, während doch die tatsächliche Entwicklung in die andere Richtung geht?
In dem als „Wuzi“ bekannten Text, der etwa aus dem Jahre 390 v. Chr. stammt, heißt es: „Wenn die Toten erstarrt daliegen und ihr um sie trauert, habt ihr die Gerechtigkeit nicht erlangt.“21 Wenn man nicht willens und in der Lage ist, zu kämpfen, wenn es notwendig ist, wird man früher oder später den Kopf verlieren – vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, man denke nur an den IS. Deshalb ist es lebenswichtig, auf die aufgeworfenen Fragen eine Antwort zu finden.
Diese Antwort will ich im Folgenden zu geben versuchen. In Kapitel I geht es darum, wie junge Menschen, vor allem junge Männer, aus denen später Soldaten werden, in der modernen westlichen Gesellschaft erzogen oder verzogen werden. Kapitel II zeigt auf, wie der Westen sein Bestes getan hat, um seine Streitkräfte zum zahnlosen Papiertiger zu machen. In Kapitel III geht es um die Demontage der Streitkräfte durch Frauen – oder vielmehr durch die Art, wie Frauen in sie eingegliedert werden. Kapitel IV untersucht die bisher nie gekannte Verbreitung des Phänomens PTBS. Kapitel V hat das zunehmende Überwiegen der Rechte gegenüber den Pflichten und die Delegitimierung des Krieges zum Inhalt. Abschließend präsentiere ich meine Schlussfolgerungen.
Noch ein letzter Punkt: Obwohl auch andere westliche Länder nicht außer Acht gelassen werden,22 liegt der Schwerpunkt der folgenden Betrachtungen auf den USA. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens sind die USA weitaus der mächtigste westliche Staat. Das Verhältnis ihres Militärbudgets zu jenen der restlichen NATO-Staaten ist in etwa 2:1.23 Zweitens haben die USA oft die Initiative ergriffen und dadurch als Vorbild für ihre Verbündeten und in gewissem Maße auch für ihre Feinde gewirkt. Kein Land bildet so viele ausländische Offiziere in seinen militärischen Bildungsinstitutionen aus – das Gleiche gilt mutatis mutandis im zivilen Bereich. Nach den Worten des Politikwissenschaftlers Joseph Nye ist die „soft power“ der US-Streitkräfte größer als die aller anderen Streitkräfte, vielleicht aller anderen zusammen.24 Und drittens: Wenn der Westen überhaupt zu retten ist, werden die USA den Löwenanteil der Last tragen müssen.
Andernfalls …
KAPITEL I
Die gebändigte Jugend
1. Zwei Kindheiten
Im Jahre 1994 kam mir das erste Mal der Gedanke, dass bei den Streitkräften der „modernen“ Staaten etwas ganz und gar schiefgelaufen sein könnte. Der Anlass war ein Vortrag über die Zukunft des Krieges, den ich vor den versammelten Mitgliedern des israelischen Generalstabs zu halten hatte. Den Vorsitz führte der Chef des Generalstabs, Ehud Barak, der später Premierminister wurde. Ebenso anwesend war der damalige Kommandant der Nordfront, ein durchsetzungsfähiger Generalmajor namens Yitzhak (Itzik) Mordechai. Im Oktober 1973 hatte er Fallschirmjäger in der sogenannten „chinesischen Farm“ am Suezkanal befehligt. Im vielleicht blutigsten Gefecht des gesamten Krieges war sein Bataillon, das berühmte 890er, beinahe aufgerieben worden. 1996–1999 war er Verteidigungsminister unter Benjamin Netanjahu.
An diesem Morgen beklagte sich Mordechai über „diese Computerkids“, die er gegen die Hisbollah-Terroristen im Südlibanon befehligte. „Ich weiß nicht, was mit denen los ist“, sagte er mit einer resignierten Armbewegung. Dass seine Befürchtungen berechtigt gewesen waren, zeigte zwölf Jahre später – 2006 – der Zweite Libanonkrieg, in dem die israelischen Bodentruppen die in sie gesetzten Erwartungen zum Großteil nicht erfüllten und Schmach auf sich luden. Das Gleiche galt in geringerem Ausmaß für die Operation Protective Edge im Jahr 2014.1
Ich wohne in einer Obermittelklasse-Wohngegend in Mewasseret Zion, westlich von Jerusalem. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein „Aufnahmezentrum“. Es besteht aus vielen kleinen, ziemlich heruntergekommenen Wohnhäusern, die schon von Generationen von Einwanderern aus vielen verschiedenen Ländern bewohnt wurden. Derzeit verbringen dort hunderte äthiopische Familien die ersten Monate nach ihrer Ankunft in Israel, bevor sie Hebräisch lernen, Arbeit finden und woanders hinziehen. Seit etwa zwanzig Jahren sehe ich den Kindern solcher Familien beim Aufwachsen zu. Sie werden eindeutig weniger beaufsichtigt und behütet als nicht-äthiopische israelische Kinder im gleichen Alter. Das hat zum Teil sicherlich kulturelle Gründe. Außerdem spielt eine Rolle, dass der Nachwuchs der Einwanderer sich schneller an die neue Umgebung anpasst, als dies ihren Eltern möglich ist. Daher lernen sie, selbständig zu sein, ob es den Eltern recht ist oder nicht.
Der Mangel an elterlicher Aufsicht – man könnte auch sagen: die größere Selbständigkeit, die größere Entscheidungsfreiheit, das Mehr an Selbstverantwortung – mag dazu führen, dass den Kindern zu Hause und anderswo mehr Unfälle zustoßen. Ich habe nie eine Statistik zu diesem Thema gesehen – vielleicht deshalb, weil jeder, der eine solche erstellen wollte, schnell als Rassist gebrandmarkt würde. Man sieht die Kinder in den Straßen herumlaufen – meist sind sie dabei sich selbst überlassen. Sie klettern auf Bäume und Häuser. Sie haben keine Fahrradhelme, fahren aber trotzdem mit Fahrrädern, die meist alt und rostig sind. Sie tragen alle möglichen, von anderen weggeworfenen Sachen zusammen und stellen Dinge damit an, für die diese Gegenstände nicht vorgesehen sind. Sie spielen selbst erfundene Spiele, bei denen es oft ziemlich grob zugeht. Manchmal raufen sie, obwohl ich nie eine so schwere Rauferei gesehen habe, dass ich geglaubt hätte, einschreiten und die Streithähne trennen zu müssen. Kurz gesagt, sie tun alles, was Kinder immer schon gern getan haben.
Besonders fällt auf, dass die größeren Kinder die kleineren anführen und die jüngeren den älteren folgen, wobei nur selten Erwachsene zu sehen sind, die ihnen vorschreiben, was sie tun und lassen sollen. Mädchen mit sechs, sieben Jahren passen auf Kleinkinder auf, tragen sie in den Armen oder bringen ihnen das Gehen bei. Manchmal laufen Zweijährige ganz allein und unbeaufsichtigt auf dem Gehsteig herum – wenn das in einem anderen entwickelten Land oder in einer anderen Wohngegend in Israel geschähe, würde man die Eltern anzeigen und ihnen die Kinder abnehmen.
Aber die Freiheit scheint die Kinder unternehmungslustig zu machen – und auch glücklich, obwohl das nicht zu meinem Thema gehört. Sie sind nicht auf Schritt und Tritt von Ängsten geplagt, und sie können auf sich selbst aufpassen. Sonst würden sie kaum überleben. Der Gegensatz zu den Kindern in Israel – einschließlich meiner eigenen Enkelkinder –, die auf Schritt und Tritt beaufsichtigt, beobachtet, behütet und ermahnt werden, könnte größer nicht sein. Würden die beiden Gruppen miteinander raufen, so ist nicht schwer zu erraten, wer als Sieger vom Kampfplatz gehen würde. Vor einigen Jahren geschah tatsächlich etwas Derartiges: Zwei Jungen, die gerade mit ihren Familien aus Russland eingewandert waren, schlugen einige Studenten der Universität Technion zusammen – während Dutzende weitere Studenten und Studentinnen dabeistanden und nicht wagten, einzugreifen.
2. „Sie schaffen es nicht“
Das alles war nicht immer so. Die Tendenz, jungen Leuten immer mehr Beschränkungen aufzuerlegen, ist ein Merkmal, um nicht zu sagen eine Krankheit, der modernen Lebenswirklichkeit im Allgemeinen und jener der westlichen Welt im Besonderen. Nie in der gesamten Menschheitsgeschichte wurde das Alter, ab dem ein junger Mensch als Erwachsener gilt, so hoch angesetzt. Die Ursprünge dieses Wandels liegen in den 1820er Jahren. Damals begann das Wort „childhood“ (Kindheit) häufiger in Büchern aufzutauchen, was sich anhand der unschätzbaren Suchmaschine Google Ngram feststellen lässt. Sechzig Jahre später folgte der Begriff „adolescence“ (Jugend, Jugendalter); Anthropologen definieren das Jugendalter als jene Lebensperiode, in der die jungen Menschen „im Elternhaus unter der Erziehungsgewalt der Eltern leben, die Schule besuchen und die Qual der Wahl zwischen einer verwirrenden Fülle an Berufen haben“.2 Im Jahr 2000 stiegen beide Kurven immer noch an, aber nicht mehr so schnell wie zuvor. Spätere Historiker sprachen von der „Erfindung der Kindheit“.3 Sie sahen die Ursachen des Wandels in der schnellen Verstädterung: Während Kinder in der vorindustriellen Zeit ein wirtschaftlicher Pluspunkt waren, wurden sie später zur Last.
Kaum war die Kindheit erfunden, begannen die Versuche, Kindern besonderen Schutz angedeihen zu lassen. Die ersten Gesetze zur Regelung der Kinderarbeit wurden 1830 in England, dem am stärksten industrialisierten Staat, erlassen.4 Andere Staaten folgten. Nicht nur die Arten von Arbeiten, die Kinder verrichten durften, und die Arbeitsbedingungen, sondern auch das Alter, ab dem Kinder arbeiten durften, wurden geregelt. Zweifellos wurden diese Gesetze von Menschen formuliert und durchgesetzt, die über die Zustände in den Bergwerken und Fabriken entsetzt waren. Aus höchst ehrenwerten Beweggründen wollten sie die Kinder vor Ausbeutung und Arbeitsüberlastung schützen, damit sie gesund aufwachsen und lernen konnten.5
Aber nicht immer waren uneigennützige Motive ausschlaggebend. Manche Abgeordnete, die in den Parlamenten gegen die Kinderarbeit auftraten, waren Vertreter des Beamtentums. Nachdem ihre Hauptaufgabe jahrhundertelang im Einheben von Steuern bestanden hatte, suchten die Bürokraten nun nach mehr Macht und Einfluss. Die Fürsorge für Kinder und Jugendliche und ihre Ausbildung boten da ein reiches Betätigungsfeld. Inzwischen haben sich Bildung und Kinder- und Jugendfürsorge zum teuersten Sektor der Staatsverwaltung entwickelt. Zu den Gegnern der Kinderarbeit gehörten auch Gewerkschaftsvertreter, deren Ziel möglichst hohe Löhne waren. Wieder andere vertraten große Unternehmen und wollten kleinere Familienbetriebe, denen es leichter fiel, Halbwüchsige zu niedrigen Löhnen anzustellen, aus dem Geschäft drängen.
Das Phänomen weitete sich aus. Vielfältige gesetzliche Vorschriften wurden erlassen, Behörden wurden geschaffen, die deren Einhaltung kontrollierten. Dann kam die geschäftliche Seite – in den USA werden jedes Jahr Hunderte Milliarden Dollar mit der Schaffung und Erhaltung einer eigenen „Jugendkultur“ verdient. Internationale Organisationen, ob staatlich oder nichtstaatlich, hielten jede Arbeit, die Kinder verrichten konnten, für schädlich und ausbeuterisch. Religionsgesellschaften warfen den Halbwüchsigen gern vor, nicht genügend auf die Moral und auf Gott Bedacht zu nehmen; von den Medien wurden Jugendliche wiederum als faul, selbstverliebt, leichtsinnig, sex- und drogensüchtig dargestellt. Da die gesellschaftliche Gruppe der Jugendlichen es besonders schwer hat, sich zu verteidigen, wurde ihr die Schuld an allen Übeln gegeben, an denen die Gesellschaft litt.6 In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts führten die „entwickelten“ Länder eine Kampagne, um den „Entwicklungsländern“ ihre Standards aufzuzwingen. Damit sich die Entwicklungsländer möglichst schuldig fühlten, erklärten die entwickelten Länder – mit Unterstützung zahlreicher internationaler Organisationen – die Häufigkeit der Kinderarbeit zum Maßstab des „Fortschritts“.7
All diese Personen und Organisationen hatten ein ureigenes Interesse daran, junge Menschen aus welchen Motiven auch immer zu kontrollieren. Diese sollten einen möglichst großen Teil ihres Lebens in einem Zustand verbringen, in dem sie nicht arbeiten, keine Verantwortung übernehmen und nicht für sich selbst sorgen konnten. Hier und da wurden halbherzige und vergebliche Versuche unternommen, die Uhr zurückzudrehen. So wagte der ehemalige Sprecher des US-Abgeordnetenhauses und Präsidentschaftskandidat, Newt Gingrich, einmal anzudeuten, es wäre gar keine schlechte Idee, wenn die Kinder zum Familieneinkommen beitragen würden. Er wurde gnadenlos ausgelacht. Als Senator Rand Paul bei der Ankündigung seiner Präsidentschaftskandidatur erzählte, er habe als Teenager sogar gern im Sommer gearbeitet, ging es ihm ähnlich.8
Auch das war nicht immer so. Vor einem halben Jahrhundert besuchte der berühmte Kinderpsychologe Bruno Bettelheim Israels Kibbuzim. Er war beeindruckt und fand lobende Worte dafür, dass die Kinder dort leichte Arbeiten verrichten durften, denn dadurch würde „das Gefühl der Tüchtigkeit, der Sicherheit und des Wohlseins ungeheuer verstärkt“.9 Solange das System der Gemeinschaftserziehung existierte, brachte es außerordentlich motivierte junge Menschen hervor, die Herausragendes leisteten.10 Viele von ihnen nahmen später gehobene Stellungen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft Israels ein, nicht zuletzt auch im Militär.
Das Gleiche gilt für die Amische. Solange die meisten von ihnen noch in der Landwirtschaft tätig waren, hielten sie ihre Kinder zur Arbeit an. Die Kinder, die zum Familieneinkommen beitrugen, hatten das Gefühl, gebraucht zu werden. Daher litten sie weniger unter den Problemen wie Kriminalität, Drogen und Teenagerschwangerschaften, die das Leben manches amerikanischen Jugendlichen prägten.11 Eine Google-Scholar-Suche nach der Begriffskombination „Amische“ und „Jugendkriminalität“ ergab fast keine Treffer. Bis heute gibt es keinen Beweis, dass Kinder in „Entwicklungsländern“, von denen viele arbeiten, weniger glücklich sind als Kinder in „entwickelten“ Ländern, die von Gesetzes wegen nicht arbeiten dürfen. Nach dem Prozentsatz von Kindern zu schließen, die psychotherapeutisch behandelt oder mit Medikamenten vollgestopft werden, könnte es genau umgekehrt sein.
Schließlich blieb in den meisten westlichen Ländern der elterliche Bauernhof der einzige Ort, wo Kinder produktive Arbeit leisten durften. Auch das war nur möglich, weil sie keine Bezahlung erhielten und die Behörden daher nicht informiert wurden oder ein Auge zudrückten. Ansonsten waren sie auf schlecht bezahlte Arbeiten angewiesen, die keine Ausbildung erforderten und daher nichts oder nur wenig Bildendes an sich hatten. Am bekanntesten sind Babysitten, Autowaschen, leichte Gartenarbeit, Kundenbedienung im Fastfood-Restaurant, Botengänge und dergleichen. In den USA gehörte auch das Austragen von Zeitungen dazu, das als typische Arbeit für Buben galt, wenn dies auch nicht ganz der Realität entsprach.
Alle anderen Tätigkeiten waren verboten, auch wenn sie angenehm und von Kindern leicht zu bewältigen waren und eindeutig zu ihrem Wohl beitrugen.12 Dies galt auch für Tätigkeiten, die sich im Rahmen einer Lehre am besten erlernen lassen, wie es bei zahlreichen Handwerkszweigen der Fall ist. Es war das Handwerk und nicht die Schule, das im Lauf der Geschichte zahllosen Menschen den ersten Schritt zum Erfolg ermöglichte.
Im Jahre 1970 waren die Bemühungen, Kinder von sämtlichen Lohnarbeiten auszuschließen, praktisch abgeschlossen. Das bedeutete aber nicht, dass Kinder ihre Zeit nach Wunsch verbringen oder untätig bleiben können. In zunehmendem Maße wird von ihnen Freiwilligenarbeit verlangt, damit sich ihre Chancen auf den Eintritt in eine Eliteuniversität erhöhen.13 Was die meisten Erwachsenen nur für Bezahlung tun wollen, soll der Nachwuchs umsonst machen. Ein ungerechteres System kann man sich kaum vorstellen.
Und doch fügt die Arbeit, wie Freud schreibt, den Menschen „wenigstens in ein Stück der Realität, in die menschliche Gemeinschaft sicher ein“. Sie befähigt ihn nicht nur, „ein starkes Ausmaß libidinöser Komponenten, narzisstische, aggressive und selbst erotische, auf die Berufstätigkeit … zu verschieben“, sie ist auch unerlässlich „zur Behauptung und Rechtfertigung der Existenz in der Gesellschaft“.14 Hingegen ist es grausam und potenziell gefährlich, junge Menschen von der Arbeit abzuhalten. Da es sie von der meist wichtigsten Tätigkeit der Erwachsenen abhält, hindert es sie auch am Erwachsenwerden.
Nicht nur die Arbeitstätigkeit von Kindern wird eingeschränkt. In „fortschrittlichen“ Ländern vergeht wohl kein Tag, ohne dass ein Gesetz oder eine Verordnung erlassen wird, die sich speziell auf junge Menschen bezieht. Diese Vorschriften sollen ihnen helfen – in Wirklichkeit legen sie ihnen mannigfaltige Hindernisse in den Weg. Auf keinen Fall sollen sie einfach das tun, was Erwachsene tun. Und auf gar keinen Fall sollen sie mit den Erwachsenen in Konkurrenz treten und dadurch auch finanziell selbständiger werden. Kein Wunder, dass sie sich, von Jugendbanden abgesehen, selten organisieren und Eigeninitiative zeigen.
Ab den 1960er Jahren wurde diese Entwicklung durch die Einführung der Pille und die Verbreitung des Feminismus verstärkt und beschleunigt. Die Pille „befreite“ die Frauen, indem sie es ihnen ermöglichte, ohne Angst vor einer Schwangerschaft nach Herzenslust Sex zu haben. Feministinnen befürworten und verlangen die außerhäusliche Berufstätigkeit der Frau. Ironischerweise sind davon auch Tätigkeiten erfasst, die wieder auf die Betreuung der Kinder anderer Leute hinauslaufen, ob im Kindergarten, in der Schule oder als Kinderpsychologinnen, Sozialarbeiterinnen oder dergleichen. „Arbeit macht frei“, scheint das Motto zu sein. Für Betty Friedan, Simone de Beauvoir und andere führende Feministinnen hatten Frauen, die nicht berufstätig waren, eigentlich keine Daseinsberechtigung.15
Diese beiden Entwicklungsstränge erklären zu einem großen Teil, warum junge Leute immer später heiraten und auch immer später das erste Kind bekommen. Beide Ziffern waren zu Anfang des 21. Jahrhunderts so hoch wie nie zuvor.16 Es bedarf keiner Erwähnung, dass Eltern mit zunehmendem Alter mehr zur Vorsicht und Risikovermeidung neigen. Sie behaupten, zum Wohl der Kinder zu handeln, und unterwerfen sie einer Unzahl von Kontrollen und Verboten, von denen so manche zu Gerichtsverfahren und Aufständen führen würden, wären sie gegen Erwachsene gerichtet.
Eltern können die Kleidung oder den Haarschnitt der Jugendlichen kontrollieren. Sie können ihnen Zimmerarrest geben, d. h. ihnen verbieten, ihr Zimmer zu verlassen. Sie können ihre Privatsphäre verletzen, ihre Habseligkeiten durchsuchen und konfiszieren, ihnen das Taschengeld kürzen oder streichen. Sie können ihnen das Fahren mit dem Familienauto verbieten, ihren Zugang zum Telefon, zum Fernseher und/oder zum Internet überwachen und/oder sperren. Sie können ihnen vorschreiben, mit wem sie Kontakt haben dürfen und mit wem nicht. Sie können sie zum Sport oder zu anderen Betätigungen zwingen und sie gegen ihren Willen medizinisch behandeln lassen. Bis vor kurzem konnten Kinder und Jugendliche in den meisten Ländern sogar körperlich gezüchtigt werden. In manchen Ländern ist das noch immer der Fall.
Um sie vor sich selbst zu schützen, will man ihnen den Zugang zu den Social Media verbieten.17 Damit sie nicht dick werden, will man ihnen Softdrinks und etliche andere Nahrungsmittel verbieten, darunter natürlich viele, die sie besonders gerne mögen. Um diese Beschränkungen auch durchsetzen zu können, will man die Jugendlichen nach Möglichkeit auch vom entsprechenden Werbematerial fernhalten.18 Das Recht junger Frauen, ohne Zustimmung ihrer Eltern abzutreiben, wird beschränkt. Das ist nur eine logische Folge davon, dass freiwillige sexuelle Kontakte zwischen Minderjährigen verpönt sind und verboten werden. Die Gefühle Jugendlicher füreinander werden als „Schwärmerei“ abgetan. Nicht einmal die Fähigkeit zur wichtigsten menschlichen Gefühlsempfindung will man ihnen zugestehen.
Dabei dürfte Maria, die Frau, die Gott als Mutter seines Sohnes auserwählt hat, nicht älter als dreizehn oder vierzehn Jahre gewesen sein. Shakespeares Julia war dreizehn, Romeo war nicht viel älter. Auch das sollte uns nicht überraschen.
Hauptsächlich entscheidet die Geschlechtsreife darüber, in welchem Alter Mädchen beginnen, sich für Jungen zu interessieren, und umgekehrt. In den meisten vorindustriellen Gesellschaften wurde Sex im Jugendalter toleriert, oft wurde er sogar erwartet. Mädchen heirateten mit vierzehn oder fünfzehn und junge Männer mit achtzehn oder neunzehn.19 Nur in Westeuropa – und dort erst in der Renaissance – begann das Heiratsalter anzusteigen. Um 1900 heirateten Frauen mit achtzehn oder neunzehn und Männer Mitte oder Ende Zwanzig. Vor dem historischen Hintergrund war dieses Schema so ungewöhnlich, dass es „europäisches Heiratsmuster“ genannt wird.
Das steigende Heiratsalter in der westlichen Welt führte dazu, dass etwa ein Drittel der jungen Bräute schwanger vor den Altar trat.20 Die übrigen konnten erwarten, in weniger als einem Jahr ihr erstes Kind zu gebären. Der Gegensatz zu modernen westlichen Gesellschaften, die meist alles tun, um Jugendlichen den Sex zu verbieten, könnte nicht größer sein. All die erwähnten Einschränkungen – und noch viele andere – gelten Tag für Tag, ohne dass ein Gericht sie überprüft. Und doch gilt in der Erwachsenenwelt die sogenannte „judicial review“ als die Garantie für Freiheit, Unabhängigkeit und das Streben nach Glück.
Eine der Folgen der geschilderten Tendenzen ist das Phänomen der „Helikopter-Eltern“.21 Der Begriff kam kurz vor 2000 auf und wurde so beliebt, dass die Kurve, die seine Verbreitung anzeigt, fast senkrecht in die Höhe schnellte. Die meisten „Helikopter-Eltern“ kommen aus der Mittelklasse. Ihr erstes Ziel ist, sicherzustellen, dass der Nachwuchs nicht vom geraden Weg abkommt. Gleich danach kommt der Wunsch, ihm eine „gute Ausbildung“ mitzugeben. Damit ist gemeint, dass die Kinder in möglichst gute Schulen gehen und möglichst gute Noten bekommen sollen. Viele Eltern haben auch Schuldgefühle angesichts des Bildes perfekter Eltern, das in den Medien präsentiert wird.22 Folglich wollen sie ihre Kinder nicht aus den Augen lassen, üben Druck und vor allem Kontrolle aus, und zwar vierundzwanzig Stunden am Tag, denn auch schlechte Träume könnten ein Anzeichen für eine Fehlentwicklung sein.