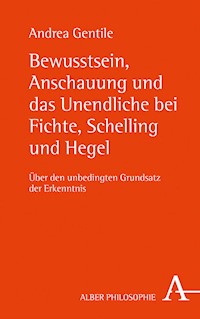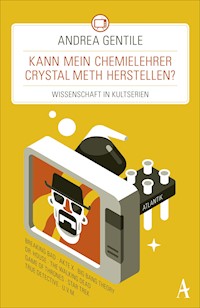
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wissenschaftlich geprüfter Stoff für alle Serienjunkies: Wie reagiert man nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen am besten auf eine Zombie-Epidemie à la Walking Dead? Könnte jeder Chemielehrer einfach so Crystal Meth produzieren wie Walter White in Breaking Bad? Wann ermöglicht die Wissenschaft das Teleportieren wie in Star Trek? Und was für eigentümliche klimatische Bedingungen herrschen eigentlich in Game of Thrones? Andrea Gentile stillt jeden Wissensdurst nach der nächsten Session Binge Watching. Mit vielen farbigen Illustrationen von Marco Goran Romano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Andrea Gentile
Kann mein Chemielehrer Crystal Meth herstellen?
Wissenschaft in Kultserien
Aus dem Italienischen von Johannes von Vacano
Atlantik
Einleitung
Die Zeiten des Fernsehens, wie Ihr es kanntet, sind vorbei. Fernsehzeitschriften, Uhrzeiten und wöchentliche Ausstrahlungen gehören ab jetzt der Vergangenheit an: Nicht das Fernsehen diktiert uns, wann wir was sehen können, sondern wir bestimmen selbst. Früher musste man sieben lange Tage warten, um endlich die nächste Folge von Emergency Room genießen zu können. Heute müssen wir nur den Fernseher einschalten, den Streaming-Dienst unseres Vertrauens auswählen und entscheiden, wie viele Folgen House of Cards wir uns zu Gemüte führen wollen. Dank des Internets ist das Fernsehen heutzutage ein gewaltiges virtuelles Archiv geworden, auf das wir nicht nur über unser TV-Gerät zugreifen können, sondern auch über unsere Computer, unsere Tablets und Smartphones. Wo und wann wir wollen können wir eine Serie aussuchen und alle verfügbaren Folgen ansehen. Mit Streaming-Diensten wie Netflix und Sky On Demand, Amazon Prime oder Watchever ist jeder Augenblick der richtige, um in eine andere Welt einzutauchen.
Millionen von Fans verfolgen auf diese Weise – teilweise auch mithilfe illegaler Downloads – Dutzende und Aberdutzende von Serien und stillen ihren Appetit auf mehr, indem sie eine Folge nach der anderen verschlingen. Durch dieses sogenannte Binge Watching (der englische Ausdruck »binge« bezeichnet dabei allerlei exzessiven Genuss, etwa von Alkohol – oder eben von Serien) verlieren auch die Einschaltquoten, bei denen ermittelt wird, wie viele Personen eine Sendung im Fernsehen verfolgen, langsam an Relevanz. Der Streaming-Anbieter Netflix beispielsweise beobachtet jede unserer Bewegungen. Er schlägt uns nicht nur vor, basierend auf einem hochkomplexen (und streng geheimen) Algorithmus, welche Inhalte uns ebenfalls gefallen könnten, sondern weiß auch immer ganz genau, wie viele Personen gerade eine bestimmte Serie schauen. Aus den zuletzt veröffentlichten Daten geht hervor, dass im Jahr 2015 die rund 75 Millionen Abonnenten von Netflix insgesamt 42,5 Milliarden Stunden an Filmen, Dokumentationen und Serien geschaut haben – das heißt, dass jeder einzelne von ihnen im Durchschnitt anderthalb Stunden pro Tag auf Netflix zugebracht hat.
Wir leben im Zeitalter von Big Data, daran ist nicht zu rütteln. Und die Wissenschaft kann sich der Analyse dieser Daten natürlich nicht verschließen. Einerseits liegen den Forschern immer mehr Daten darüber vor, wie wir fernsehen, und andererseits arbeiten sie konzentriert daran, handfeste Experimente zu entwickeln, um zu ergründen, was sich in unserem Gehirn abspielt, während wir einen Film oder eine Serie ansehen. Für den großen Alfred Hitchcock basierte die Produktion eines Films auf einer wissenschaftlich genauen Untersuchung der Reaktionen des Publikums. Und damit sah er bereits die Entstehung eines Forschungszweigs namens Neurocinema voraus. Vielleicht werden wir es auch und gerade dem Streaming zu verdanken haben, wenn wir endlich das Geheimnis der perfekten Fernsehserie lüften. Man muss sich nur einmal vor Augen halten, dass 75 Prozent der Menschen, die sich Breaking Bad auf Netflix angeschaut haben, die ganze erste Staffel am Stück gesehen haben.
Was hat diese Serie, die vom Leben des Chemielehrers Walter White erzählt, zu einer der größten der letzten Jahre gemacht? Und welche geheime Formel steckt hinter ihrem Erfolg? Das lässt sich kaum mit Gewissheit sagen, aber wir wollen hoffen, dass es – zumindest zu einem kleinen Teil – auch daran liegt, dass sie neugierig macht auf die geheimnisvolle Welt der Chemie.
Können zwei schräge Typen wirklich eine derart harte Droge wie Crystal Meth herstellen, noch dazu in einem Wohnmobil mitten im Nirgendwo? Das werden wir gemeinsam bei der Lektüre der folgenden Seiten herausfinden, auf einer Reise, in deren Verlauf wir enthüllen werden, wie viel Wahrheit in unseren liebsten Serien steckt. (Die einzelnen Stationen dieser Reise müssen keinesfalls in der hier gegebenen Reihenfolge abgeklappert werden, und auch die Verweise zwischen den Kapiteln sind höchstens als Anregung zu verstehen.)
Auf diesen Seiten, die das Ergebnis von stundenlangem, unermüdlichem Binge Watching im Namen der Wissenschaft darstellen, werden viele Serien vorüberflimmern, die von Science-Fiction und Fantasy handeln. Einige sind Klassiker, die uns etwas über Zeitmaschinen verraten, wie Doctor Who, oder über Reisen durch die unendlichen Weiten des Weltalls, wie Star Trek, oder aber uns, wie in Battlestar Galactica, die Grenzen des künstlichen Lebens offenbaren. Andere Serien verstehen es, die Genres aufzumischen und Science-Fiction meisterhaft mit Realismus zu verbinden: etwa Akte X mit seiner außerirdischen Verschwörung, das von Paralleluniversen umzingelte Fringe und nicht zuletzt Orphan Black, wo es von bösartigen Klonen nur so wimmelt.
Natürlich darf der beliebte Typus der Arztserien nicht fehlen, den uns die unmöglichen Diagnosen eines Dr. House nahebringen und über den die unglaubliche Zombie-Epidemie von The Walking Dead weit hinausführt. Es bleibt auch Raum für einen Hauch von Magie mit den Vampiren von True Blood oder dem verrückten Klima von Game of Thrones, nachdem wir uns mit dem Ursprung des Universums in The Big Bang Theory befasst und das Wesen der Zeit in True Detective beleuchtet haben.
Worauf wartet Ihr noch? Greift zur Fernbedienung und entscheidet selbst, mit welcher Serie Ihr anfangen wollt.
The Walking Dead
Erstausstrahlung:2010 (USA und Deutschland)
Staffeln:6 (noch nicht abgeschlossen)
Binge-Watch-Dauer:2 Tage, 21 Stunden und 18 Minuten
Inhalt: Deputy Sheriff Rick Grimes (Andrew Lincoln) wird im Einsatz bei einer Schießerei schwer verletzt und fällt ins Koma, aus dem er erst nach Wochen im Krankenhaus wieder erwacht. In der Zwischenzeit hat sich die Welt, die er kannte, radikal verändert. In seinem Heimatstädtchen King County im US-Bundesstaat Georgia treiben Zombies ihr Unwesen. Jeder Schritt wird zum Kampf ums Überleben. Nachdem er den ersten Untoten entkommen ist, macht Rick sich auf die Suche nach seiner Frau Lori (Sarah Wayne Callies) und seinem Sohn Carl (Chandler Riggs). Doch das ist erst der Anfang einer langen Reise durch das amerikanische Hinterland, das von einer geheimnisvollen Seuche heimgesucht wird. In dieser neuen Welt sind die Überlebenden oft gefährlicher als die »Beißer«.
Wir sind von Zombies umzingelt. In der Popkultur gibt es immer mehr Filme, Comics, Videospiele und Fernsehserien über die lebenden Toten, und mittlerweile erfreut sich das Genre einer nie dagewesenen Beliebtheit. The Walking Dead hat zweifellos zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen, eine Comic-Reihe, die seit 2003 bei Image Comics erscheint (und in Deutschland bei Cross Cult verlegt wird). Die blutrünstigen Geschichten sind der Phantasie von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adlard entsprungen. Die Geschichte rund um eine Gruppe von Überlebenden auf der Flucht vor einer Zombie-Epidemie, angeführt von Rick Grimes, hat bald darauf auch das Fernsehen erobert. 2010 feierte die Serie The Walking Dead auf dem US-amerikanischen Sender AMC ihr Debüt.
Zombies sind jedoch nicht erst mit den Fernsehserien entstanden, sondern kommen ursprünglich von sehr weit her, genauer gesagt aus Haiti, wo mächtige Hexer, sogenannte Bokor, die Körper der Toten wiederbelebten, um sie als Sklaven einzusetzen. Diese Zonbis, wie sie in der kreolischen Sprache der Insel genannt werden, gehören zur Tradition des Voodoo und haben nach Mary Shelleys Frankenstein und Richard Mathesons Ich bin Legende schließlich 1968 den Sprung auf die Leinwand gewagt. Sie sind die wahren Stars in Die Nacht der lebenden Toten von George A. Romero, dem Urvater aller Zombies. So wurde eine ganz eigene Sparte des Horrors aus der Taufe gehoben, bei der die Toten in einer apokalyptischen Welt ins Leben zurückkehren und zu einer Plage werden, die die Menschheit auszulöschen droht. Und genau da setzt auch die Serie The Walking Dead an.
Was tun bei einer Zombie-Epidemie?
Es mag seltsam klingen, doch die Zombies haben längst auch die Herzen von Ärzten, Physikern, Chemikern und Biologen erobert, die sich ihrerseits entschlossen haben, die Welt der lebenden Toten von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus weiter zu erforschen. Aus welchem Grund? Schlicht und ergreifend weil man mithilfe dieser Kreaturen viele Aspekte unseres realen Lebens unter die Lupe nehmen und gleichzeitig ein großes Publikum dafür begeistern kann. Ein Beispiel hierfür ist die Epidemiologie.
Die Epidemiologie ist das Gebiet der Medizin, das sich mit der Erforschung der Verbreitung und Häufigkeit von Krankheiten in der Bevölkerung befasst: von Tumoren über Fettleibigkeit, Ebola und Infarkten bis hin zu Diabetes. Sie überwacht zum Beispiel die verschiedenen Grippeviren, also nicht nur die jahreszeitlich bedingten Grippewellen, sondern auch die besonderen Stämme wie Schweine- oder Vogelgrippe, die die Ärzte und die Allgemeinheit besonders beunruhigen. Diese »Sonderüberwachung« ist nämlich genau jener Angst geschuldet, dass es zu einer erneuten Pandemie kommen könnte, also der weltweiten Ausbreitung einer Infektionskrankheit in einem äußerst kurzen Zeitraum und mit extrem vielen Krankheitsfällen. Als Beispiel genügt ein Hinweis auf das Humane Immundefizienz-Virus (HIV), das inzwischen überall auf der Welt auftritt und im Jahr 2014 über 1,2 Millionen Menschen getötet hat.
Stellen wir uns nun einmal einen neuen, ebenso gefährlichen wie unbekannten Erreger vor, der eine noch höhere Sterberate besitzt, womöglich allein durch einen Händedruck übertragen werden kann und nun auf einmal in einer weit entfernten Region unseres Planeten in Erscheinung tritt. Was, wenn ein solches Virus oder Bakterium in der Lage wäre, die Menschen in kürzester Zeit in lebende Tote zu verwandeln?
In The Walking Dead erfahren wir nicht, was genau geschehen und wie die Zombie-Epidemie entstanden ist. Allerdings äußert Dr. Edwin Jenner in der letzten Folge der ersten Staffel einige Theorien, kurz bevor er seinen Laborkomplex und damit das Herz der US-amerikanischen Epidemiologie in die Luft jagt – das Center for Disease Control and Prevention (CDC, Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten) in Atlanta. Jenner erwähnt einen Erreger, der das Gehirn befällt, ganz ähnlich der Entzündung, die die schützenden Membranen unseres Nervensystems angreifen kann, besser bekannt als Hirnhautentzündung oder Meningitis. Doch nicht einmal er, der kompetenteste Wissenschaftler der ganzen Serie, kann sagen, ob diese Entzündung von einem Bakterium, einem Parasiten oder einem Virus ausgelöst wird (wenngleich das rundliche Gebilde, das genetisches Material enthalten soll und auf den Bildschirmen des CDC zu sehen ist, nahelegt, dass es sich um ein Virus handeln müsste). Und auch Kirkman, der Autor der Serie, scheint nicht genau zu wissen, worum es sich handelt, aber er hat augenscheinlich auch keinerlei Interesse daran, Details zu offenbaren: Er will einfach eine Geschichte erzählen, und seiner Meinung nach ist der Urheber der Epidemie weitaus weniger interessant als ihre Folgen. Wir wissen bislang nur, dass dieser Erreger bereits alle Menschen infiziert hat und nur darauf wartet, mit dem Tod des Opfers (der womöglich durch den Biss eines Zombies verursacht wird) die Kontrolle übernehmen zu können. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Infektionserreger, der über die Luft oder, wie manch einer im Internet vermutet, über das Trinkwasser oder die Nahrung übertragen wird.
Die Wissenschaftler der realen Welt haben sich ebenfalls hauptsächlich auf die Entwicklung und die Folgen einer solchen Zombie-Epidemie konzentriert. Wir schreiben das Jahr 2009. In der Zeitschrift Infectious Disease Modelling Research Progress erscheint ein Artikel, der in die Geschichte der Zombie-Wissenschaft eingehen wird. Eine Gruppe kanadischer Mathematiker (Philip Munz und Ioan Hudea von der Carlton University sowie Joe Imad und Robert J. Smith von der University of Ottawa) hat darin erstmalig eine realistische Darstellung vorgestellt, ein sogenanntes mathematisches Modell, das anhand von Zahlen die Entwicklung einer Zombie-Epidemie veranschaulicht.
Im Grunde haben die Wissenschaftler kurzerhand die Konzepte der Epidemiologie auf Zombies angewandt. Zunächst haben sie die allgemeinen Rahmenbedingungen ihrer Fragestellung definiert: Ein gesunder Mensch, der von einem Zombie gebissen wird, kann selbst zu einem Untoten werden, der seinerseits die Krankheit überträgt. Außerdem kann eine gesunde Person, die an natürlichen (oder unnatürlichen) Ursachen stirbt, als Zombie wiederauferstehen. Dasselbe kann, zumindest in ihrem Modell, auch ein bereits gekillter Zombie. Wir haben nun also drei große Kategorien vor uns: die Anfälligen (S, von Susceptibles, gesunde Menschen), die Zombies (Z, die lebenden Toten) sowie die Entfernten (R, von Removed, Verstorbene, die als Zombies wiederauferstehen können). Jetzt müssen wir nur noch eine Reihe von mathematischen Gesetzmäßigkeiten aufstellen, die den Übergang von einer Kategorie zur nächsten regeln. Dabei hängt die Wahrscheinlichkeit, mit der sich beispielsweise ein Individuum der Gruppe S in ein Z verwandelt, davon ab, wie viele Zombies und Gesunde sich derzeit in der Population befinden.
Sobald die Kategorien und die Regeln, denen sie unterworfen sind, feststehen, ist unser sogenanntes SZR-Modell fertig. Es handelt sich dabei um ein theoretisches Konstrukt, das an einen Klassiker der Epidemiologie angelehnt ist, das sogenannte SIR-Modell, bei dem allerdings anstelle der Zombies die Infizierten (I, für Infected) stehen. Diese Abbildungsform ist sehr vielseitig, auch weil sie ganz leicht erweitert werden kann, um das Modell noch detaillierter und komplexer zu gestalten. Tatsächlich haben unsere kanadischen Wissenschaftler sich auch entschlossen, noch eine eigene Kategorie einzuführen: I – Personen, die der Infektion ausgesetzt worden sind, sich aber noch nicht in Zombies verwandelt haben und eine Latenzzeit von 24 Stunden aufweisen.
Basierend auf diesem neuen SIZR-Modell haben die Mathematiker einen Computer mit den entsprechenden Gleichungen gefüttert, um eine Zombie-Epidemie zu simulieren. Die Ergebnisse dürften allerdings nicht gerade beruhigend für die Menschheit sein. Unter der Prämisse, dass niemand etwas unternimmt, sprechen die Zahlen eine sehr deutliche Sprache: Kommt es zu einer Pandemie, erobern die Zombies den Planeten im Handumdrehen.
Also haben die Wissenschaftler sich überlegt, auch alternative Szenarien zu untersuchen, wie etwa den möglichen Verlauf unter Einsatz von Quarantäne. Könnten wir uns retten, indem wir Zombies und Infizierte so schnell wie möglich isolieren? Wieder ist die Antwort eher deprimierend: Wenn wir zu Beginn einen hohen Prozentsatz der infizierten Personen unter Quarantäne stellen, können wir der Epidemie etwas besser standhalten – aber den unvermeidlichen Untergang zögern wir damit nur hinaus. Ganz abgesehen davon, dass diese Option im Chaos eines unvermittelten Ausbruchs wenig wahrscheinlich ist. Laut Modell gibt es nur eine Möglichkeit, wie die Menschheit überleben könnte: Wir müssten die Zombies immer wieder angreifen und eine immer größere Anzahl von ihnen vernichten, sobald die Ressourcen dafür vorhanden sind. So könnten wir, verspricht die Simulation, in nur wenigen Wochen 100 Prozent der Untoten ausschalten. Die Studie diskutiert als weitere Alternative auch ein Zombie-Heilmittel, jedoch verspricht selbst das nur einen Teilerfolg: Wäre es möglich, die Zombies zu behandeln und wieder in einen lebenden menschlichen Zustand zu versetzen, ohne dabei jedoch eine Immunität zu erreichen (geheilte Individuen würden bei erneutem Kontakt mit der Infektion, wie alle anderen auch, wieder zu Zombies werden), könnten wir zwar unserer Auslöschung entgehen, aber doch nur in kleinen Gruppen überleben.
Ausgehend von den Arbeiten der Kanadier haben sich viele Wissenschaftler darangemacht, zunehmend komplexe Modelle für Zombie-Katastrophen zu entwerfen. Die einen haben versucht, die apokalyptischen Zustände aus Romeros Nacht der lebenden Toten oder Edgar Wrights Parodie Shaun of the Dead abzubilden, während andere sich auf realistischere Szenarien konzentriert haben. So hat sich beispielsweise eine Forschergruppe der Cornell University dafür entschieden, eine Zombie-Epidemie in den gesamten Vereinigten Staaten zu simulieren, und hierfür den virtuellen Untoten eine ganz grundlegende Eigenschaft verliehen: Bewegung. Alexander Alemi und seine Kollegen haben für ihre kürzlich veröffentliche Studie ein SIZR-Modell verwendet, das dem von Munz & Co. recht ähnlich ist, und ihre Zombies auf eine Karte der Vereinigten Staaten losgelassen, in die mehr als 11 Millionen einzelne Häuserblocks eingetragen wurden, basierend auf den Daten einer Volkszählung von 2010. Das ergab eine Verteilung von knapp 307 Millionen Menschen auf ein Gitternetz mit 1500 Spalten und 900 Zeilen. Der zusätzliche räumliche Faktor hat der Simulation zu größerer Präzision verholfen, weil so Zombies und Anfällige nur miteinander agieren konnten, wenn sie sich in demselben Feld auf dem Gitternetz befanden. Die Wissenschaftler haben die Geschwindigkeit der Untoten auf Grundlage der beliebtesten Zombiefilme geschätzt und sie auf rund 30 Zentimeter pro Sekunde festgelegt.
Was würde also geschehen, wenn unter der Gesamtbevölkerung 300 zufällig ausgewählte Menschen an zufällig bestimmten Orten gleichzeitig einer initialen Infektion mit dem Zombie-Virus ausgesetzt werden sollten? Der Großteil der virtuellen Bevölkerung würde den unschönen Wandel vom Menschen zum lebenden Toten innerhalb der ersten Woche durchlaufen. Während der Simulation hat sich nämlich gezeigt, dass sich die Epidemie zu Beginn in gleichmäßigen Kreisen ausbreitet, während erst in einer späteren, zweiten Phase eine gewisse Uneinheitlichkeit festzustellen war, die mit der unterschiedlichen Bevölkerungsdichte zusammenhängt. Die dicht besiedelten Küsten würden als Erste fallen, während die zentralen Gebiete noch standhalten könnten. Nach nur einem Monat, so Alemi und seine Kollegen, wären die Vereinigten Staaten in die Knie gezwungen, aber es würde sehr lange dauern, bis tatsächlich die gesamte Bevölkerung ausgelöscht worden sei. Nach vier Monaten gäbe es abgeschiedene Bereiche in den Bundesstaaten Montana und Nevada, in die noch immer kein Zombie gelangt wäre. Und wie würde es dem schönen Georgia ergehen, das als Kulisse für die Geschehnisse in The Walking Dead dient? Laut der Karte der US-amerikanischen Physiker bietet der Bundesstaat eine mittlere Überlebenschance von zwei bis vier Wochen, was sich letztlich ungefähr mit dem Umfeld der Geschichte von Rick Grimes und seiner Gruppe deckt.
Was spielt sich im Gehirn eines Zombies ab?
Führen wir ein kleines Experiment durch: Wenn wir einen gesunden Menschen und den am wenigsten verwesten Zombie, den wir auftreiben können, nebeneinanderstellen, worin besteht der wesentliche Unterschied zwischen den beiden? Richtig, darin, dass der Untote sich sofort auf den armen Kerl stürzt, um ihm das Fleisch von den Knochen zu reißen. Das ist nicht die feine englische Art, noch dazu ohne die geringste Begrüßung. Woher rührt dieser unaufhaltsame Drang, die Lebenden zu verspeisen? Und was ist mit all den anderen Eigenschaften, die die sogenannten Beißer in Robert Kirkmans Serie an den Tag legen?
Die Gründe für das Verhalten der Zombies sind in ihrem Gehirn zu suchen. Kein Geringerer als der bereits erwähnte Dr. Jenner versucht es zu erklären. Er zeigt uns dafür (mithilfe von Gerätschaften, die es heute noch gar nicht gibt) die elektrischen Impulse, die durch die kleinen grauen Zellen einer infizierten Person sausen, von Neuron zu Neuron, wie kleine Lichtblitze. »Was sind das für Lichter?«, fragt einer der Überlebenden angesichts des wimmelnden Spektakels. »Das Leben eines Menschen. Seine Erfahrungen, seine Erinnerungen. Und genau da, irgendwo zwischen diesen organischen Verdrahtungen, diesen Lichtwellen, steckt das Ich. Das, was uns einzigartig macht – und menschlich.« Mit dem Tod, fährt Dr. Jenner fort, gehen all diese Lichter aus und das, was das Ich des Menschen ausmacht, verschwindet für immer. Doch die Infektion haucht einem wieder eine gewisse Form von Leben ein, ein schwaches Flimmern in den Nervenbahnen. Dabei wird allerdings nicht das gesamte Gehirn von reaktivierten Neuronen erleuchtet, wie man auf Jenners Aufnahmen sehen kann, sondern nur der Hirnstamm. Das ist der Bereich, der sich im Zentrum unseres Gehirns befindet und von dem die Verzweigungen ausgehen, die die äußeren Schichten bilden, die sogenannte Großhirnrinde, auch Cortex genannt. Der Hirnstamm ist evolutionsgeschichtlich betrachtet ein alter Teil des Gehirns, in dem sehr grundlegende Funktionen verankert sind, wie etwa die Steuerung von Reflexen, Atmung und Körpertemperatur. Ist ein Zombie vorstellbar, der ausschließlich vom Hirnstamm geleitet in der Lage sein soll, zu gehen, Menschen zu jagen und zu verzehren? Wohl kaum – und das sollte schon zeigen, dass etwas mit Jenners Theorie nicht stimmen kann.
Tatsächlich kann eine Krankheit, die die Toten wiederauferstehen lässt, unmöglich fast das ganze Gehirn ausschalten, denn aufzustehen und einen Schritt vor den anderen zu setzen, um einen Menschen zu verfolgen, sind viel zu komplexe Vorgänge, als dass sie ohne die Koordination der höheren Hirnfunktionen zustande kommen könnten. Bei der Lösung dieses Rätsels eilen uns zwei Neurowissenschaftler von der University of California zu Hilfe, Timothy Verstynen und Bradley Voytek. Sie haben 2014 ein Buch veröffentlicht mit dem schönen Titel: Do Zombies Dream of Undead Sheep? A Neuroscientific View of the Zombie Brain (Träumen Zombies von untoten Schafen? Eine neurowissenschaftliche Betrachtung des Zombie-Gehirns). Die Autoren sprechen darin allgemein von einer selektiven zerebralen Atrophie, also einem Gewebsschwund, der nur bestimmte Bereiche des Gehirns aus dem Verkehr zieht. Sie stellen die Theorie einer Zombie-Krankheit auf, die sie Consciousness Deficit Hypoactivity Disorder (CDHD, Bewusstseins-Defizit-Hypoaktivitäts-Störung) getauft haben, in Anspielung auf die inzwischen zu trauriger Berühmtheit gelangte Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS bzw. engl. ADHD). In diesem Fall beinhalten die Symptome allerdings den Verlust eines bewussten und rationalen Verhaltens, das ersetzt wird durch Aggressivität, eine allein von Reizen gesteuerte Wahrnehmung, die Unfähigkeit der motorischen und sprachlichen Koordination sowie ein unstillbares Verlangen nach menschlichem Fleisch. Allesamt Verhaltensweisen, die sich mit Hirnschäden erklären lassen – abgesehen von dem zwanghaften Kannibalismus natürlich.
So können etwa die eher ziellosen Bewegungen der Zombies auf eine Fehlfunktion des Kleinhirns zurückgeführt werden. Dieser Bereich, der sich unmittelbar über unserem Nacken befindet, ist nämlich in erster Linie dafür zuständig, all unsere Bewegungen zu koordinieren. Indem er darüber hinaus Impulse von unseren Sinnesorganen empfängt und verarbeitet, kann er dem restlichen Gehirn dabei helfen, unsere Muskeln zielgerichtet in Bewegung zu setzen. Eine Beschädigung des Kleinhirns kann also unkoordinierte und steife Bewegungen sowie Probleme mit dem Gleichgewicht hervorrufen, ganz wie bei unseren Zombies.
Und was ist mit einfachen Worten? Es hat keinen Zweck, einen Zombie mit einem rhetorisch ausgefeilten Erguss zur Umkehr bewegen zu wollen, er wird dennoch an eurer Wade knabbern. In diesem Fall müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die linke Hirnhälfte richten, in der sich – zumindest bei Rechtshändern – die Bereiche befinden, die sich um unsere Sprache kümmern. Im linken Temporallappen, der sich ungefähr vom Haaransatz an der Schläfe bis zum Hinterkopf erstreckt und oberhalb des Ohres verläuft, befinden sich nämlich zwei kleine Bereiche, die erklären könnten, weshalb die lebenden Toten nicht sprechen können. Der eine ist das Wernicke-Areal, dessen Beeinträchtigung eine Aphasie hervorrufen kann, die sinnvolles Sprechen verhindert: Die verwendeten Wörter haben nichts mehr miteinander zu tun und ergeben keinerlei Sinn. Außerdem ist eine Aphasie mit schwerwiegenden Verständnisstörungen verbunden. Schäden am anderen Bereich, dem sogenannten Broca-Areal, führen hingegen zu einem stockenden Redefluss, mit Wortfindungsstörungen und fehlerhafter Grammatik. Wenn wir uns nun vorstellen, dass womöglich beide Areale atrophiert sind, lässt sich nachvollziehen, weshalb die Zombies sich nur mithilfe sinnloser Laute ausdrücken können.
Zu den interessantesten Wesensmerkmalen der Untoten gehört schließlich ihre Aggressivität und ihr gänzlicher Mangel an Selbstkontrolle: Erblicken sie lebendes Fleisch, gibt es kein Halten mehr. Sie müssen um jeden Preis an die Köstlichkeit gelangen und setzen dabei ohne zu zögern die eigene Sicherheit aufs Spiel. Ein derart unüberlegtes Verhalten kann von Schäden in einem Bereich herrühren, der für uns Menschen äußerst wichtig ist: der präfrontale Cortex, der sich, wie der Name schon nahelegt, unmittelbar hinter unserer Stirn befindet. Hier sitzt nicht nur unsere Fähigkeit zur Planung, um ein Ziel zu erreichen, sondern auch der Mechanismus, mit dem wir augenblickliche Bedürfnisse unterdrücken können, bis der richtige Moment gekommen ist, sie zu befriedigen. Das ermöglicht uns etwa, trotz einer unbändigen Lust auf Eiscreme an unsere Linie zu denken und nicht eine ganze Packung Stracciatella auf einmal zu verdrücken (ganz recht, Schäden am präfrontalen Cortex können auch zu Ernährungsstörungen führen). Dieser Bereich verfügt außerdem über die Macht, die mit Emotionen verbundenen Areale unseres Gehirns genauestens zu überwachen. Fehlt diese Hemmung, wird unser Verhalten deutlich impulsiver und auch rabiater. Da denken wir doch gleich an unsere untoten Freunde.
Gibt es Zombies wirklich?
Zombies sind Produkte unserer Phantasie, wieso sollte man weiter um den heißen Brei herumreden? Es gibt schlichtweg keinen Krankheitserreger, der in der Lage wäre, uns von den Toten auferstehen zu lassen, unser Bewusstsein vollständig auszulöschen, die Kontrolle über unseren Körper zu übernehmen und uns dazu zu bringen, uns so bizarr zu verhalten. Bezüglich der Auferweckung von den Toten bestehen tatsächlich keinerlei Zweifel, aber was die anderen Dinge anbelangt, sollten wir vielleicht etwas vorsichtiger sein. Schließlich werden wir manchmal kontrolliert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, und häufig ist dafür eine ganze Welt von Organismen verantwortlich, die mit uns zusammenlebt: das sogenannte Mikrobiom.
In den letzten Jahren hat sich die Wissenschaft verstärkt der Erforschung des Mikrobioms verschrieben. Es bezeichnet die Gemeinschaft von Mikroorganismen, die in der Regel ungefährlich sind und auf demselben Raum leben wie wir. Man muss sich das einmal vorstellen: Auf uns und rings um uns befinden sich genauso viele Bakterien und Pilze, wie wir Zellen im Körper haben. Da wäre es doch seltsam, wenn all das keinerlei Einfluss auf die Funktionsweise unseres Körpers nehmen würde. Mikroorganismen sind überall: in der Beuge unseres Ellenbogens, in unserer Nase, in unserem Speichel, in unserem Gehörgang, zwischen unseren Zehen, in unserem Darm und unserem Magen. Das klassischste und vielleicht bekannteste Bakterium trägt den melodischen Namen Escherichia coli. Ein ungefährlicher Stamm dieses kleinen Organismus lebt unbeschwert in unserem Verdauungstrakt, wo es die Verdauung fördert und uns vor dem Befall mit anderen Krankheitserregern schützt.
Wissenschaftler vermuten, dass gerade die Bakterien, mit denen wir zusammenleben, zur Herstellung chemischer Verbindungen fähig sind, die unser Gehirn beeinflussen können. Forscher der McMaster University haben beispielsweise 2011 eine Studie in der Fachzeitschrift Gastroenterology veröffentlicht. Darin kann man nachlesen, was geschehen ist, als sie einigen Mäusen Antibiotika gegeben haben, die die bakterielle Darmflora vernichten sollten. Die behandelten Tiere verhielten sich weniger nervös und deutlich wagemutiger. Das änderte sich wieder, als die Medikamente abgesetzt wurden. Kurz gesagt: Die Bakterien kontrollierten ihr Verhalten.
Ganz zu schweigen von anderen Mikroorganismen. Ein bestimmter Streptokokken-Stamm, der normalerweise wenig mehr als Halsschmerzen verursacht, kann beispielsweise bei Kindern Zwangsstörungen auslösen. So geschehen im Falle von Sammy Maloney, einem zwölfjährigen US-Amerikaner, der 2002 auf einmal einen Persönlichkeitswandel durchmachte. Er betrat und verließ das Haus nur noch durch die Hintertür, trug ausschließlich bestimmte Kleidung und bestand darauf, dass das Licht immer eingeschaltet bleiben sollte. Anfänglich wurde bei dem Jungen das Tourette-Syndrom diagnostiziert, aber ein Test offenbarte, dass eine Streptokokken-Infektion vorlag. Nach einer Behandlung mit Antibiotika kehrte alles in den Normalzustand zurück. Der Grund dafür ist, dass die Antikörper, die das entsprechende Bakterium bekämpfen, auf einige Bereiche des Gehirns einwirken können, die unsere Bewegungen kontrollieren. Diese Bereiche können einen bestimmten Neurotransmitter namens Dopamin ausschütten, der mit Ticks und Verhaltensstörungen in Verbindung gebracht wird.
Nicht alle Bakterien führen jedoch Böses im Schilde. Das Mycobacterium vaccae, ein Mikroorganismus, der im Boden lebt, beschenkt uns beispielsweise mit Freude und Glücksgefühlen. In einer 2007 in Neuroscience veröffentlichten Studie haben Forscher von der University of Bristol nachweisen können, dass Mäuse, denen dieses Bakterium injiziert wurde, eine höhere Aktivierung von ganz besonderen Neuronen aufweisen: Diese Neuronen produzieren Serotonin, den Botenstoff der guten Laune. Eröffnen sich da der Pharmaindustrie womöglich ganz neue Möglichkeiten für Antidepressiva? Das wird sich zeigen.
Verlassen wir die Welt der Menschen für einen Augenblick, dann lassen sich haufenweise Zombies finden. In der Natur gibt es nämlich die unterschiedlichsten Beispiele für unbewusste Verhaltensweisen und wandelnde Tote. Etwa die Juwelwespe (Ampulex compressa), ein verschlagenes Insekt, das in Afrika, im Süden Asiens und auf den pazifischen Inseln lebt und in der Lage ist, Schaben zu kontrollieren. Während der Brutzeit sucht sich diese außergewöhnliche Wespe eine Schabe aus und greift sie an, obwohl sie viel kleiner ist als ihr Opfer. Zunächst verabreicht sie der Schabe ein Gift, das deren Beine lähmt. Sobald die Schabe paralysiert ist, spielt die Wespe Neurochirurg und sticht in einen ganz bestimmten Bereich des Gehirns, in den sie eine Substanz injiziert, die ihr Opfer gewissermaßen zum Zombie macht: Es handelt sich bei diesem Stoff um eine chemische Verbindung, die die Wirkung des Dopamins blockiert, also genau jenes Botenstoffs, der, wie wir bereits gesehen haben, viel mit der Bewegung und der Wahrnehmung zu tun hat. Jetzt ist die Schabe aufgeschmissen. Sie kann sich zwar noch bewegen, aber nicht nach ihrem eigenen Willen. Die Wespe zerrt an den Fühlern ihres selbstgemachten Zombies, der ihr so gehorsam bis in ihren Bau folgt. Dort angekommen, legt die Wespe ein Ei direkt im Inneren der Schabe ab, bevor sie die kleine Höhle von außen verschließt. Die Larve wächst im Körper der willenlosen Kakerlake heran und ernährt sich von ihren inneren Organen, bis die Schabe verendet und nach etwa vier bis sieben Wochen eine neue Juwelwespe schlüpft.
Ein weiteres Beispiel ist der Parasit Toxoplasma gondii, der nicht nur Toxoplasmose im Menschen hervorrufen kann, sondern sich auch besonders gerne im Verdauungstrakt von Katzen vermehrt. Um dorthin zu gelangen, bedient er sich einer ziemlich einfallsreichen Taktik: Befindet sich der Parasit im Körper einer Maus, nimmt er dem armen Tier einen Großteil seiner Angst vor seinen Jägern und sorgt außerdem dafür, dass die Maus sich von Katzenurin angezogen fühlt. Eine Maus, die keine Angst vor Katzen hat und sich nicht von Orten fernhalten kann, an denen diese ihr Geschäft verrichten, ist so gut wie verloren. Indem der Parasit das Verhalten seines Wirts modifiziert und ihn zu einer Art Halb-Zombie macht, schafft er es in den Magen der Katze, wo er sich nun reproduzieren kann. Wenn also das nächste Mal jemand sagt, Zombies seien doch nichts weiter als ein Phantasieprodukt, haben wir jetzt mehr als eine gute Antwort parat.
10 Dinge, die man über The Walking Dead wissen sollte
1.
Die Figur des Dr. Edward Jenner ist eine Hommage an einen echten Wissenschaftler: Edward Jenner entwickelte Ende des 18. Jahrhunderts die Pockenimpfung.
2.
Daryl Dixons erste Armbrust ist eine Horton Scout HD125 und kostet etwa 300 Dollar. Der Darsteller Norman Reedus hing so sehr an der Waffe, dass er sie nach den Dreharbeiten immer mit nach Hause nahm.
3.
Wann immer eine der Hauptfiguren der Serie stirbt, wird am Ende des Drehtages ein letztes großes Abschiedsabendessen veranstaltet (bei dem nicht der Verstorbene auf dem Speiseplan steht!).
4.