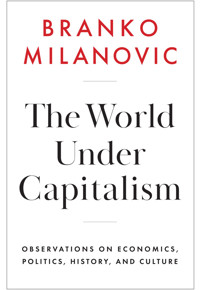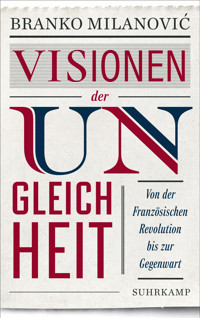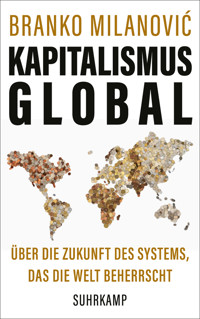
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zum ersten Mal in der Geschichte dominiert ein einziges Wirtschaftssystem den Globus. Von Peking bis Porto Alegre: Ob es uns gefällt oder nicht, heute sind wir alle Kapitalisten. Das Mantra der Alternativlosigkeit gehört längst zum rhetorischen Standardrepertoire von Politikern jeder Couleur. Warum konnte sich der Kapitalismus gegen den Kommunismus durchsetzen? Wie steht es um die Aussichten auf eine gerechtere Welt, nun, da seine Vorherrschaft ohne Konkurrenz ist?
Spätestens seit der Finanzkrise zeichnet sich ab, dass zwei Ausprägungen im Wettstreit miteinander liegen: ein liberaler Kapitalismus, der mit rechtsstaatlichen Prinzipien und Demokratie einhergeht, und ein autoritärer, in dem Vetternwirtschaft und politische Willkür an der Tagesordnung sind. Wenn es nicht gelingt, so Milanović, Herausforderungen und Probleme wie Ungleichheit, Migration oder Korruption zu meistern, ist nicht nur die liberale Wirtschaftsordnung, sondern auch die Demokratie in Gefahr. Aber der Kapitalismus ist ein von Menschen gemachtes System: Unsere Entscheidungen bestimmen, welche Form er in Zukunft annimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Branko Milanović
Kapitalismus global
Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
1 Die Welt nach dem Kalten Krieg
1.1 Der Kapitalismus als einziges sozioökonomisches System
1.2 Der Aufstieg Asiens und die Wiederherstellung des globalen Gleichgewichts
2 Liberaler meritokratischer Kapitalismus
2.1 Schlüsselmerkmale des liberalen meritokratischen Kapitalismus
2.1a Historische Formen des Kapitalismus
2.1b Systemische und nicht systemische Ursachen der wachsenden Ungleichheit im liberalen meritokratischen Kapitalismus
2.2 Systemische Ungleichheiten
2.2a Steigender Anteil der Kapitaleinkünfte am Nationaleinkommen
2.2b Hohe Konzentration des Kapitalbesitzes
2.2c Höhere Vermögensrenditen für die Reichen
2.2d Personen mit hohem Kapitaleinkommen sowie mit hohem Arbeitseinkommen
2.2e Zunehmende Homogamie (assortative Partnerwahl)
2.2f Verstärkte Übertragung von Einkommen und Vermögen über die Generationen hinweg
2.3 Neue sozialpolitische Maßnahmen
2.3a Warum die Werkzeuge aus dem 20. Jahrhundert ungeeignet sind, um der Einkommensungleichheit im 21. Jahrhundert entgegenzuwirken
2.3b Der Wohlfahrtsstaat in der Ära der Globalisierung
2.4 Eine sich verfestigende Oberschicht?
3 Politischer Kapitalismus
3.1 Der Platz des Kommunismus in der Geschichte
3.1a Weder die marxistische noch die liberale Interpretation sind geeignet, die historische Rolle des Kommunismus zu erklären
3.1b Die Einordnung des Kommunismus in die Geschichte des 20. Jahrhunderts
3.2 Warum bedurfte es kommunistischer Revolutionen, um den Kapitalismus in Teile der Dritten Welt zu bringen?
3.2a Die Rolle der kommunistischen Revolutionen in der Dritten Welt
3.2b Wo war der Kommunismus erfolgreich?
3.2c Ist China kapitalistisch?
3.3 Schlüsselmerkmale des politischen Kapitalismus
3.3a Drei systemische Merkmale und zwei systemische Widersprüche
3.3b In welchen Ländern existieren Systeme des politischen Kapitalismus?
3.4 Ein Überblick über die Ungleichheit in China
3.4a Stetig wachsende Ungleichheit
3.4b Korruption und Ungleichheit
3.5 Dauerhaftigkeit und globale Attraktivität des politischen Kapitalismus
3.5a Wird das Bürgertum jemals China regieren?
3.5b Wird China den politischen Kapitalismus »exportieren«?
4 Die Interaktion von Kapitalismus und Globalisierung
4.1 Arbeit: Migration
4.1a Definition des Ortsbonus (der ortsabhängigen wirtschaftlichen Rente)
4.1b Die Staatsbürgerschaft als wirtschaftlicher Vermögenswert
4.1c Bewegungsfreiheit der Produktionsfaktoren
4.1d Ausgleich zwischen Sorgen der Einheimischen und Wünschen der Zuwanderer
4.2 Kapital: Globale Wertschöpfungsketten
4.3 Der Wohlfahrtsstaat: Seine Überlebenschancen
4.4 Weltweite Korruption
4.4a Drei Gründe für Korruption in der Globalisierungsära
4.4b Warum fast nichts getan wird, um die Korruption einzudämmen
5 Die Zukunft des globalen Kapitalismus
5.1 Die unvermeidliche Amoralität des hyperkommerzialisierten Kapitalismus
5.1a Max Webers Kapitalismus
5.1b Auslagerung der Moralität
5.1c »Es gibt keine Alternative«
5.2 Atomisierung und Kommodifizierung
5.2a Schwindender Nutzen der Familie
5.2b Das Privatleben als alltäglicher Kapitalismus
5.2c Die Herrschaft des Kapitalismus
5.3 Unbegründete Furcht vor technologischem Fortschritt
5.3a Der Trugschluss der feststehenden Arbeitsmenge und unsere Unfähigkeit, uns die Zukunft vorzustellen
5.3b Probleme des bedingungslosen Grundeinkommens
5.4 Luxe et volupté
5.4a Zwei Szenarien: Krieg und Frieden
5.4b Politischer Kapitalismus oder liberaler Kapitalismus?
5.4c Globale Ungleichheit und geopolitische Veränderungen
5.4d Abschließende Bemerkungen zu einem möglichen Gesellschaftssystem, das aus den Argumenten im Buch folgen kann
Anhang A Der Platz des Kommunismus in der Weltgeschichte
Anhang B Hyperkommerzialisierung und Adam Smith' »unsichtbare Hand«
Anhang C Einige methodologische Punkte und Definitionen
Messung der globalen Ungleichheit
Messung des Kapitalanteils am gesamten Nettoeinkommen
Einkommenskonvergenz
Dank
Bibliographie
Personenregister
Sachregister
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
64
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
150
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
361
362
363
364
365
367
368
372
377
378
388
400
327
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
7Vorwort zur deutschen Ausgabe
Ich schreibe dieses Vorwort inmitten der Covid-19-Pandemie. Wir wissen nicht, wann und wie wir das Virus unter Kontrolle bringen werden, aber bereits jetzt scheint klar, dass wir nach der Pandemie in einer anderen Welt leben werden. Anfangs glaubten manche Leute, Beginn und Ende der Pandemie würden wie Lichtschalter sein: Covid-19 wurde im Dezember 2019 eingeschaltet, und sobald die Pandemie irgendwann ausgeschaltet war, würde die Welt wieder in den Zustand zurückkehren, in dem sie sich im Dezember 2019 befunden hatte. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht so sein wird.
Ich glaube, dass die Pandemie die Welt in dreierlei Hinsicht erheblich verändern wird. Alle drei Veränderungen können anhand des in diesem Buch verwendeten analytischen Rahmens und der hier vorgebrachten Argumente beurteilt werden. Erstens wird die Pandemie die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie allgemein zwischen dem liberalen und dem politischen Kapitalismus verstärken. Zweitens wird sie sich auf den Fortschritt der Globalisierung auswirken, weil sie klar gezeigt hat, wie fragil die Annahmen sind, auf denen die globalen Wertschöpfungsketten beruhen. Drittens wird sie den Einfluss des Staates auf das Wirtschaftsleben erhöhen. Ich werde mich im Folgenden mit jeder dieser Veränderungen im Einzelnen befassen.
Der Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und China ist nicht mehr auf Handelskriege und Strafzölle beschränkt, sondern nimmt die Form eines direkten ideologischen und, was noch bedrohlicher ist, eines militärischen Wettbewerbs an. Mit den Einzelheiten der Verschärfung dieses Konflikts – vom Vorwurf der Desinformation über den Covid-19-Ausbruch in China bis zur Unterdrückung der Autonomie Hongkongs – müssen 8wir uns hier nicht beschäftigen, denn wir werden täglich in den Nachrichten darüber informiert.
Entscheidend ist, wie die beiden Systeme auf die Corona-Krise reagiert haben und welches System am Ende in den Augen der Weltöffentlichkeit besser dastehen wird. Was das anbelangt, hat China die Vereinigten Staaten eindeutig überflügelt, und zwar sowohl gemessen an der Fähigkeit zur Eindämmung des Virus als auch an den Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaft. Dieses Ergebnis hatte kaum jemand erwartet. Die Vereinigten Staaten sind nicht nur technologisch das am höchsten entwickelte Land der Welt, in dem es Hunderte medizinische Hochschulen mit vermutlich Tausenden Professoren gibt, sondern man hätte meinen sollen, dass ihr demokratisches System der Regierung größere Anreize geben würde, das Leben ihrer Bürger zu schützen und zu retten. Das Gegenteil ist geschehen.
Die Einstellung zur Rettung von Menschenleben ist ein wesentlicher Punkt. Warum waren die Vereinigten Staaten gleichgültig gegenüber den Todesopfern, während China versuchte, Leben zu retten? Sollten wir nicht das Gegenteil erwarten? Die hartherzige amerikanische Reaktion auf die steigenden Opferzahlen kann nicht allein mit der inkompetenten Reaktion der US-Regierung erklärt werden, sondern sie ist Ausdruck grundlegenderer Probleme: Die Regierung in Washington konnte keine entschiedenen, zentralisierten Maßnahmen durchsetzen; es kam zu Zuständigkeitskonflikten zwischen verschiedenen Behörden; Teile der Bevölkerung widersetzten sich den grundlegendsten Schutzmaßnahmen (und der Staat war nicht imstande, diese Maßnahmen durchzusetzen); und unter den Opfern sind unverhältnismäßig viele schwarze, lateinamerikanischstämmige und einkommensschwache Menschen. In einem Land, das (wie ich in Kapitel 2 erkläre) auf die Plutokratie zusteuert, hat die Tatsache, dass die Reichen weitgehend von gesundheitlichem und finanziellem Schaden verschont geblieben sind, zur Gleichgültigkeit gegenüber den Todesopfern beigetragen.
In Kapitel 3 argumentiere ich, dass der Mangel an demokratischer Legitimität, der die Regierungen in Ländern mit einem 9System des politischen Kapitalismus und insbesondere China plagt, die auf den ersten Blick paradoxe Folge haben kann, dass sich diese Regierungen nicht weniger, sondern mehr um die Entwicklung der Wirtschaft und das Wohlergehen der Bürger sorgen. Der Grund dafür ist folgender: Wenn der implizite Vertrag zwischen Volk und Regierung besagt, dass die Bürger ein autokratisches Regime akzeptieren, solange dieses »Güter« liefert – das heißt solange die politische Freiheit für wirtschaftliches Wohlergehen geopfert wird –, dann hat das Regime jeden Anreiz, alles für das Gedeihen der Wirtschaft zu tun und sich im Fall einer Pandemie darauf zu konzentrieren, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, um seine Legitimität nicht einzubüßen. Die Legitimität beruht hier auf Ergebnissen, nicht darauf, dass die Regierung vom Volk gewählt wurde. Das erklärt in meinen Augen das extrem entschlossene und in einigen Fällen drakonische Vorgehen des chinesischen Staates. Dazu kommt natürlich seine Fähigkeit, die Ressourcen zu bündeln und bürgerliche Grundrechte zu ignorieren, die in vielen Demokratien die Reaktion auf die Pandemie verlangsamt haben.
Die Pandemie hat mit wohl beispielloser Klarheit den ideologischen Konflikt zwischen den beiden Systemen zutage gefördert. Die aggressive Haltung der sogenannten »Wolfskrieger«, junger Diplomaten, die vor allem in den sozialen Medien gegen ihre Gastländer wettern, ist neu in der chinesischen Außenpolitik. Aber wie ich schreibe:
Möglicherweise gibt es noch einen […] Faktor, der China dazu bewegen könnte, international eine aktivere Rolle zu übernehmen. Dieser Faktor verknüpft Innen- und Außenpolitik. Wenn China in einer passiven Rolle verharrt und nicht für seine eigenen Institutionen wirbt, während der Westen die Werte des liberalen Kapitalismus in China verbreitet, ist damit zu rechnen, dass große Teile der chinesischen Bevölkerung Gefallen an den westlichen Institutionen finden werden. Gelingt es China hingegen, die Vorzüge des politischen Kapitalismus ins rechte Licht zu rücken, so kann es dem aus10ländischen Einfluss entgegenwirken. Eine aktivere internationale Rolle ist also Voraussetzung für das innenpolitische Überleben des Systems und entspringt der Gefahr einer inneren Schwächung.
Das neue ideologische Geltungsbedürfnis Chinas muss also als Präventivmaßnahme betrachtet werden, als Forschheit, die potenzieller Schwäche entspringt. Wenn autoritäre Regime kein ideologisches Gegenkonzept zur Demokratie vorschlagen und aktiv vertreten, laufen sie Gefahr, im eigenen Land der ideologischen Anziehungskraft der Demokratie zum Opfer zu fallen. Durch diese potenzielle Schwäche wird China »gezwungen«, sein eigenes Gesellschaftsmodell zu exportieren, obwohl sich das Land historisch gegen ein offensives Vorgehen auf der Weltbühne sträubt und obwohl es schwierig ist, die chinesische Erfolgsformel für die übrige Welt attraktiv zu »verpacken« (mit beiden Fragen befasse ich mich in Abschnitt 3.5b).
Die Vereinigten Staaten und China sind typische Vertreter von zwei Formen des Kapitalismus, aber das darf uns nicht zu dem Trugschluss verleiten, dass allein diese beiden Länder im Fall von Covid-19 die Unterschiede zwischen den Reaktionen demokratischer und autoritärer Systeme veranschaulichen. Tatsächlich können wir diesbezüglich nicht klar zwischen den beiden Systemen unterscheiden. In Asien haben beide Systeme gute Ergebnisse erzielt: Vietnam und Singapur auf der einen und Taiwan, Japan und Südkorea auf der anderen Seite. In Europa waren einige Demokratien erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie (zum Beispiel Deutschland, Dänemark, die Tschechische Republik, Griechenland), während andere die Herausforderung sehr viel schlechter bewältigten (zum Beispiel Schweden, Großbritannien und Italien).
Die zweite langfristige Auswirkung der Pandemie wird eine Verlangsamung der Globalisierung sein. Zu erkennen ist das bereits an den Einschränkungen für Geschäftsreisen. Diese Beschränkungen werden jedoch weitgehend aufgehoben werden, sobald die Pandemie vorüber ist. Aber die Einstellung zu den 11globalen Wertschöpfungsketten wird sich ändern. Wie ich in Abschnitt 4.2 zeige, haben diese entscheidend zur weltweiten Verbreitung der kapitalistischen Produktionsbeziehungen beigetragen. Sie wurden so gestaltet, dass sie unter optimalen Bedingungen, das heißt ohne politische Erschütterungen oder plötzliche disruptive Ereignisse, extrem effizient waren. Für Kostensenkungen wurde auf Sicherheitsmechanismen oder Redundanzen für den Fall plötzlicher Veränderungen in den Handelskanälen oder politischer Konflikte verzichtet. Die Pandemie hat gezeigt, dass die Annahme optimaler Bedingungen auf tönernen Füßen stand. Es ist zu erwarten, dass die Ketten in Zukunft teurer, aber auch robuster werden und dass die Produktion aus politischen Gründen näher bei der Heimat angesiedelt wird. Die Globalisierung kann nicht rückgängig gemacht werden. Aber die Pandemie war ein Rückschlag. Sie hat Zweifel an der Gültigkeit einiger jener Annahmen geweckt, auf denen die Idee beruht, die Produktion über den ganzen Erdball zu verteilen.
Die dritte Veränderung betrifft die Rolle des Staates. Die Pandemie hat die verborgenen Schwächen der Annahme offenbar werden lassen, dass das Gesundheitswesen und andere Bestandteile der Wirtschaft, darunter Bildung und Infrastruktur, ausschließlich am Gewinnprinzip ausgerichtet werden können. Die Kürzung der Gesundheitsausgaben, die Verringerung der Bettenzahl, der Verzicht auf die Produktion von Schutzausrüstung, die Betrachtung der Entwicklung von Medikamenten als rein geschäftliche Aktivität (in der die Unternehmen kaum Anreize haben, Impfstoffe oder Therapien für selten auftretende Krankheiten zu entwickeln) haben die Schwächen dieses Ansatzes deutlich gemacht. Diese Erkenntnis wird in meinen Augen dazu führen, dass bestimmte wichtige Sphären des Wirtschaftslebens vom Gewinnprinzip ausgenommen werden. Hier wird der Staat in vielen Ländern mit einem liberalen kapitalistischen System eine wichtigere Rolle übernehmen.
Dies ist natürlich nur eine erste Skizze der längerfristigen Auswirkungen der Pandemie. Möglicherweise wird es weitere geben, die wir zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehen können. 12Wenn sich die asiatischen Länder beispielsweise sehr viel schneller als die Mitglieder der Europäischen Union und als Nordamerika erholen (derzeit hat es den Anschein, als wäre es so), wird sich der Schwerpunkt der globalen wirtschaftlichen Aktivität noch schneller nach Asien verschieben. Die Auswirkungen der Pandemie auf Afrika sind bisher begrenzt, doch das könnte sich ändern, was zur Folge haben würde, dass sich Europa einem noch größeren Migrationsdruck infolge des gewaltigen Einkommensgefälles zwischen den beiden Kontinenten ausgesetzt sähe. Schließlich könnte die Pandemie in vielen Ländern erhebliche politische Auswirkungen haben und den Sturz von Regierungen oder sogar Revolutionen auslösen. Es sind keine Prognosen dazu möglich, welche Länder betroffen sein werden, aber es ist zu erwarten, dass ein Ereignis mit derart weitreichenden globalen Auswirkungen aufgrund schlechter Krisenbewältigungsstrategien in einigen Ländern zu Unzufriedenheit und politischer Instabilität führen wird.
Branko Milanović
San Francisco, im Juli 2020
272 Liberaler meritokratischer Kapitalismus
[Die Demokratie], ist sie nicht göttlich bezaubernd für den Augenblick?
Platon, Der Staat
Definition des liberalen meritokratischen Kapitalismus
Die Definition des liberalen meritokratischen Kapitalismus ist unkompliziert. Wie Karl Marx und Max Weber definiere ich den Kapitalismus als System, in dem der Großteil der Güter mit Produktionsmitteln erzeugt wird, die sich in Privateigentum befinden, in dem die Kapitaleigentümer nach dem Gesetz freie Arbeitskräfte beschäftigen und in dem das Wirtschaftsleben dezentral koordiniert wird. Zusätzlich berücksichtige ich das von Joseph Schumpeter beschriebene Erfordernis, dass die meisten Investitionsentscheidungen von Privatunternehmen oder individuellen Unternehmern gefällt werden.1
Die Begriffe »meritokratisch« und »liberal« stammen aus den Definitionen verschiedener Formen der Gleichheit, die John Rawls in Eine Theorie der Gerechtigkeit (2014 [1971]) vorgenommen hat. Die »meritokratische Gleichheit« existiert in einem System der »natürlichen Freiheit«, in dem der berufliche Aufstieg vom Talent abhängt; dem Streben eines jeden Menschen nach einer bestimmten gesellschaftlichen Position sind also keine rechtlichen Hindernisse gesetzt. Die Vererbbarkeit des Eigentums wird in diesem System uneingeschränkt akzeptiert. Ein System der »liberalen Gleichheit« ist egalitärer, weil es die Vererbung von Vermögen durch hohe Erbschaftssteuern teilweise korrigiert und kostenlose Bildung einsetzt, um die Übertragung von Vorteilen von einer Generation auf die andere einzuschränken. Der Begriff des »liberalen meritokratischen Kapitalismus« bezieht sich also darauf, wie Güter und Dienstleistungen er28zeugt und ausgetauscht werden (»Kapitalismus«), wie sie zwischen den Individuen verteilt werden (»meritokratisch«) und wie groß die soziale Mobilität ist (»liberal«).
In diesem Kapitel konzentriere ich mich auf die Frage, wie sich die systemischen Kräfte im liberalen meritokratischen Kapitalismus auf die Verteilung der Einkommen auswirken und zur Entstehung einer Elite führen. In Kapitel 3 untersuche ich ähnliche Fragen in Bezug auf den politischen Kapitalismus. In beiden Kapiteln liegt das Hauptaugenmerk nicht auf der Produktion, sondern auf der Verteilung der Einkommen, der Einkommens- und Vermögensungleichheit und der Entstehung von Klassen.
2.1 Schlüsselmerkmale des liberalen meritokratischen Kapitalismus
2.1a Historische Formen des Kapitalismus
Um den liberalen meritokratischen Kapitalismus zu verstehen, stellt man am besten seine spezifischen Merkmale denen des klassischen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts und des sozialdemokratischen Kapitalismus gegenüber, der zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den frühen achtziger Jahren in Westeuropa und Nordamerika existierte. Hier geht es zunächst um die »idealtypischen« Merkmale dieser Systeme. Detailunterschiede zwischen verschiedenen Ländern und Zeiträumen lasse ich an dieser Stelle beiseite. In den folgenden Abschnitten jedoch, in denen ich mich ausschließlich mit dem liberalen meritokratischen Kapitalismus beschäftige, beschreibe ich seine Charakteristika in einem Land, das als sein prototypischer Vertreter angesehen werden kann – den Vereinigten Staaten –, im Detail.
Tabelle 2.1 enthält eine Zusammenfassung der Unterschiede zwischen den drei historischen Typen des Kapitalismus, die sich in den westlichen Volkswirtschaften herausgebildet haben. 29Der Einfachheit halber betrachte ich Großbritannien vor 1914 als Vertreter des klassischen Kapitalismus, Westeuropa und die Vereinigten Staaten vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis Anfang der achtziger Jahre als Repräsentanten des sozialdemokratischen Kapitalismus und die USA im 21. Jahrhundert als Beispiel für den liberalen meritokratischen Kapitalismus.2 Zu beachten ist, dass die Vereinigten Staaten in den letzten drei Jahrzehnten möglicherweise zu einem Modell des Kapitalismus übergegangen sind, das mehr »meritokratische« und weniger 30»liberale« Eigenschaften aufweist: Die beiden Schlüsselmerkmale, die den liberalen vom meritokratischen Kapitalismus unterscheiden, nämlich die Besteuerung von geerbtem Vermögen und das Angebot einer allgemein zugänglichen öffentlichen Bildung, sind eingeschränkt worden. Da ich die USA als ein Beispiel für alle reichen kapitalistischen Länder heranziehe, scheint es mir trotzdem vertretbar, vom liberalen meritokratischen Kapitalismus als einem einheitlichen Modell zu sprechen.
Tabelle 2.1: Schlüsselmerkmale des klassischen, des sozialdemokratischen sowie des liberalen meritokratischen Kapitalismus
Typ von Kapitalismus
Klassischer Kapitalismus
Sozialdemokratischer Kapitalismus
Liberaler meritokratischer Kapitalismus
Historisches Beispiel
Großbritannien vor 1914
USA, Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg
USA Anfang des 21. Jahrhunderts
1. Steigender Anteil der Kapitaleinkünfte am Nationaleinkommen
Ja
Nein
Ja
2. Hohe Konzentration des Kapitalbesitzes
Ja
Ja
Ja
3. Personen mit viel Kapital sind reich
Ja
Ja
Ja
4. Personen mit hohen Kapitaleinkommen haben auch hohe Arbeitseinkommen
Nein
Nein
Ja
5. Reiche (oder potenziell Reiche) heiraten untereinander (Homogamie)
Ja (mit Einschränkungen)
Nein
Ja
6. Starke Korrelation zwischen dem Einkommen von Eltern und dem ihrer Kinder (Weitergabe von Vorteilen)
Ja
Ja (in einigen Fällen aber auch schwache Korrelation)
Ja
Hinweis: Ohne ergänzende Erklärung bedeutet »reich«, dass eine Person ein hohes Einkommen hat.
Aufteilung des Nettoeinkommens zwischen Eigentümern und Arbeitskräften
Wir beginnen mit dem Schlüsselmerkmal jedes kapitalistischen Systems: mit der Aufteilung des Nettoeinkommens zwischen den beiden Produktionsfaktoren, das heißt zwischen Kapital und Arbeit beziehungsweise zwischen den Kapitaleigentümern (oder allgemeiner Eigentümern von Vermögen) und den Arbeitskräften. Diese Aufteilung trennt nicht zwangsläufig zwei Klassen von Individuen. Das wäre nur dann der Fall, wenn eine Klasse ihr Einkommen ausschließlich aus Kapitaleinkünften bezöge und eine andere ausschließlich aus Arbeit.3 Mit welcher Form von Kapitalismus wir es zu tun haben, hängt davon ab, ob sich die Aufteilung der Einkommensarten tatsächlich mit der Aufteilung der gesellschaftlichen Klassen deckt.
Für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg liegen kaum Daten zur Aufteilung des gesamten Nettoeinkommens zwischen Kapital und Arbeit vor. Die ersten Schätzungen für Großbritannien legte der Ökonom Arthur Bowley im Jahr 1920 vor. Ausgehend von seinen Ergebnissen wurde argumentiert, die Einkommensanteile von Kapital und Arbeit seien weitgehend konstant – ein Umstand, der als »Bowleys Gesetz« bekannt geworden ist. Von Thomas Piketty (2014, 266-268) vorgelegte Daten für Großbritannien und Frankreich haben beträchtliche Zweifel an dieser Einschätzung geweckt, und das auch für die Vergangenheit. Piketty erklärt, der Anteil des Kapitals am Nationaleinkommen habe sich in Großbritannien im Zeitraum von 1770 bis 2010 31zwischen 20 und 40 Prozent bewegt. In Frankreich schwankte er zwischen 1820 und 2010 noch stärker, nämlich zwischen 45 Prozent in den sechziger Jahren des 19. und weniger als 15 Prozent in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg stabilisierte sich der Einkommensanteil des Kapitals, was Bowleys Gesetz zu bekräftigen schien. Der Ökonom Paul Samuelson zum Beispiel zählte Bowleys Gesetz in seinem einflussreichen Lehrbuch Volkswirtschaftslehre zu den sechs grundlegenden Merkmalen der wirtschaftlichen Entwicklung in hoch entwickelten Ländern (obwohl er ein gewisses »Ansteigen des Lohnanteils« für möglich hielt; vgl. Samuelson 1981 [1948], 455). Aber seit dem Ende des 20. Jahrhunderts steigt der Anteil der Kapitaleinkünfte am Gesamteinkommen. In den Vereinigten Staaten ist diese Tendenz besonders ausgeprägt, aber sie ist auch in den meisten anderen entwickelten Ländern sowie in Entwicklungsländern zu beobachten (wobei die Daten für Letztere mit Zurückhaltung betrachtet werden müssen [Karabarbounis und Neiman 2013]).
Ein steigender Anteil des Kapitaleinkommens am Gesamteinkommen deutet darauf hin, dass das Kapital und die Kapitalisten größeres Gewicht gewinnen als die Arbeit und die Arbeiter – und folglich mehr wirtschaftliche und politische Macht erlangen. Dies ist sowohl im klassischen als auch im liberalen meritokratischen Kapitalismus der Fall, nicht jedoch in der sozialdemokratischen Variante (siehe Tabelle 2.1). Ein wachsender Einkommensanteil des Kapitals wirkt sich auch auf die interpersonale Einkommensverteilung aus, weil (1) Personen, die einen großen Teil ihres Einkommens aus Kapitaleinkünften beziehen, für gewöhnlich reich sind, und (2) die Kapitaleinkünfte üblicherweise in relativ wenigen Händen konzentriert sind. Diese beiden Faktoren führen fast automatisch zu einer größeren Einkommensungleichheit zwischen den Individuen.
Um nachvollziehen zu können, warum sowohl (1) als auch (2) unverzichtbare Voraussetzungen dafür sind, dass höhere Einkommensanteile aus Kapital automatisch zu einer größeren in32terpersonalen Ungleichheit führen, können wir ein Gedankenexperiment anstellen: Nehmen wir an, der Anteil des Kapitals am Nettoeinkommen steigt, aber alle Personen beziehen dieselben Anteile ihres Einkommens aus Kapital und Arbeit.4 Ein wachsender Gesamtanteil des Kapitaleinkommens wird jedes individuelle Einkommen in derselben Proportion erhöhen, womit die Ungleichheit nicht zunimmt. (Die Ungleichheitsmaße sind relativ.) Mit anderen Worten: Wenn es keine ausgeprägte positive Korrelation zwischen »Kapitalüberfluss« (das heißt dem Bezug eines hohen prozentualen Anteils des Einkommens aus Kapitalerträgen) und Reichtum gibt, führt ein wachsender Einkommensanteil der Kapitaleinkünfte nicht zu größerer interpersonaler Ungleichheit. Zu beachten ist, dass es in diesem Fall durchaus reiche und arme Personen gibt, aber es besteht keine Korrelation zwischen dem Prozentsatz des Einkommens, das eine Person aus Kapitaleinkünften erzielt, und der Position dieser Person in der Einkommensverteilung.
Stellen wir uns nun eine Situation vor, in der arme Personen einen höheren Anteil ihres Einkommens aus Kapitaleinkünften beziehen als reiche Personen. Wie zuvor nehmen wir an, dass der Gesamtanteil der Kapitaleinkünfte am Nettoeinkommen steigt. Aber diesmal wird der wachsende Anteil der Kapitaleinkünfte die Einkommensungleichheit verringern, weil er die Einkommen der Personen am unteren Ende der Einkommensverteilung verhältnismäßig stärker erhöhen wird.
Aber keines dieser beiden Gedankenspiele entspricht dem, was tatsächlich in kapitalistischen Gesellschaften geschieht. Vielmehr besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Kapitalbesitz und Reichtum. Je reicher eine Person, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen großen Teil ihres Einkommens aus Kapitalerträgen bezieht.5 So ist es bisher in allen kapitalistischen Systemen gewesen (siehe Tabelle 2.1, Zeilen 2 und 3). Dieses Merkmal – Menschen, die über beträchtliches Kapital verfügen, sind auch reich – kann als unveränderlicher Wesenszug des Kapitalismus betrachtet werden, zumindest jener Formen des Kapitalismus, die sich bisher entwickelt haben.6
33Personen mit hohem Kapitaleinkommen und Personen mit hohem Arbeitseinkommen
Das nächste Merkmal, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist der Zusammenhang zwischen großem Kapitalbesitz (das heißt einer guten Position in der Verteilung der Kapitaleinkünfte) und hohem Lohn (das heißt einer guten Position in der Verteilung der Arbeitseinkommen). Die Annahme liegt nahe, dass Personen, die gemessen am Kapitaleinkommen reich sind, kaum gemessen am Arbeitseinkommen reich sein werden. Weit gefehlt. Ein einfaches Beispiel mit zwei Gruppen von Personen, nämlich »Armen« und »Reichen«, veranschaulicht das. Die Armen haben insgesamt niedrige Einkommen, und den Großteil ihres Einkommens beziehen sie aus Arbeit. Bei den Reichen verhält es sich umgekehrt. Nehmen wir eine Situation 1: Die Armen beziehen 4 Einkommenseinheiten aus Arbeit und 1 Einheit aus Kapital, während die Reichen 4 Einkommenseinheiten aus Arbeit und 16 Einheiten aus Kapital beziehen. In diesem Fall sind die Personen mit Kapitalüberfluss reich, erzielen jedoch das gleiche Arbeitseinkommen wie die Armen. Sehen wir uns nun eine zweite Situation an: Sie ist identisch mit Situation 1, nur dass das Arbeitseinkommen der Reichen hier auf 8 Einheiten steigt. Die Reichen haben also immer noch einen Kapitalüberfluss, da sie einen größeren Teil ihres Gesamteinkommens aus Kapitaleinkünften beziehen als die Armen (16 von 24 Einkommenseinheiten, also zwei Drittel), aber jetzt sind sie auch reich an Arbeitseinkommen (8 Einkommenseinheiten gegenüber nur 4 der Armen).
In Situation 2 sind die Personen mit Kapitalüberfluss nicht nur reich, sondern erzielen auch ein relativ hohes Arbeitseinkommen. Die Ungleichheit in Situation 2 ist größer als in Situation 1. Tatsächlich ist dies einer der wesentlichen Unterschiede zwischen klassischem und sozialdemokratischem Kapitalismus auf der einen und liberalem meritokratischem Kapitalismus auf der anderen Seite (siehe Tabelle 2.1, Zeile 4). In der Wahrnehmung und Realität des klassischen Kapitalismus waren die Ka34pitalisten (die ich hier als Personen mit Kapitalüberfluss bezeichne) alle sehr reich, erzielten im Normalfall jedoch nur geringe und im Extremfall überhaupt keine Arbeitseinkommen. Nicht zufällig bezeichnete Thorstein Veblen sie als »Klasse der Müßiggänger« (leisure class). Umgekehrt hatten die Arbeiter überhaupt keine Kapitaleinkünfte. Ihr Einkommen bezogen sie ausschließlich aus Arbeit.7 In diesem Fall war die Gesellschaft klar in Kapitalisten und Arbeiter unterteilt, wobei die zwei Seiten keinerlei Einkommen aus dem anderen Produktionsfaktor bezogen. (Wenn wir die Grundbesitzer hinzufügen, die hundert Prozent ihres Einkommens aus dem Produktionsfaktor Boden bezogen, haben wir die von Adam Smith beschriebene dreigeteilte Klassifizierung.) In diesen segmentierten Gesellschaften war die Ungleichheit ausgeprägt, weil die Kapitalisten beträchtliches Kapital besaßen und die Kapitalrendite (oft) hoch war, aber die Ungleichverteilung wurde nicht dadurch verschärft, dass diese Personen auch hohe Arbeitseinkommen erzielten.
Im liberalen meritokratischen Kapitalismus, wie wir ihn heute in den Vereinigten Staaten finden, liegen die Dinge anders: Kapitalreiche Personen sind zumeist auch arbeitsreich (sie sind Personen mit hohem »Humankapital«, um einen mittlerweile gängigen Begriff zu verwenden). Während die Personen an der Spitze der Einkommensverteilung im klassischen Kapitalismus Financiers, Rentiers und Besitzer großer Industrieholdings waren (die von niemandem eingestellt worden waren und daher kein Arbeitseinkommen bezogen), wird heute ein beträchtlicher Prozentsatz der Personen an der Spitze der Einkommensverteilung von hoch bezahlten Managern, Webdesignern, Ärzten, Investmentbankern und Angehörigen anderer Eliteberufe gestellt. Diese Personen müssen arbeiten, um ihre hohen Einkommen zu erzielen.8 Aber dieselben Personen besitzen auch Finanzvermögen, sei es durch Erbe oder weil sie im Lauf ihres Arbeitslebens genug Geld gespart haben, und beziehen einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens aus solchem Vermögen.
35Den wachsenden Anteil der Arbeitseinkommen an den Einkommen des obersten einen Prozents der Verteilung (oder noch erlesener Gruppen wie der obersten 0,1 Prozent) haben Piketty (2014) und andere Autoren gut dokumentiert.9 Diesem Thema werde ich mich an anderer Stelle in diesem Kapitel erneut zuwenden. Wichtig ist hier, dass hohe Arbeitseinkommen an der Spitze der Einkommensverteilung, wenn sie mit hohen Kapitaleinkünften derselben Personen einhergehen, die Ungleichheit vergrößern. Dies ist ein eigentümliches Merkmal des liberalen meritokratischen Kapitalismus, etwas, das nie zuvor in diesem Ausmaß beobachtet worden ist.
Ehemuster
Wenden wir uns nun der Frage der Ehemuster in den verschiedenen Varianten des Kapitalismus zu (siehe Tabelle 2.1, Zeile 5). Wenn Ökonomen die Einkommens- oder Vermögensungleichheit untersuchen, ziehen sie den Haushalt als Beobachtungseinheit heran. Da viele Haushalte durch Heirat entstehen, müssen wir uns anschauen, wie die Leute ihre Ehepartner auswählen. Wie im Fall der Kapital- und Arbeitseinkommen unterscheidet sich der liberale meritokratische Kapitalismus auch hier von den anderen beiden Ausprägungen des Systems.
Um den Unterschied zu veranschaulichen, können wir uns die Muster von Eheschließungen in den Vereinigten Staaten in den fünfziger Jahren des 20. und in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts ansehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg heirateten Männer zumeist Frauen mit einem ähnlichen sozialen Status, aber je vermögender der Ehemann war, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehefrau einer Erwerbsarbeit nachging. Heute heiraten vermögendere und gebildetere Männer vorwiegend vermögendere und gebildetere Frauen. Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Paarungen auf die Ungleichheit können wir anhand eines einfachen Beispiels veranschaulichen. Nehmen wir zwei Männer, von denen einer 50 Einkommenseinheiten und der andere 100 Einheiten verdient, und zwei Frauen, von denen eine 10 Einkommenseinheiten und 36die andere 20 Einheiten verdient. Nehmen wir an, es findet eine assortative Partnerwahl statt (die auch als Homogamie bezeichnet wird), das heißt, es gibt eine positive Korrelation zwischen den Einkommen von Ehemann und Ehefrau: Der Mann, der 100 Einkommenseinheiten verdient, heiratet die Frau mit 20 Einkommenseinheiten, und der Mann mit dem geringeren Einkommen von 50 Einheiten heiratet die einkommensschwächere Frau mit 10 Einkommenseinheiten. Nehmen wir nun an, die reichere Ehefrau gibt ihre Erwerbstätigkeit auf (wie es in den fünfziger Jahren üblich war), während im einkommensschwächeren Paar beide Partner weiterarbeiten. In diesem Fall beträgt das Verhältnis zwischen den beiden Haushaltseinkommen 100 zu 60 Einheiten. Wenn die Annahme der assortativen Partnerwahl bestehen bleibt, jedoch (wie in der Gegenwart) beide Frauen weiter erwerbstätig sind, so steigt das Verhältnis zwischen den beiden Haushaltseinkommen auf 120 zu 60. Also nimmt die Ungleichheit zu.
Das Beispiel zeigt, dass die Ungleichheit unter der Bedingung der assortativen Partnerwahl zunehmen wird, wenn die Erwerbsbeteiligung der Frauen steigt. Noch größer wird die Ungleichheit, wenn die Wahl der Ehepartner früher willkürlich oder nicht assortativ war (wenn reichere Männer ärmere Frauen heirateten). Einige Wissenschaftler haben argumentiert, die assortative Partnerwahl sei im liberalen meritokratischen Kapitalismus sehr viel häufiger geworden, weil sich die gesellschaftlichen Normen geändert haben, mehr Frauen eine höhere Bildung erhalten (tatsächlich schließen mittlerweile mehr Frauen als Männer eine Hochschulausbildung ab) und eine noch sehr viel größere Zahl von Frauen einer Erwerbsarbeit nachgeht. Es ist auch möglich (obwohl es sich bei dieser Annahme um reine Spekulation handelt), dass sich die Präferenzen der Menschen geändert haben und dass sowohl Männer als auch Frauen heute lieber eine Verbindung mit einer Person eingehen, die ihnen ähnelt. Was auch immer der Grund für die zunehmende Homogamie ist, sie ist ein weiterer Faktor, der zu einer Zunahme der Einkommensungleichheit beiträgt. Allerdings wird sie 37die Ungleichheit nur in der Phase des Übergangs von der nicht assortativen Partnerwahl (oder von assortativen Verbindungen mit Frauen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen) zur assortativen Partnerwahl erhöhen. Haben die assortative Partnerwahl und die Erwerbsbeteiligung der Frauen einmal ein Höchstmaß erreicht, so verschwindet die Wirkung auf die Ungleichheit: Diese stabilisiert sich, wenn auch auf einem hohen Niveau.
Intergenerationelle Weitergabe der Ungleichheit
Das letzte Merkmal des Kapitalismus, das ich untersuchen werde, ist die Übertragung erworbener Vorteile, darunter insbesondere Vermögen und »Humankapital«, von einer Generation auf die nächste. Das Ausmaß dieses Phänomens wird oft an der Korrelation der Einkommen von Eltern und Kindern gemessen (siehe Tabelle 2.1, Zeile 6). Obwohl Daten für frühere Zeiträume fehlen, kann man davon ausgehen, dass die Weitergabe solcher Vorteile in allen drei Formen des Kapitalismus ausgeprägt ist. Wir wissen, dass das Phänomen in späteren Perioden, für die bessere Daten vorliegen, in egalitäreren zeitgenössischen Gesellschaften, in denen Bildung leicht zugänglich ist und mit Steuergeldern bezahlt wird und die Erbschaftssteuern hoch sind, sehr viel weniger ausgeprägt ist. In den skandinavischen Ländern ist die intergenerationelle Einkommenskorrelation besonders gering, und es ist wahrscheinlich, dass diese Korrelation auch im goldenen Zeitalter des sozialdemokratischen Kapitalismus wenig ausgeprägt war, insbesondere in Westeuropa.10 Im Gegensatz dazu lassen sich in den Vereinigten Staaten heute sowohl eine ausgeprägte intergenerationelle Übertragung der Ungleichheit als auch eine hohe Einkommensungleichheit konstatieren. Die Ergebnisse von Vergleichsstudien zu mehreren Ländern deuten auf einen relativ engen Zusammenhang zwischen den beiden Phänomenen hin. Der Befund ist daher nicht überraschend (Corak 2013, 11; Brunori, Ferreira und Peragine 2013, 27). Man sollte erwarten, dass in den USA mit ihrer ausgeprägten Ungleichheit auch die intergenerationelle Ungleichheit in großem Umfang weitergeben wird.
38Die komplexe Natur des liberalen meritokratischen Kapitalismus
Inwieweit unterscheidet sich die Ungleichheit in den verschiedenen Varianten des Kapitalismus? In allen sechs hier untersuchten Aspekten weist der liberale meritokratische Kapitalismus Merkmale auf, welche die Ungleichheit verstärken. Vom klassischen Kapitalismus unterscheidet er sich insbesondere dadurch, dass Personen mit hohem Kapitaleinkommen zugleich auch ein hohes Arbeitseinkommen erzielen; dazu kommt wahrscheinlich eine stärker ausgeprägte assortative Partnerwahl. Vom sozialdemokratischen Kapitalismus unterscheidet er sich in mehrerlei Hinsicht erheblich: Der Anteil des Kapitals am Nettoeinkommen ist höher, es gibt Kapitalisten mit hohem Arbeitseinkommen, und die intergenerationelle Übertragung der Ungleichheit ist wahrscheinlich ausgeprägter.
Ich möchte jedoch auf drei Punkte hinweisen, bevor ich mich einer eingehenderen Analyse dieser sechs Charakteristika zuwende. Erstens bedeutet die Tatsache, dass der liberale meritokratische Kapitalismus alle sechs Merkmale aufweist, nicht automatisch, dass die Ungleichheit hier größer sein muss als in den anderen Formen des Kapitalismus. Tatsächlich ist sie mit Sicherheit nicht größer als im klassischen Kapitalismus (Milanović 2016, Kapitel 2). Die Umverteilungswirkung von direkten Steuern und Transferleistungen, die der liberale Kapitalismus von der sozialdemokratischen Variante »geerbt« hat und die im klassischen Kapitalismus fehlte, habe ich nicht berücksichtigt. Diese Umverteilungskräfte verringern die Ungleichheit unter das vom Markteinkommen allein abhängige Niveau.
Zweitens verrät uns das Vorhandensein eines Merkmals nicht, in welchem Maß dieses Charakteristikum die Ungleichheit erhöht. Beispielsweise ist sowohl im klassischen als auch im liberalen Kapitalismus eine hohe Konzentration der Kapitaleinkommen zu beobachten, aber in der klassischen Form war diese Konzentration noch sehr viel höher als im liberalen Kapitalismus. Um das Jahr 1914 befanden sich 70 Prozent der britischen 39Vermögen in den Händen des obersten einen Prozents der Vermögensverteilung; mittlerweile ist der Anteil dieser Gruppe auf etwa 20 Prozent gesunken (Alvaredo, Atkinson und Morelli 2018). Die Vermögenskonzentration ist weiterhin hoch, aber sehr viel geringer als in der Vergangenheit.
Drittens können einige Merkmale des liberalen meritokratischen Kapitalismus, welche die Ungleichheit erhöhen, moralisch akzeptabel und in bestimmten Fällen sogar wünschenswert sein. Es stimmt, dass die Ungleichheit größer ist, wenn der Anteil der Kapitalisten mit hohen Arbeitseinkommen groß ist – aber ist es nicht zu begrüßen, dass Menschen durch Arbeit reich werden können? Ist es nicht besser, wenn Menschen hohe Einkommen sowohl aus Arbeit als auch aus Kapital beziehen, anstatt dass solche Einkommen nur mit Kapitaleinkünften möglich sind? Und während es richtig ist, dass die Homogamie die Ungleichheit erhöht, stellt sich die Frage, ob sie nicht wünschenswert ist, da sie Ausdruck einer deutlich erhöhten Erwerbsbeteiligung von Frauen, von sozialen Normen, die der bezahlten Arbeit Wert beimessen, und von einer Präferenz für Partner ist, die uns ähnlich sind? Diesen Widerspruch zwischen den die Ungleichheit verstärkenden Effekten einiger Merkmale des modernen Kapitalismus und der Tatsache, dass die meisten Menschen diese Merkmale (abgesehen von ihrer Wirkung auf die Ungleichheit) als gesellschaftlich wünschenswert betrachten, müssen wir im Auge behalten, wenn wir die Charakteristika des liberalen meritokratischen Kapitalismus genauer untersuchen und uns mit möglichen Maßnahmen gegen die ausgeprägte Ungleichheit in diesen Gesellschaften befassen.
2.1b Systemische und nicht systemische Ursachen der wachsenden Ungleichheit im liberalen meritokratischen Kapitalismus
Bisher habe ich mich in meiner Untersuchung der Kräfte, die im liberalen meritokratischen Kapitalismus die Ungleichheit fördern, auf die systemischen oder strukturellen Faktoren konzentriert. Diese tragen offenbar wesentlich zur Entwicklung der Ein40