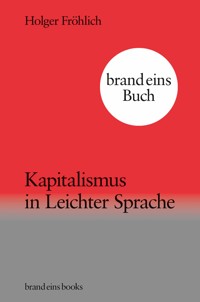
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wer den Kapitalismus verstehen will, hat es schwer. Oft verstecken sich gerade die brisantesten Sachverhalte hinter besonders sperrigen Begriffen. Damit ist mit diesem Buch endlich Schluss. Leichte Sprache ist eine klar reglementierte, einfache Sprache, die der barrierefreien Kommunikation dient. Leichte Sprache ist eine klar strukturierte Sprache, die eigentlich der barrierefreien Kommunikation dient. Autor Holger Fröhlich macht mit ihr aber auf unterhaltsame Weise komplexe Sachverhalte für alle verständlich. Ganz nebenbei entschärft er dabei auch begriffliche Nebelbomben und sprachliche Irreführungen. So werden die Mechanismen und Grundzüge des Kapitalismus für alle deutlich, die in diesem System leben und arbeiten: Bürger, Managerinnen, Kapitalismuskritiker, Gründerinnen, Lehrer oder Schülerinnen. Profis haben an diesem Buch ebenso ihre Freude wie Laien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Holger Fröhlich
Kapitalismus in Leichter Sprache
Über dieses Buch
Wer den Kapitalismus verstehen will, hat es schwer. Oft verstecken sich gerade die brisantesten Sachverhalte hinter besonders sperrigen Begriffen. Damit ist mit diesem Buch endlich Schluss. Leichte Sprache ist eine klar reglementierte, einfache Sprache, die der barrierefreien Kommunikation dient. Autor Holger Fröhlich macht auf unterhaltsame Weise komplexe Sachverhalte für alle verständlich. Ganz nebenbei entschärft er dabei auch begriffliche Nebelbomben und sprachliche Irreführungen.
So werden die Mechanismen und Grundzüge des Kapitalismus für alle deutlich, die in diesem System leben und arbeiten: Bürger:innen, Manager:innen, Kritiker:innen, Gründer:innen, Lehrer:innen und Schüler:innen. Professionelle BWLer haben an diesem Buch ebenso ihre Freude wie Laien.
Vita
Holger Fröhlich entstammt einem schwäbischen Neubaugebiet der Achtzigerjahre. Er studierte Allgemeine Rhetorik und Vergleichende Religionswissenschaft in Tübingen und besuchte die Zeitenspiegel-Reportageschule.
Nach Stationen bei der «taz» und der Reportageseite der «Stuttgarter Zeitung» schrieb er für «Die Zeit».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2023
Copyright © 2023 by brand eins Verlag Verwaltungs GmbH, Hamburg
Lektorat Gabriele Fischer, Holger Volland
Faktencheck Katja Ploch
Projektmanagement Hendrik Hellige, Daniel Mursa
Buchgestaltung Christine Lohmann
Covergestaltung Mike Meiré / Meiré und Meiré
ISBN 978-3-644-02075-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Wirtschaft geht uns ...
Grenz·nutzen
Externalitäten
Kapital·rendite
Austeritäts·politik
Gini-Koeffizient
Sozial·abbau
Preis·elastizität
Markt·eintritts·barriere
Steuer·vermeidung
Quantitative Lockerung
Lohn·stagnation
Mindest·lohn
Neo·liberal·ismus
Shareholder-Value
Frei·handels·abkommen
Markt·wirtschaft
Privat·eigentum
Gewinn·streben
Angebot und Nachfrage
Arbeits·teilung
Wirtschafts·lobby·ismus
Kapital·akkumulation
Lohn-Preis-Spirale
Sach·wert·preis·blase
Gefangenen·dilemma
Verbraucher·preis·index
Rent-seeking
Kapital·flucht
Jahres·haupt·versammlung
De·regulierung
Regulierungs·arbitrage
Too big to fail
Ressourcen·allokation
Opportunitäts·kosten
Liquiditäts·präferenz
Informations·asymmetrie
Struktur·wandel
Protektion·ismus
Zombie·firmen
Zahlungs·bilanz
Kapital·verkehrs·kontrollen
Kredit·klemme
Schatten·banken
Staats·verschuldung
Bedingungs·loses Grund·einkommen
Komparativer Kosten·vorteil
Human·kapital
Wettbewerbs·verzerrung
Magisches Vier·eck
Global·isierung
Kapital·ertrag·steuer
Dumping
Lohn·stück·kosten
Wirtschafts·wachstums·zwang
Prekariat
Wirtschaft geht uns alle an.
Und alle sollen sie verstehen.
Dieses Buch hilft dabei.
Selbst Chefs und Politikerinnen.
Grenz·nutzen
Das hat damit zu tun:
– Preis·elastizität
– Angebot und Nachfrage
– Opportunitäts·kosten
Das Wort Grenz·nutzen hat zwei Teile.
Der erste Teil von dem Wort ist: Grenze.
Eine Grenze ist wie ein Ende.
Zum Beispiel: Ein Land hat eine Grenze.
Da ist das Land zu Ende.
Der zweite Teil von dem Wort ist: Nutzen.
Nutzen heißt: So viel bringt mir das.
Der Nutzen von einer Sache kann sich ändern.
Vielleicht habe ich Hunger.
Dann ist der Nutzen von einem Brot groß.
Oder vielleicht habe ich keinen Hunger.
Dann ist der Nutzen von einem Brot klein.
Was ist Grenz·nutzen?
Das ist die Veränderung vom Nutzen.
Zum Beispiel: Ich habe Hunger und esse ein Brot.
Beim ersten Bissen ist der Nutzen sehr groß.
Beim zweiten Bissen ist der Nutzen ein bisschen kleiner.
Denn ich habe ein bisschen weniger Hunger.
Der Grenz·nutzen wird bei jedem Bissen kleiner.
Der Grenz·nutzen kann auch bei 0 sein.
Dann bin ich ganz satt.
Und der Grenz·nutzen kann sogar kleiner sein als 0.
Dann ist mir schlecht.
Warum braucht man das?
Zum Beispiel: Eine Firma erfindet einen Föhn.
– Der erste Föhn von der Firma geht nie kaputt.
Da ist der Grenz·nutzen nach dem Kaufen bei 0.
Denn die Leute brauchen nie mehr einen neuen Föhn.
– Der zweite Föhn geht nach zwei Jahren kaputt.
Da ist der Grenz·nutzen höher.
Denn die Leute brauchen immer wieder neue Föhne.
Das ist blöd für die Leute.
Aber es ist gut für die Firma.
Denn die Firma macht damit mehr Geld.
Deswegen schauen die Firmen auf den Grenz·nutzen.
Externalitäten
Das hat damit zu tun:
– Grenz·nutzen
– Preis·elastizität
– Ressourcen·allokation
Das Wort kommt aus der Sprache Latein.
Diese Sprache spricht heute fast keiner mehr.
Der wichtige Teil von dem Wort ist: extern.
Das heißt auf Deutsch: draußen.
Was sind Externalitäten?
Das sind die Folgen von einer Sache für andere Leute.
Es gibt gute und schlechte Externalitäten.
Die guten heißen: «positive Externalitäten».
Die schlechten heißen: «negative Externalitäten».
Was sind schlechte Externalitäten?
Zum Beispiel: Eine Firma verkauft Autos.
Die Autos machen die Luft schmutzig.
Das sind schlechte Folgen für die Leute.
Der Firma kann die schmutzige Luft egal sein.
Sie bezahlt nichts für die schmutzige Luft.
Denn die Luft gehört ihr nicht.
Aber die Leute müssen die schmutzige Luft einatmen.
Davon werden sie krank.
Aber den Arzt müssen sie selber bezahlen.
Die Leute bezahlen für die schlechten Externalitäten.
Was sind gute Externalitäten?
Zum Beispiel: Eine Firma verkauft Bäume.
Die Bäume machen die Luft sauber.
Das sind gute Folgen für die Leute.
Der Firma kann die Luft egal sein.
Sie kriegt kein Geld für die saubere Luft.
Denn die Luft gehört ihr nicht.
Aber die Leute können die saubere Luft atmen.
Davon werden die Leute gesund.
Die Leute gewinnen durch die guten Externalitäten.
Manchmal macht die Regierung Regeln.
Damit die Firmen das nicht ausnutzen.
Kapital·rendite
Das hat damit zu tun:
– Kapital·akkumulation
– Kapital·ertrag·steuer
– Kapital·verkehrs·kontrollen
Das Wort hat zwei Teile.
Der erste Teil von dem Wort ist: Kapital.
Was bedeutet Kapital?
Eine Firma verkauft Sachen.
Dafür kriegt die Firma Geld.
Mit dem Geld kann die Firma Sachen machen.
Zum Beispiel:
Die Mitarbeiter bezahlen oder Werk·zeug kaufen.
Das Geld von der Firma heißt Kapital.
Der zweite Teil von dem Wort ist: Rendite.
Was bedeutet Rendite?
Ich kann Geld für verschiedene Sachen ausgeben.
Zum Beispiel: Ich kann Kuchen kaufen.
Dann esse ich den Kuchen.
Dann ist das Geld weg.
Aber ich kann das Geld auch investieren.
Das heißt: Ich gebe das Geld erst mal aus.
Aber danach soll mehr Geld zu mir zurück·kommen.
Das Geld ist dann nicht weg.
Es soll mehr werden.
Manchmal klappt das.
Dann kann man ausrechnen: Habe ich jetzt mehr Geld?
Das ist die Rendite.
Was ist Kapital·rendite?
Das ist die Rendite von einer Firma.
Die Firma hat Kapital.
Dieses Kapital investiert die Firma.
Denn das Geld soll mehr werden.
Also kauft die Firma neue Sachen.
Zum Beispiel: eine bessere Maschine.
Die kann schneller arbeiten.
Am Ende rechnet die Firma aus:
– Wie viel Geld habe ich mehr als vorher?
Das ist die Kapital·rendite.
Austeritäts·politik
Das hat damit zu tun:
– Neo·liberal·ismus
– Sozial·abbau
– Staats·verschuldung
Das Wort Austeritäts·politik hat zwei Teile.
Der erste Teil von dem Wort ist: Austerität.
Das Wort kommt aus der Sprache Latein.
Diese Sprache spricht heute fast keiner mehr.
Das heißt auf Deutsch: streng sein.
Das zweite Wort ist: Politik.
Die Regierung kümmert sich um die Leute im Land.
In der Regierung arbeiten die Politiker.
Die Arbeit von den Politikern heißt: Politik.
Was ist Austeritäts·politik?
Das ist die Politik vom Streng-Sein.
Dann sagt die Regierung: Wir müssen jetzt sparen!
Wann macht die Regierung das?
Meistens nach einem großen Schock.
Zum Beispiel: im Jahr 2008.
Da sind auf einmal große Banken pleite gewesen.
Deswegen haben viele Leute ihre Arbeit verloren.
Diese Leute haben dann keine Steuern mehr gezahlt.
Und ohne Steuern hat die Regierung weniger Geld.
Deswegen hat die Regierung damals gesagt:
– Wir kriegen weniger Geld rein.
– Also geben wir jetzt auch weniger Geld aus.
In Europa gibt es arme und reiche Länder.
Oft haben die armen Länder Schulden.
Beim Schock sind die Schulden noch mehr geworden.
Da haben die reichen Länder zu ihnen gesagt:
– Jetzt könnt ihr eure Schulden nicht bezahlen.
– Weil ihr nicht genug Geld habt.
– Also müsst ihr jetzt richtig sparen.
– Sonst kriegt ihr kein Geld mehr von uns.
Das war schwer für die armen Länder.
Denn die armen Länder haben oft vorher schon gespart.
Gini-Koeffizient
Das hat damit zu tun:
– Kapital·akkumulation
– Lohn·stagnation
– Prekariat
Das Wort hat zwei Teile.
Der erste Teil von dem Wort ist: Gini.
So sprichst du es aus: Dschini.
Es ist der Nachname von einem Forscher aus Italien.
Der Forscher heißt: Corrado Gini.
Das zweite Wort ist: Koeffizient.





























