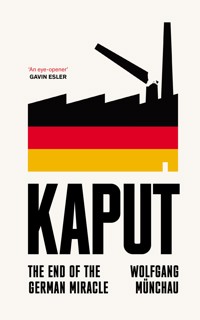Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Kaputt" liefert schonungslos die Diagnose für den Niedergang des deutschen Wirtschaftswunders. Es zeigt, wie Deutschland im Schatten seiner Erfolge die digitale Zukunft verpasst hat – und liefert ein Verständnis dafür, warum nur ein sofortiger Richtungswechsel den Wirtschaftsmotor wieder in Gang bringen kann. Die deutsche Wirtschaft galt über Jahrzehnte als weltweiter Maßstab: hochkarätige Ingenieurskunst, führende Maschinenbau- und Automobilkonzerne und ein florierendes Exportmodell. Doch es findet ein fundamentaler Wandel statt, den weder Unternehmer noch Politiker antizipiert haben – mit dem Ergebnis, dass Deutschlands Wirtschaft mit Innovationsführern weltweit längst nicht mehr Schritt halten kann. In seinem Buch argumentiert Wolfgang Münchau, dass sich die Schwäche der deutschen Wirtschaft in Wirklichkeit schon seit Jahrzehnten zusammengebraut hat. Eine einseitige Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf konventionelle Großindustrien – vorangetrieben durch enge Verbindungen zwischen der industriellen und politischen Elite des Landes – hat das Land technologisch zurückgeworfen und in eine riskante Abhängigkeit von autoritären Staaten wie Russland und China geführt. Gibt es Anzeichen dafür, dass Deutschland in der Lage sein wird, sich an die digitalen Realitäten des 21. Jahrhunderts anzupassen? Eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der sich für die Zukunft von Europas größter Wirtschaft interessiert. "Eine eloquente und umfassende Dekonstruktion des deutschen Modells." Harold James, Financial Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Susanne, Joshua und Elias
Wolfgang Münchau
Kaputt
Das Ende des deutschen Wirtschaftswunders
In der Übersetzung von Britta Fietzke
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an
Umschlaggestaltung: Jack Smyth und Medienhaus RETE OHG
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timișoara
ISBN (Print): 978-3-451-03625-5
ISBN (PDF): 978-3-451-83861-3
ISBN (EPUB): 978-3-451-83859-0
Inhalt
Danksagung
Vorwort
1. Der Kanarienvogel
2. Neuland
3. Energieknappheit
4. Das Chinasyndrom
5. Die Bremse lösen
6. Wir und die anderen
Nachwort
Quellen
Über den Autor
Danksagung
Dieses Buch wäre ohne die großzügige Hilfe Bill Bollingers unmöglich gewesen, denn er hat mich zum Schreiben ermutigt und auch die zugrunde liegende Recherche finanziert. Ich stehe zudem vor allem in Frederick Thelens Schuld, der mir einen Großteil der Recherche für dieses Buch zur Verfügung gestellt hat und dessen Arbeit mehrere der Schlüsselkapitel geprägt haben – zum Finanzwesen, über Russland und China, zur Technologie und Immigration.
Ich möchte weiterhin auch meinen (jetzigen und ehemaligen) Kollegen und Kolleginnen bei Eurointelligence danken, die an mehreren der Stränge unserer deutschen Geschichte gearbeitet haben. Eurointelligence war eine wichtige Quelle für mehrere Erzählstränge in diesem Buch. Und zum Schluss gilt auch noch ein anonymer Dank den unzähligen Kollegen, Gesprächspartnern und Lesern, die im Laufe der Jahre zu einem tieferen Verständnis der Probleme in diesem Buch beigetragen haben.
Vorwort
Die Stadt, in der ich aufwuchs, war nicht sonderlich groß, aber beheimatete große Unternehmen. Mülheim liegt im westlichen Ruhrgebiet und hat inzwischen ungefähr 170.000 Einwohner. Meine täglichen Fahrten mit der Straßenbahn zur Schule Richtung Innenstadt führten mich jedes Mal an zwei nebeneinanderstehenden Fabriken vorbei. Diese waren umgeben von großen grauen Mehrfamilienhäusern, so charakteristisch für Industriestädte in Deutschland und anderen Teilen Europas zu der Zeit. Die eine Fabrik stellte Pipelines her, die andere Kernkraftwerke. Die Eltern einiger meiner Freunde arbeiteten in diesen Fabriken, oft als Ingenieure oder Manager, einer sogar als Atomphysiker. Leitungen und Kernkraftwerke waren die Turbinen der deutschen Wirtschaft, die Lebenskraft des deutschen Industriemodells.
Das war in den 1970er-Jahren. Damals war Deutschland weltweit führend in der Produktion von Kernkraftwerken und entschied sich für die Atomkraft als Stromlieferant der Zukunft. Pipelines spielten eine ebenso große Rolle in der Energiepolitik, vor allem nach der ersten Ölkrise 1973. Es sollten dann auch genau diese Pipelines sein, die Deutschland später den Zugriff auf norwegisches Öl und russisches Gas ermöglichten.
Ein weiterer Aspekt des deutschen Wirtschaftswunders stach in den 1970er-Jahren heraus: der Selfmadeunternehmer. Diese Ära des Unternehmertums hatte in den späten 1940er- und frühen 1950er-Jahren begonnen und dauerte ungefähr bis zur Wiedervereinigung an. Von all den Unternehmern in Deutschland beheimatete Mülheim die erfolgreichsten – und geheimnisvollsten und zurückgezogendsten. Karl Albrecht war der ältere zweier Brüder, der 1946 das Lebensmittelgeschäft seiner Mutter in der Nachbarstadt Essen übernahm. Nach der Einführung der Deutschen Mark 1948 erfanden die zwei Brüder ein neues Verkaufskonzept: den Discounter mit seiner begrenzten Auswahl, aber den dafür sehr niedrigen Preisen. Sie nannten ihn Aldi, ein Akronym für Albrecht Discount. Bis 1955 hatte Aldi bereits einhundert Filialen in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Jedoch gingen die Brüder 1961 dann getrennte Wege: Theo, der jüngere, zog in den Norden Essens, während Karl gen Westen, nach Mülheim, zog, von wo aus er Aldi Süd leitete.
Die Albrechts waren wie die Gespenster unserer Stadt – allgegenwärtig mit ihren Läden, manchmal auf der Straße erspäht, aber meist unsichtbar. Wir gingen davon aus, dass Karl in der Gegend wohnte, aber niemand konnte es mit Sicherheit sagen. Die Albrecht-Familie war aber nicht nur für uns unsichtbar, sondern auch für die Medien und die Politik. Eine Lokalzeitung ging sogar so weit, ein Flugzeug zu chartern, um die Wohngegend nach Karl Albrecht abzusuchen, in der sie ihn vermutete. Die Albrechts gaben nie Interviews. Als Karl schließlich – 2014 im Alter von 94 Jahren – starb, war er nicht nur der reichste Mann Deutschlands und der weltweit zwanzigreichste, sondern hatte auch keinen einzigen Kanzler oder die Kanzlerin persönlich kennengelernt. Er, wie so viele seiner Generation an Unternehmern, hatte seinen Erfolg nicht der Politik zu verdanken.
Die Aldi-Brüder und die Schwerindustrie, an der ich auf dem Weg zur Schule vorbeifuhr, hätten nicht unterschiedlicher sein können. Zusammen aber stellten sie die zwei Säulen des deutschen Wirtschaftswunders dar: die konzerngesteuert-industrielle und die unternehmerische. Aldi existiert immer noch, das Unternehmertum, das es verkörpert, jedoch nicht mehr.
Auch die beiden Fabriken existieren noch. Einige der bekanntesten Industrieunternehmen Deutschlands wurden im 19. und im frühen 20. Jahrhundert gegründet. Manche haben zu kämpfen. Die angestiegenen Strompreise haben ihnen die Wettbewerbsfähigkeit erschwert. Die alte Mannesmann-Pipelinefabrik gehört inzwischen Europipe und hat zwei der Ölpipelines, die Deutschland mit Norwegen verbinden, gebaut. Das andere Unternehmen hieß früher Kraftwerksunion, ein Joint Venture der zwei größten deutschen Elektronikunternehmen, AEG und Siemens. Heute wird die Fabrik von Siemens Energy betrieben. Das Unternehmen ging kurz durch die Presse, als Wladimir Putin die Gasmenge durch die Pipeline Nord Stream 1 im Sommer 2022, also wenige Monate nach der Invasion der Ukraine, reduzierte. Daraufhin stattete Kanzler Scholz der Mülheimer Fabrik einen Besuch ab, weil ihm viel daran lag, dass eine Gasturbine von dort nach Russland geliefert würde, um die Pipeline wieder zum Laufen zu bringen. Es liest sich wie eine Geschichte aus ferner Vergangenheit, aber Deutschland war im Sommer 2022 immer noch äußerst abhängig von russischem Gas. Der Gasfluss endete letztlich im September 2022 – mit der Explosion der Ostsee-Pipelines. Die letzten Atomkraftwerke Deutschlands wurden im April 2023 vom Netz genommen.
Der Wandel des Schicksals meiner Stadt war wie ein Mikrokosmos der Geschehnisse im gesamten Land. Deutschland war zwischendurch das industrielle Machtzentrum Europas und die weltweit größte Exportmacht. Jedoch führte seine Spezialisierung zu Schwachstellen und Abhängigkeiten, denn das Land machte sich abhängig von russischem Gas und chinesischen Exporten. Großbritannien war vor dem Brexit die größte Quelle des deutschen Leistungsbilanzüberschusses –, der die Lücke zwischen Exporten, Importen und Investitionen misst. Dann kam der Bruch mit Russland. Die Beziehungen zu China, vor ein paar Jahren noch der größte Handelspartner, sind auch nicht mehr das, was sie mal während der Hochphase der Hyperglobalisierung gewesen waren. Der größte Schock von allen könnte aber in der Technologie passiert sein. Deutschland war der Weltmeister der analogen Ära, aber digitale Technologien schlichen und schleichen sich fortwährend in unsere Leben. Die Deutschen haben den Benzinmotor erfunden, das Elektronenmikroskop und den Bunsenbrenner, aber nicht den Computer, das Smartphone oder das elektrische Auto. Das ist im Laufe der Zeit zu einem Problem geworden.
Dieses Buch erzählt die Geschichte des Auf- und Abstiegs eines enorm erfolgreichen Industriegiganten. Es ist kein Buch wirtschaftspolitischer Rezepte. Ich erkläre nicht, wie man den industriellen Abstieg Deutschlands rückgängig machen könnte. Das würde eines gänzlich anderen und vor allem dickeren Buches bedürfen. Dies ist vielmehr die Geschichte des Wie und Warum. Auch ist es kein „Kranker Mann Europas“-Buch, denn diese Wandertrophäe europäischer Länder spiegelt wenig mehr als eine Momentaufnahme des Wirtschaftskreislaufs wider. Ich gehe davon aus, dass Deutschland zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Buches bereits wieder aus der Konjunkturschwäche herausgefunden hat, die mit der Pandemie 2020 begann, von der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 befeuert wurde und bis mindestens zum Ende 2023 angedauert hat. Das darunterliegende Unbehagen wird jedoch fortbestehen – und genau darum dreht sich dieses Buch. Das deutsche Wirtschaftsmodell scheitert, und ein Wirtschaftsaufschwung allein wird da nicht helfen.
*
Das deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft hat viele Verehrer im Ausland, vor allem in Großbritannien. Ein solcher, seines Zeichens britischer Journalist und Freund von mir, hat mich vor dem Schreiben dieses Buches gewarnt. Die wichtigste Lektion seines Berufslebens sei gewesen, nie gegen die deutsche Wirtschaft zu wetten. Ich möchte hier versuchen, diesen Rat zwar zu ignorieren, gleichzeitig aber das zugrunde liegende Empfinden zu respektieren.
Deutschland musste schon eine ganze Menge Kritik über sich ergehen lassen, in der sich oft über den deutschen Industriefimmel sowie sein Versagen lustig gemacht wurde zu akzeptieren, dass die modernen westlichen Wirtschaftssysteme auf Dienstleistungen statt Produktionen aufbauen. Bis zu einem gewissen Grad sehe ich das auch so, denn die Deutschen haben einen viel zu engen Blick auf Dienstleistungen, in ihren Augen oftmals ein Anhängsel der Industrie. Jedoch habe ich gleichzeitig das Gefühl, dass die Anti-Industrie-Denkweise in manchen Teilen des Westens zu weit geht. Industrie erschafft mächtige Netzwerkeffekte, die nur allzu gern in Ländern wie Großbritannien oder den Vereinigten Staaten unterschätzt werden.
Deutschlands Geschichte ist voller Momente, in denen es sich, wenn man es am wenigsten erwartet hatte, nicht hat unterkriegen lassen. Die 1950er- und die frühen 1960er-Jahre waren starke Jahre, genauso wie die Zeit zwischen Mitte der 1980er- und 1990er-Jahre sowie dann erneut während der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts. Könnte die aktuelle Schwäche, die sich ab 2017 abzeichnete, einfach nur ein weiteres Intermezzo sein? Würde ich dann nicht demselben Irrtum erliegen wie so viele andere Kritiker des deutschen Modells, wenn ich jetzt zu früh den Abstieg Deutschlands verkünden würde, um dann zu einem späteren Zeitpunkt nur von der Erholung überrascht zu werden?
Ich glaube nicht. Denn Deutschlands aktuelle Finanzkrise unterscheidet sich in einem wichtigen Aspekt von den vorherigen. Wenn Unternehmen wettbewerbsunfähig werden, kann die Regierung die Steuern senken, Arbeitsreformen einführen oder den Wechselkurs beeinflussen. Wenn man jedoch auf die Produktion von Gasheizungen oder Dieselmotoren spezialisiert ist, dann sind nicht die Kosten das Problem, sondern die Produkte. Wenn die Menschen dazu gezwungen werden, Wärmepumpen statt Gasthermen einzubauen oder nach dem Verbrennerverbot 2035 Elektroautos zu kaufen, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Auch wenn die deutschen Autohersteller in ihrer klassischen Produktpalette noch wettbewerbsfähig sind, so können sie doch nicht gegen die chinesischen E-Autos ankommen. Es geht nicht mehr darum, wie man es macht, sondern was man macht.
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist ein neuer Konkurrent auf der Bildfläche. Deutschlands Abhängigkeit von Exporten aus der Verarbeitungsindustrie hat so gut funktioniert, weil es sonst niemanden gab. Einen Großteil der Hyperglobalisierung, also von 1990 bis ungefähr 2020, war Deutschland der unangefochtene Industrieproduzent. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich hatten das Feld verlassen, China es noch nicht erreicht. Der Rest der Welt hat jedoch seit der Pandemie das Ingenieurwesen für sich wiederentdeckt und strömt seither auf dieses Feld, das zuvor fest in deutscher Hand schien. Der ehemalige US-amerikanische Präsident Biden brachte den Inflation Reduction Act ein, durch den Unternehmen aus Bereichen wie der grünen Technologie bei einem Umzug in die Vereinigten Staaten sofortige Subventionen erhalten. Auch China verlagerte sein Wachstumsmodell von der Subventionierung von Infrastrukturinvestitionen hin zur Subventionierung von Fertigungsexporten.
Die Welt wandelte sich, nur Deutschland nicht, und dies ist die Geschichte, wie Deutschland sein Industriekapital herunterwirtschaftete sowie Technologie und Geopolitik falsch einschätzte. Es ist zudem die Geschichte der nationalen Narrative, der Mythen, die wir uns gegenseitig erzählen und irgendwann glauben. Und wie so üblich bei Tragödien, setzt diese in der guten Zeit an.
Die Zeit nach der Wiedervereinigung war eine gute Zeit. Es gibt eine Geschichte von damals, die uns bereits einen Ausblick darauf gibt, was später schiefgehen würde. Anfang der 1990er-Jahre war die deutsche Telekommunikationsbranche noch zum Großteil unverändert. Die Deutsche Post war gleichzeitig auch die bundesweite Betreiberin von Telefonleitungen. Deutsche Telefone waren noch eine sehr analoge Sache. Die analoge Vermittlungsstelle brauchte ihre Zeit, um die Verbindung herzustellen, egal ob der Nutzer nun ein altertümliches Telefon mit Wählscheibe oder eines mit Tasten hatte. Abhängig von Ihrem Alter erinnern Sie sich vielleicht noch an das tickende Geräusch im Hörer – neun Klicks standen für die Zahl neun. Was auch der Grund ist, weshalb Kontinentaleuropa nicht 999 als Notruf hat, sondern die 112 – der Unterschied zwischen 27 Klicks und vier.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereinigten Staaten bereits die digitale Telefonzentrale eingeführt. Seither wurden Telefonate sofort verbunden. Mir fiel während einer USA-Reise in den 1980er-Jahren zu meiner naiven Überraschung auf, dass Ortsgespräche kostenfrei waren, während sie in Deutschland 23 Pfennig kosteten – und bundesweit noch deutlich mehr.
Als junger Auslandskorrespondent der Financial Times in Deutschland war ich Mitte der 1990er-Jahre mit Siemens unterwegs. Es war der Beginn der großen Liberalisierung der Telekommunikationsbereiche. Die Deutsche Telekom war von der Deutschen Post abgespalten und 1995 privatisiert worden. Gleichzeitig war dies auch der Beginn der kurzen Phase des deutschen Shareholder-Kapitalismus, der auf ähnliche Weise ein Jahrzehnt zuvor in Großbritannien abgelaufen war.
Ungefähr zu dieser Zeit vergrößerte sich rasch der Bedarf an mobilen Telefonservices und einer Telekommunikationsinfrastruktur, und Siemens war Deutschlands wichtigster Produzent von Telekommunikationsgeräten und -zubehör, inklusive der ersten Handygeneration. Die Telefone boten nur grundlegende Dienste an, wie den Versand von SMS, sie waren zudem deutlich größer und schwerer als moderne Smartphones. Während unserer Geschäftsreise fragte ich eine der Führungskräfte von Siemens, welche Pläne das Unternehmen denn bezüglich des Handygeschäfts habe. Der Mann antwortete herablassend: „Sie meinen diese kleinen Dinger, die die Menschen mit sich herumtragen?“ Er ließ keinerlei Zweifel daran, dass dies kein Geschäftsmodell für Erwachsene wie ihn sei. Im weiteren Gesprächsverlauf erklärte er mir dann, dass das große Geld nicht auf der Verbraucherseite des Marktes zu finden sei, sondern in der Netzwerktechnologie. Siemens hatte gerade eine analoge Telefonvermittlung nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt. Wie sich herausstellen sollte, war es das letzte seiner Art, ein weiteres Ausstellungsstück für die Museen. Er hatte nicht erkennen können, dass die digitalen die analogen Technologien besiegen würden und dass das große Geld tatsächlich in den Handys zu finden war.
Im Rückblick lässt sich leicht über den Mangel an digitaler Weitsicht in Deutschland spotten – aber es ist dennoch erstaunlich, wenn man sich die Geschichte anschaut. Deutschland war das Land, in dem die digitale Revolution im 20. Jahrhundert ihre Wurzeln hatte. Deutsche Physiker – Max Planck, Max Born, Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg – gehörten zu den Entdeckern der Quantenmechanik, der Physik, die sowohl zur Entwicklung der Atombombe als auch des Halbleiters führte. In Christopher Nolans Film Oppenheimer findet sich eine Szene, in der der Held als junger Mann vom dänischen Physiker Niels Bohr den Rat bekommt, doch in Göttingen zu studieren, denn dies war zur damaligen Zeit Deutschlands berühmteste Universität und brachte 47 Nobelpreisträger hervor, u. a. die weltbekannten Physiker Born und Heisenberg. Göttingen war genauso wichtig für die Mathematik, denn hier forschten unter anderen Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann, David Hilbert und Emmy Noether.
All das änderte sich jedoch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Viele Wissenschaftler flohen in die Vereinigten Staaten, die zu diesem Zeitpunkt in diesem Bereich nicht sonderlich gut ausgebildet waren. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden somit die Vereinigten Staaten die Wiege der Quantenphysik, die den Grundstein für die moderne digitale Technologie und digitale Kommunikationssysteme gelegt hat. Die weltweite Führung dabei ist bis heute unbestritten. Deutschland hatte eine ähnlich positive Dynamik mit dem Personenkraftwagen erlebt, nachdem Gottlieb Daimler im späten 19. Jahrhundert dieses bis ins 21. Jahrhundert so ergiebige Produkt erfunden hatte. Der große Unterschied liegt nur darin, dass sich die Ära des Verbrenners dem Ende entgegenneigt, aber die digitale Ära gerade erst begonnen hat.
Deutschland stand am Ende des Zweiten Weltkriegs nun mit großen Universitäten ohne Physiker und Mathematiker da, hielt aber noch an einigen wenigen Bereichen der technologischen Exzellenz fest, wie dem Maschinenbau, der Elektrotechnik und der Chemie. Das Land spielte in der frühen Phase der Computer- und Softwareentwicklung in den 1970er-Jahren immer noch eine große Rolle. (Eines der damals gegründeten Unternehmen, SAP, ist nach wie vor ein Softwaregigant und der einzige bedeutsame deutsche Repräsentant in der weltweiten Techbranche. Von den weltweit wichtigsten 50 Techfirmen ist sie die einzige deutsche. Aus dem EU-Raum kommen drei – inklusive SAP.)
Die deutsche Regierung begriff auch zu ungefähr dieser Zeit, wie wichtig die digitale Technologie werden würde. Die von Willy Brandt eingesetzte Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems (KtK) setzte Anfang der 1970er-Jahre einen Zeitplan auf für die Einführung der Lichtleiternetzwerke, der Glasfaser – um so für das kommende Computerzeitalter gewappnet zu sein. Ein seltener Fall, bei dem deutsche Politiker mal korrekt einen Megatrend identifiziert hatten und für die Zukunft dementsprechend planen wollten, und es dürfte wohl die beste Entscheidung gewesen sein, die die deutsche Regierung in der modernen Zeit in technologischer Hinsicht je getroffen hat. Wäre es bei dem vorgeschlagenen Zeitplan der Wissenschaftler geblieben, wäre das Land allen anderen im Westen mit der Verbreitung des schnellen digitalen Netzwerks um Jahre voraus gewesen. Und die deutsche Wirtschaft sähe heute ganz anders aus.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, als die Firma meines Vaters sich Mitte der 1970er-Jahre einen Computer anschaffte – ein Monstrum von einem Gerät, das die Hälfte des Büros in Beschlag nahm. Der Computer war ein Olivetti, ein italienisches Produkt, und lief mit deutscher Software von SAP. Diese ermöglichte es den Unternehmen, ihre Rechnungsstellung, Gehaltsabrechnungen, Logistik und Buchhaltung zu optimieren. Der PC, also der Computer für den Heimgebrauch, sollte noch einige Jahre auf sich warten lassen, aber Deutschland und die anderen europäischen Länder gerieten dann im Laufe der 1980er-Jahre, nach der Einführung des PC von IBM und des Apple Macintosh, im Vergleich zu den USA unwiderbringlich ins Hintertreffen. Jedoch war nicht die Tatsache, dass Deutschland nicht den PC entwickelt hatte, das größte Problem, sondern dass es immer wieder die Wette gegen das digitale Universum einging.
Als Helmut Kohl 1982 Kanzler wurde, bevorzugte er während seiner Legislaturperioden die schnellen Erfolge. Er setzte sich zusammen mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand für ein hochauflösendes Kabelfernsehen ein, eine analoge Technologie, mit der sie sich ein äußerst beliebtes Fernseherlebnis erhofften. Wie so oft bei Projekten dieses Ausmaßes brauchte die Umsetzung länger als gedacht und sah sich konfrontiert mit unvorhergesehenen technischen und behördlichen Schwierigkeiten. Während der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien übertrug die italienische Rundfunkgesellschaft RAI die Spiele in HDTV, allerdings nur in acht Kinos im Land. Das gesamte Unterfangen war aus technischer Sicht immer schwieriger umzusetzen, und die analoge Ära des HDTV wurde 1993 offiziell für beendet erklärt.
Nicholas Negroponte, der damalige Leiter des MIT Media Lab, veröffentlichte 1995 ein hochgradig einflussreiches Buch in den Vereinigten Staaten, das im selben Jahr auch auf dem deutschen Markt erschien: Total digital. Negroponte erklärt darin, wie die digitalen Technologien in alle Aspekte des täglichen Lebens hineinwirken würden – und dabei gehe es nicht nur um die Desktop-Computer. Er führt auch aus, warum analoge Technologien wie HDTV oder Siemens’ analoge Telefonanlagen dem Tode geweiht seien im Angesicht der schnell entstehenden digitalen Alternativen. Negropontes Buch spielte eine kaum zu unterschätzende Rolle dabei, die US-amerikanische Unternehmenswelt und die dortigen Universitäten auf die kommenden Möglichkeiten einzustimmen.
Es hatte einen deutlich geringeren Einfluss in Europa, außer in einer eher misslichen Hinsicht. Die digitale Revolution der 1990er-Jahre und die Marktliberalisierung der europäischen Telekommunikation führten zu einer kurzlebigen Spekulationsblase, der sogenannten Dotcom-Blase. Besonders hart traf es Deutschland, wo sich der Dotcom-Hype auf einen neu geschaffenen Kleinaktienmarkt, den Neuen Markt, konzentrierte. Am Neuen Markt wurden zahlreiche neue Techunternehmen gelistet, mit größtenteils zweifelhafter Herkunft, auf die aber viele einfache Sparer und Investoren große Summen setzten. Die Gewinnerwartungen wurden von Anlegerzeitschriften und selbst ernannten Börsengurus angefeuert, die ihr Geld mit fragwürdigen Aktientipps verdienten. Es fühlte sich an wie eine moderne Variante der Tulpenblase, ein berüchtigtes Beispiel aus den Niederlanden des 17. Jahrhunderts für den Inbegriff einer irrationalen Spekulationsblase.
Als Mitglied des Teams, das die Financial Times Deutschland 2000 gegründet hatte, lebte ich gerade in Hamburg und verfolgte die Geschichte mit wachsender Verzweiflung.
Ich erinnere mich noch gut an einen Abend, an dem ich mir am Hamburger Hauptbahnhof ein Taxi schnappte. Sobald der Fahrer erfahren hatte, dass ich Finanzjournalist sei, fragte er, ob ich besondere Kenntnisse über den aktuellen Börsengang eines bestimmten Unternehmens hätte, das kurz vor der Notierung am Neuen Markt stehe. Er war ziemlich geschockt, als ich erwiderte, dass ich das nicht wisse und es mich auch nicht interessiere, weil meine Ersparnisse in einem langweiligen Investmentfonds schlummerten. Dennoch öffnete es mir die Augen, dass mich – ausgerechnet in Deutschland – ein Taxifahrer über Unternehmensanteile ausfragte, das Ganze musste also schon zu weit gegangen sein. Der Markt brach nur wenig später immer weiter ein. Der Neue-Markt-Index erreichte im März 2000 seinen Höhepunkt mit 9666 Punkten und fiel auf 318 im Oktober 2002 ab – ein Verlust von 96 Prozent. Der Crash hatte die gleichen Ausmaße wie die Tulpenmanie – wenn nicht gar schlimmer als damals, denn die meisten der im Neuen Markt gelisteten Unternehmen waren nun wertlos, während den Unglücklichen in Amsterdam 1637 immerhin noch die Tulpen blieben.
Dies war die erste Begegnung der deutschen Öffentlichkeit mit der digitalen Welt. Es ließ das Land mit einer Stimmung des „nie wieder“ zurück, wie es eine Zeitung formulierte. Auch in den Vereinigten Staaten platzte die Dotcom-Blase, war jedoch nicht das Ende des Dotcom, sondern der Beginn einer neuen Phase des digitalen Zeitalters mit dem Aufstieg der großen (US-amerikanischen) digitalen Unternehmen wie Amazon, Apple, Google und Facebook.
Deutschland konnte nach wie vor die traditionellen Branchen vorweisen. Menschen machen das, worin sie gut sind, und bei Ländern ist es dementsprechend auch so. Die Vereinigten Staaten haben die Digitalbranche und Hollywood, Frankreich hat Essen und Mode, Großbritannien die Finanzwelt. Deutschland spezialisierte sich auf Autos sowie Maschinen- und Chemieingenieurwesen. Zur Zeit der Wiedervereinigung hatte Deutschland einige der wichtigsten Industriebetriebe der Welt, wie Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Continental, Hoechst, BASF, Bayer, Linde, Mannesmann und Bosch.
Jenseits dieser Megastars gab es Tausende mittelständische Unternehmen, zumeist familiengeführt, die oftmals in Nischenmärkten unterwegs waren. Viele dieser mittelständischen Unternehmen wurden als Hidden Champions der Wirtschaft gepriesen, denn sie waren nur allzu oft Marktführer in ihrem jeweiligen Segment. In England machte man sich gern über solcherlei Produkte wie Kugellager, hydraulische Geräte oder Präzisionswerkzeug lustig, sah sie als Spielereien an. Dennoch waren (und teilweise sind) dies immens erfolgreiche Unternehmen, waren Weltmeister des Ingenieurwesens und im Nachkriegsdeutschland erst so richtig aufgeblüht, in einer sowohl unternehmerischen als auch innovativen Zeit. Dieses Wirtschaftswunder gab es wirklich.
Letztlich war neue Technologie – von anderen erfunden und hergestellt – in den Markt eingedrungen. Der US-amerikanische Ökonom und Journalist Paul Krugman machte mal eine äußerst kluge makroökonomische Beobachtung: Der tatsächliche Vorteil durch Handel komme von den Importen, nicht den Exporten. Kein ökonomischer Kommentar könnte je noch gegenläufiger zum deutschen Denken über wirtschaftlichen Erfolg sein, denn die Deutschen definieren Erfolg über Exporte. Krugman wollte damit jedoch zum Ausdruck bringen, dass Importe es einem ermöglichen, Waren und Dienstleistungen zu konsumieren, die man entweder nicht selbst oder nicht mit Profit selbst herstellen kann. Diese Logik greift auch bei digitalen Technologien. Selbst wenn man sie nicht eigenhändig hergestellt hat, so kann man sie doch nutzen – oder sich einen Minderheitsanteil am herstellenden Unternehmen erwerben. Das war auch Negropontes Argument: Digitale Technologien wirken auf die analoge Welt ein. Deutsche Unternehmen und die aufeinanderfolgenden Regierungen erkannten das jedoch nicht. Und wenn sie es taten, dann zogen sie die falschen Schlüsse daraus und verdoppelten eher ihre Anstrengungen bei dem, was sie eh schon machten oder hatten.
Ein gutes Beispiel dieses digitalen Einwirkens ist das moderne Handy. Das Smartphone beinhaltet Funktionen, für die man früher mehrere mechanische, elektrische und andere physische Geräte – die Kamera, die Taschenlampe, den Kompass, die Landkarte, die Rolodex und, ja, auch das Telefon – brauchte. Dinge, von denen viele in Deutschland hergestellt wurden. Smartwatches können bereits unseren Puls messen und ein Langzeit-EKG erstellen. Digitale Geräte können, wenn auch noch nicht ganz perfekt, unseren Schlaf überwachen. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass Smartwatches auch unseren Blutdruck messen können. Ein Smartphone beinhaltet Sensoren, aber keinerlei mechanische Bestandteile.
Die digitale Technologie übernimmt auch immer mehr Bereiche der Autoherstellung – der wichtigsten deutschen Industriebranche. Ein Auto wird immer Räder und Achsen brauchen, die sich drehen, aber ein modernes E-Auto ist nicht mehr ein grundsätzlich mechanisches Produkt: Ein Großteil seines Werts liegt in der Software und der Batterie.
Wenn Software immer mehr auf traditionelle Hardware einwirkt, bedeutet dies automatisch auch die Gründung neuer Unternehmen. Die heutigen digitalen Riesen sind noch gar nicht so alte Unternehmen. Es war nicht Smith Corona, der US-amerikanische Schreibmaschinenhersteller, der den PC erfand, sondern er integrierte den Computer in seine Schreibmaschinen, und das gar nicht mal so schlecht. Dennoch schaffte es das Unternehmen nicht, jenseits der Schreibmaschine zu denken. Seine Strategie ging zunächst recht gut auf, zumindest bis in die 1980er-Jahre – bis sie es eben nicht mehr tat.
Deutschland hat ein Smith-Corona-Problem. Es klammert sich schon zu lange an alte Technologien und Unternehmen fest. Innovation war untrennbar mit Bestandsunternehmen verbunden. Innovation wurde davon definiert, was VW, BMW und Mercedes als solche ansahen. Auch das funktionierte, bis es das eben nicht mehr tat.
Die digitale Welt ist aber im Gegensatz dazu eine Welt der Start-ups. Diese brauchen Hilfe – meist in Gestalt eines starken Kapitalmarkts – und müssen oftmals einfach in Ruhe gelassen werden, statt sie mit Bürokratie zu behindern. Deutschland hat ein großartiges Unterstützungsnetzwerk für bestehende Unternehmen, aber nicht für Start-ups. Es lässt modernes Risikokapital vermissen. Fördermittel sind auf große Unternehmen mit Rechtsabteilungen ausgerichtet, nicht auf Gründer, deren Gedanken sich einzig um ihre Gründungsidee drehen. Das Problem der Bürokratie: Große Unternehmen kommen irgendwie zurecht mit ihr – kleine aber nicht.
Seit den frühen Nullerjahren ist die digitale Lücke zwischen Deutschland und dem Rest der Welt noch größer geworden. Angela Merkel bezeichnete 2013 das Internet bekanntermaßen als Neuland – zu der Zeit war das iPhone bereits seit sechs Jahren auf dem Markt, und die Vereinigten Staaten brachten das Web3 auf den Weg. Die Big-Data-Revolution war in vollem Gange, aber Deutschland war schon in vielen Aspekten der digitalen Entwicklung zurückgefallen, von den Glasfasernetzwerken und der mobilen Kommunikation bis hin zur Verbreitung der digitalen Technologien in Schulen und der künstlichen Intelligenz. Das deutsche Gesundheitswesen und der Polizeidienst nutzen nach wie vor noch Faxgeräte.
Auf viele Arten ist diese Verweigerung gegenüber den modernen Technologien die eigentliche Erbsünde. Im Laufe der Zeit beharrten deutsche CEOs und Politiker auf schlechten technologischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Wegen – und das in dem Glauben, dass die Wirtschaft im großen Ganzen mit der traditionellen Industrie gleichzusetzen sei. Das ist auch der Grund, weshalb das größte Konzept innerhalb der gesamtdeutschen Wirtschaftsdiskussion die Wettbewerbsfähigkeit ist, ein Aspekt, der für Unternehmen wirklich wichtig ist, aber selten für Länder. Davon hört man in Debatten über Wirtschaft in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten fast nie etwas – in Deutschland aber von fast nichts anderem.
Ich stolperte die Tage über ein Buch von Hans-Olaf Henkel, einem ehemaligen Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der später im Leben (2014) für die AfD ins Europäische Parlament einziehen sollte. Eine seiner großen Klagepunkte war die Tatsache, dass Deutschland seine Textilindustrie verloren habe; er lässt dabei aber unter den Tisch fallen, dass es allen anderen westlichen Ländern genauso erging. Wenn er David Ricardos Theorie des komparativen Kostenvorteils verstanden hätte, dann wüsste er, dass es völlig normal ist, dass hoch entwickelte Länder bestimmte Sektoren an Entwicklungsländer verlieren. Dennoch blieb Henkels Narrativ in Deutschland in den Köpfen hängen. Es ist der Kampf gegen Ricardo. Eine höhere Wettbewerbsfähigkeit wurde zur Antwort auf jede Wirtschaftskrise.
Dieser Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit schien von 2005 bis ungefähr 2015 zu funktionieren. Das ist die Geschichte des modernen deutschen Wirtschaftswunders – die Geschichte, die viele Menschen durcheinanderbrachte. Deutschland schaffte es, ein überholtes Industriemodell dank einiger Zufälle um ein paar Jahre zu verlängern. Wenn man weniger genau hinschaut, scheinen diese zehn Jahre ein Gegennarrativ zu meiner Geschichte hier darzustellen, die genauere Betrachtung beweist jedoch das Gegenteil. Diese Jahre sind weniger die Ausnahme, die die Regel bestätigen, als vielmehr das Fundament für die zukünftige Krise.
Der Wiederanstieg begann mit Kanzler Schröders Arbeitsmarktreformen 2003, zu deren Effekten für lange Zeit die Lohnmäßigung zählte. Die Babyboomer, damals zwischen 40 und 55 Jahre alt, waren noch fest im Arbeitsleben verwurzelt. Sie hatten einen passablen Lebensstandard, aber Angst vor der Arbeitslosigkeit, denn viele hätten in dem Alter Probleme gehabt, eine neue Stelle zu finden. Die wichtigste Reform war die Kürzung der Sozialleistungen für jene, die Jobangebote ablehnten. Die Reformen und die daraus resultierende Lohnbremse erklären in gewissem Maße, wie es deutschen Unternehmen in diesem Zeitraum gelang, ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Rest Europas und der Welt zu verbessern.
Gleichzeitig wurde der deutschen Industrie von günstigem russischen Gas, der Liberalisierung der Containerschifffahrt und -logistik sowie der Globalisierung geholfen, der es nach deutschen Fabriken und Maschinen verlangte. Deutsche Unternehmen waren die Hauptnutznießer der Revolution der weltweiten Lieferkette.
Der schnelle Aufstieg Chinas und anderer asiatischer Tigerstaaten erschuf eine starke Nachfrage vor allem nach Industrieanlagen und Maschinerien, also einer Technologie, auf die Deutschland spezialisiert war und die sonst niemand wirklich zu bieten hatte. China und Indien würden die Weltmärkte mit ihren Produkten überschwemmen. Deutschland würde China und Indien mit in Deutschland hergestellten Fertigungsanlagen überschwemmen. Das war eine Win-win-Situation, bis sie es eben nicht mehr war.
Die Eurokrise, die 2010 begann, brachte der deutschen Industrie auch einige unvorhergesehene Vorteile ein. Sie war von einer massiven Überschreitung des griechischen Haushaltsdefizits Ende 2010 losgetreten, wenn auch nicht verursacht worden. Die Krise breitete sich entlang der EU-Grenzen aus, an den Rändern der Eurozone, und bedrohte 2012 dann sogar deren Existenz. Mario Draghi, der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, griff ein und gab seine berühmte Erklärung ab, dass er alles Erdenkliche tun werde, um den Euro zu retten. Die Krise führte zu einer massiven Entwertung des Euro gegenüber dem Dollar, was die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wiederum noch weiter steigerte, weil die Exporte so noch günstiger waren.
Ich bezeichnete dies immer als Beggar-thy-Neighbour-Strategie: einer Währungsunion beitreten, um erst den Wechselkurs mit den Handelspartnern festzulegen, dann aber zur Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit die Löhne zu senken. Auch das hat wunderbar funktioniert – bis es das eben nicht mehr tat.
Eine Zeit lang aber hatte sich alles für Deutschland im Sinne der Industrie gewandelt – das Gas, der Wechselkurs, die Globalisierung und die Revolution der globalen Logistik. Die Fanboys in den nationalen und internationalen Medien feierten das neue Wirtschaftswunder. Die Trophäe des kranken Mannes vom Bosporus war schon lange an andere weitergereicht worden.
Jedoch wurden zu dieser Zeit, in den 2010er-Jahren, viele der schlechtesten Entscheidungen getroffen: Deutschland machte sich noch abhängiger vom russischen Gas; es investierte zu wenig in den Glasfaserausbau, die digitale Infrastruktur und Technologie; es steigerte seine Abhängigkeit von Exporten. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts verzeichnete Deutschland mehrere Jahre lang Leistungsbilanzüberschüsse von mehr als acht Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist für eine Wirtschaft der Größe Deutschlands wirklich unglaublich.
All das ist Teil des neomerkantilistischen Modells, wie ich es nenne. Neomerkantilismus ist keine Politik, sondern ein System. Und alle in Deutschland unterstützten es. Die Protagonisten waren die zwei größten Parteien: Merkels Christdemokraten und ihre bayerische Schwesterpartei CSU zusammen mit den Sozialdemokraten. Letztere waren, mit nur einer vierjährigen Pause, durchweg Teil der Regierung seit 1998. Auf einer Ebene ist das Ziel des Neomerkantilismus das Erreichen großer Exportüberschüsse, also die Fortsetzung der französischen Handelspolitik des 18. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert mit Unternehmen aus dem 19. Jahrhundert, die die Technologien des 20. Jahrhunderts nutzen. Auch das funktionierte, bis es das eben nicht mehr tat.
Merkantilisten, alt wie neu, misstrauen disruptiven Technologien. Sie handeln gern mit physischen Waren. Das merkantilistische Mindset geht Hand in Hand mit der Technophobie. Man nehme die zwei zusammen, mische etwas finanz- und geldpolitischen Konservatismus sowie ein protektionistisches Finanzmodell hinzu, und voilà, fertig ist das deutsche Wirtschaftsmodell.
Die Unterstützung für das neomerkantilistische Modell geht über die Politik hinaus und spiegelt sich auch in der Berichterstattung der Medien über die Wirtschaft wider. Zeitungen schreiben über Überschüsse wie über Fußball. Mehrere Jahre lang erklärten die deutschen Medien Deutschland zum Export-weltmeister, ohne dass diese Kategorie irgendeine wirtschaftliche Bedeutung gehabt hätte. Damit feierte man ein wirtschaftliches Ungleichgewicht – sowie die politische und wirtschaftliche Abhängigkeit, die sich später als äußerst ungesund und teuer herausstellen sollte.
Korporatismus ist das innenpolitische Gegenstück zum Neomerkantilismus. Für eine merkantilistische Politik muss ein Land Hand in Hand mit dem Unternehmenssektor zusammenarbeiten, daher ordneten linke wie rechte Regierungen jahrzehntelang die nationale Politik den Interessen bestimmter Vorzeigeindustrien unter. Die Vorstände dieser ausgewählten Branchen hatten wiederum einen besonderen Zugang zur Regierung – im Gegensatz zu Karl Albrecht, dem unternehmerischen Antihelden aus meiner Heimatstadt. Manchmal bekam man glatt das Gefühl, dass die Chefs der Autoindustrie ihre ganz eigenen Schlüssel zum Kanzleramt hätten.
Das ist auch der Grund, weshalb Fehleinschätzungen im Unternehmensbereich verstärkt werden. Alle hängen auf- und aneinander. Alle glauben an das alte Wirtschaftsmodell. Wenn man wie so viele Deutsche heutzutage glaubt, dass man eine Verbrennungsmotorindustrie für eine erfolgreiche Wirtschaft braucht, dann übersieht man vielleicht sogar das elektrische Auto, bevor es einen überfährt. Die (durchweg männlichen) Chefs der Autoindustrie betrachteten elektrische Autos ursprünglich eher als Mädchenspielzeug. Ferdinand Piëch, der damalige Vorsitzende bei VW, brachte den legendären Spruch, dass kein Platz in seiner Garage für elektrische Autos sei. Diese Ansicht ging mit der des Siemens-Managers einher, der das Handy als „kleines Gerät“ abgetan hatte. Sie alle machten den Thomas-Watson-Fehler, wie ich es nenne: Watson war in den 1940er-Jahren der berüchtigte Vorsitzende bei IBM, der prognostizierte, dass es auf der Welt vielleicht einen Bedarf von fünf Computern geben werde.