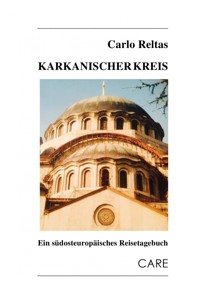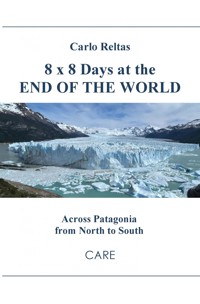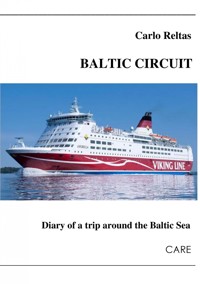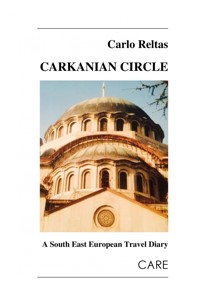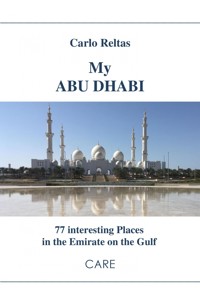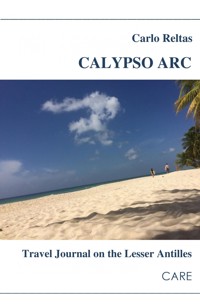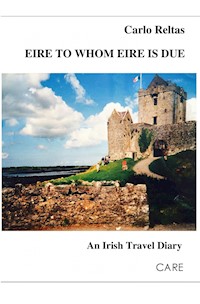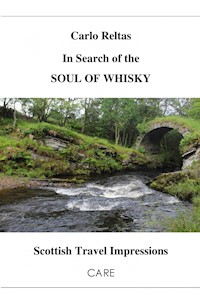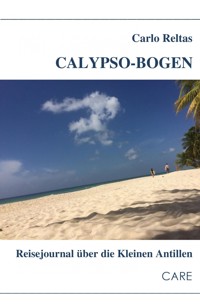Carlo ReltasKARKANISCHER KREISEin südosteuropäisches Reisetagebuch
Der Kreis ist ein langer, gewundener Weg.
Der Weg des Karkanischen Kreises führt ins Herz Europas.
C. Reltas
Carlo Reltas
Karkanischer Kreis
-
Ein
südosteuropäisches
Reisetagebuch
CARE Verlag
Heppenheim
Titelbild:
Die unfertige Kathedrale des Heiligen Sava in Belgrad,
das größte Kirchengebäude in Südosteuropa (2002)
Alle Fotos (außer Autorenporträt):C. Reltas
© Copyright by CARE of Sattler, 2017eBook 2019ISBN: 978-3-748542-19-3
CARE of Sattler
Bensheimer Weg 29, 64646 Heppenheim
Vertrieb:epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin www.epubli.de
Inhalt
Cover
Wahlspruch
Titel
Impressum
DIE GROSSE ERSTE RUNDE (September 2002)
Besuch bei Damen und der Tochter
Oleg – Cicerone von Černivci
Zwanzig Stunden bis Odessa
Die Schöne an der See und die Schönen
Blauer Montag am Schwarzen Meer
In der Holzklasse nach Moldawien
Chişinǎu: Wohlleben in einem armen Land
Im Schneckentempo nach Rumänien
Bukarest – verwundet und wunderlich
Im Bosporus-Express
Am Goldenen Horn
Kultur-Mix – ein bulgarisches Intermezzo
Thessalonikisches Tagebuch eines Alien
Die Schatten von Skopje
Serbien am Scheideweg
Zagreb – zwischen k. u. k. und EU
Fahrt entlang der grünen Save
Ljubljana – Idyll und Ideale unter der Burg
DIE KLEINE ZWEITE RUNDE (August 2015)
Goldene Stadt am Dnjepr
Erstaunliches und eigenartiges Minsk
Altes Ragusa, junges Dubrovnik
Kriegsopfer Mostar und Sarajevo
Priština – Europas neueste Hauptstadt
Die Riesen von Skopje
Tirana – Hauptstadt der Shkipetaren
Ernste Lage im früheren „Operettenstaat“
DANACH
Černobyl, Mežyhirja, Babyn Jar (2016)
SCHLUSSSTEIN
Ein Nachwort aus Prag (2016)
Karten
Über den Autor
Vom selben Autor
DIE GROSSE ERSTE RUNDE
(September 2002)
Dank an
Oleg, Jean-François, Sandra & Tim, Pierre-Michel, Jérôme und Vessela
Besuch bei Damen und der Tochter
„Dzien dobry, Polska!“ Wie auf dem Nordostkurs rund um die Ostsee, zu dem Karl vier Jahre zuvor aufgebrochen war, so führt auch sein Weg nach Südosten auf dem Karkanischen Kreis entlang der Karpaten und über die Balkan-Halbinsel zunächst nach Polen. Verschlafen war er dem Berliner Nachtzug nach Krakau entstiegen. Am Bahnhof wartet schon der Obwarzanki-Verkäufer mit seinen frisch gebackenen Sesam- und Mohnkringeln. Diesen Kringeln wird Karl auf seiner Reise noch öfters begegnen, Obwarzanki hier, ähnliche Namen an den Stationen der Reise bis hin nach Istanbul, wo ein verwandtes und gleichermaßen beliebtes Gebäck Simit heißt. Die Kringel duften warm. Er nimmt gleich zwei davon. „Dzien dobry, Polska! Guten Morgen, Polen!“
Die alte Königsstadt Krakau ist noch feucht vom morgendlichen Sommerregen. Karl und seine Berliner Freundin wandern am begrünten Stadtring entlang, der nur wenige hundert Meter südlich des Bahnhofs beginnt. Nora begleitet ihn auf seiner Südosteuropatour bis in die alte polnische Königsstadt und wird am folgenden Tag von dieser ersten Station des karkanischen Kreises in die deutsche Hauptstadt zurückkehren. Ihr gemeinsames Ziel ist das Gästehaus der Jagiellonen-Universität. Wer hat dort nicht alles studiert, der unvergleichliche Seher Stanislaw Lem zum Beispiel, der weltberühmteste Science-Fiction-Autor, der sich selber lieber mit feiner Ironie einen „heimwerkelnden Philosophen“ der Moderne nannte. Oder Wislawa Szymborska, die Szymborska, die große alte Dame der polnischen Poesie und Literaturnobelpreisträgerin von 1996. In den Tagen seines Besuchs zusammen mit Nora leben beide noch in der Stadt, wo nach wie vor das Herz der polnischen Literatur schlagen soll. So war es nur logisch, dass die Europäische Union just im Milleniumsjahr 2000 auch Krakau zur Kulturhaupstadt Europas erkoren hat. Angetroffen aber haben die beiden die beiden nicht, nicht im Uni-Gästehaus und auch nicht im Garten des Literaturhauses, wo sie angeblich ein- und ausgingen.
In der Floriansgasse, über die einst auch die polnischen Herrscher Einzug in die Stadt an der Weichsel hielten, steigen sie in die zweite Etage ihrer Wissenschaftlerherberge und schauen aus den breiten Fenstern auf diese Fußgängerstraße, unten Geschäfte aller Art und der auch in Osteuropa allgegenwärtig gewordene McDonald‘s. Zur Rechten fällt der Blick nochmals auf den mächtigen Barbakan, die wuchtige Bastei mit meterdicken Ziegelmauern, die die spätmittelalterlichen Stadtherren zum Schutz ihrer Reichtümer außen vor das Florianstor gesetzt haben. Zur Linken mündet die Florianska in den Hauptmarkt, wo das steht, was es zu beschützen galt, die Reichtümer der Stadt, nicht zuletzt versammelt in den Tuchhallen, dem prächtigen, langgestreckten Gebäude inmitten dieses Haupthandelsplatzes.
Nachdem die beiden Berliner die Unibetten ausprobiert und sich auch sonst gut erholt haben, wollen sie unbedingt einer anderen Dame ihre Reverenz erweisen oder – genau genommen – sie schauen und bewundern: die Dame mit dem Hermelin, ein Meisterwerk Leonardo da Vincis, das 1800 vom Fürsten Adam Jerzy Czatoryski erworben wurde und nun normaler Weise im Czatoryski-Museum zu sehen ist. Aber ach, just bei ihrem Besuch befindet sich Cecilia Gallerani mal wieder auf Reisen. Doch Karl wird die schöne Geliebte des Mailänder Fürsten Ludovico Sforza einige Jahre später doch noch zu Gesicht bekommen. Die junge Italienerin mit dem verträumten Blick zur Seite und dem eigenartigen Streicheltier auf dem Arm kommt als eines der „Gesichter der Renaissance“ 2011 nach Berlin. Von dieser Ausstellung im Bode-Museum bringt er ein Plakat mit heim und hängt es zu Hause auf, so dass er sich am Anblick der in Krakau mit großem Bedauern vermissten Schönen seitdem täglich ergötzen kann.
Im Viertel nahe dem Czatoryski-Museum lockt so manches Café zur Einkehr. Mit Jolanda, Karls Tochter, die ab Herbst 2005 als Erasmus-Studentin fast ein Jahr in Krakau verbringt, kehrt er dort gerne ein. In einer romantischen Stube mit alten Nähmaschinen und anderem Zierrat von anno dunnemals schlürfen sie heiße Schokoladen. Noch nostalgischer wirkt das Ambiente im „Es war einmal in Kazimierz“ (Dawno temu na Kazimierzu). Das Restaurant im alten Judenviertel Kazimierz mit diesem elegischen Namen nimmt den Besucher mit auf eine Zeitreise. An der Längsseite des Hauses zur Straße scheinen sich Zugänge zu fünf verschiedenen Lädchen aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zu befinden. Betritt man das Haus von der zum Szeroka-Platz mündenden Schmalseite taucht man jedoch in ein Speiselokal aus einer vergangenen Welt ein. Auch hier die unvermeidliche Singer-Nähmaschine, ein reich verzierter eiserner Ofen, alte Holztische, siebenarmige Leuchter, in den Regalen Werkzeug traditionellen Handwerks – der ganze Raum gibt Zeugnis von Krakaus jüdischer Kultur vor dem Holocaust. Karl und seine Tochter lassen sich dort eine Kartoffelsuppe munden, die wunderbar schmeckt, jedoch so stark mit Knoblauch gewürzt ist, dass sie ärgste Befürchtungen für den Rest des Abends hegen. Aber Jolandas Studienkollegen und Freunde lassen sich nichts anmerken, als Tochter und Vater nach ihrem nostalgischen Abendmahl zum Konzert im jüdischen Kulturzentrum eintreffen.Die berühmteste Klezmer-Band Krakaus mit Namen Kroké, was nichts anderes als das jiddische Wort für Krakau ist, spielt endlich mal wieder in ihrer Heimatstadt. Mit Viola, Flöte, Akkordeon, Bass und Schlagzeug ist die Besetzung etwas anders als die einer traditionellen Klezmer-Combo. Vor allem scheuen Tomasz Kukurba und seine Mitstreiter bei der Modernisierung des Klezmer nicht die elektronische Verstärkung bis hin zur Verzerrung. Klezmer ist ja sowieso schon sehr dynamisch. Aber Krokés Temperament und Musik wird manchmal geradezu wild, geht zurück zum Zarten und beschleunigt erneut – und das alles mit atemberaubender Virtuosität in mal rasantem, mal getragenem Spiel. Ist das noch Klezmer? Ist das nun Jazz? Es ist KROKÉ! Das junge Publikum im neu verglasten Foyer des Kulturzentrums ist hingerissen vor Begeisterung.
Nach dem Konzert verziehen sich die Musikenthusiasten in die Kneipen rund um den Neuen Platz mit seinem Marktrundbau in der Mitte. Als Karl sieben Monate später zusammen mit seinem Sohn Fabian erneut nach Krakau reist, um Jolanda nach dem Erasmus-Jahr mitsamt ihrem neu erworbenen polnischen Hausstand nach Berlin zurück zu verfrachten, da geht es wieder zur Kneipenszene am plac Nowy. Es ist WM-Zeit. In den Hinterräumen oder im Obergeschoss der Schankstätten flimmern die Großbildschirme. Deutschland gegen Argentinien, Italien gegen Ukraine – die Emotionen unter den Erasmus-Studenten aus allen möglichen Ländern Europas und ihren polnischen Gastgebern wogen hoch. Fußballkonflikte sind die Schönsten, denn nach Frust oder Freude, nach Sieg oder Niederlage sind Versöhnung und Frieden beim Bier danach schnell wiederhergestellt.
Doch zurück zur Karkanien-Tour: Das Kazimierz mit seinen Synagogen, dem jüdischen Friedhof und den sonnigen Straßencafés am Szeroka-Platz gehören natürlich auch zum Programm von Nora und Karl. Auch dem Touristenstrom zur Königsburg Wawel schließen sie sich an. Oberhalb der Weichsel am Südrand des Stadtrings gelegen, hat man von dort einen schönen Blick über die Flusslandschaft und auf die Industrievorstädte. In der ehemaligen Emaillewaren-Fabrik Oskar Schindlers ist dort inzwischen ein staatliches Geschichtsmuseum entstanden, das die Zeit der deutschen Besatzung von 1939 bis 1945 zum Thema hat und natürlich auch das Schicksal der Juden im Krakauer Ghetto.
Das Innere der Burg entfaltet monarchische Pracht, in der Kathedrale mit ihren berühmten Toten wie auch im eigentlichen Schloss mit seinen vielen Prunksälen. In Erinnerung bleibt Karl der Audienzsaal, mit dem die polnischen Herrscher schon vor Jahrhunderten die Gesandten fremder Länder zu beeindrucken vermochten, nicht wegen der Gobelins, nicht wegen der Kassettendecke mit den holzgeschnittenen Charakterköpfen, sondern weil hier historisches Ambiente mit Leben erfüllt wird. Ein Streicherquartett spielt auf, in historischen Gewändern zwar, aber voller Leben und mit dem Schwung der Jugend und der Anmut der polnischen Violonistin, die als Burgfräulein verkleidet mit ihrem hingebungsvollen Spiel an die verträumte Dame mit dem Hermelin denken lässt.
Marien-Basilika am Hauptmarkt
Am Abend kehren Nora und Karl am Hauptmarkt in eines der renommiertesten Restaurants am Platze ein, das Restauracja Wierzynek. 1364 steht über dem Eingang. Die Ursprünge des Gourmet-Tempels sollen bis auf ein gigantisches Festmahl auf dem Krakauer Hauptmarkt zurückgehen, das König Kasimir der Große im Jahr zuvor anlässlich der Hochzeit seiner Enkelin Elisabeth mit Kaiser Karl IV. gegeben hat. Auf Knedliki, Knödel zu Hirschbraten, eine Spezialität tschechischen Ursprungs, fällt die Wahl der Besucher aus Berlin. Zusammen mit einem schweren ungarischen Rotwein lassen sich Nora und Karl dieses traditionelle Abendmahl in gediegenem Ambiente im ersten Obergeschoss schmecken. Brokatvorhänge, geschnörkelte Stühle, blütenweiße Servietten und schweres Besteck geben dem Dinner ein quasi-bourgeoises Gepräge. Oder doch gar ein Königlich-Kaiserliches? Wie auch immer, die lange Stadtwanderung und das köstliche Mahl bescheren ihnen einen tiefen Schlaf im Uni-Gästehaus.
Der Morgen in Krakau beginnt für Karl an jenem Tag mit einer Laufrunde auf dem grünen Parkring, der anstelle des Stadtwalls heute die Altstadt umschließt. Der Lauf bietet Gelegenheit zum Abschiednehmen, vom Barbakan, vom Schloss, vom Slowacki-Theater und von diversen Kirchtürmen entlang der Strecke. Noch einmal geduscht, noch einmal gepackt – und schon stehen sie nach eineinhalb Tagen wieder auf dem Bahnsteig. Nora bleibt noch ein wenig, bevor sie am Nachmittag nach Berlin zurückreist, Karl besteigt den D-Zug zur polnischen Ostgrenze nach Przemysl, wo er in den Nachtzug nach Černivci in der ukrainischen Bukowina wechseln will. Die Eisenbahn fährt über die Weichsel. Auf der südlichen Flussseite begrenzte das Bahngelände das jüdische Ghetto nach Osten. Bald nachdem das Industriegelände mit der ehemaligen Emaillewarenfabrik passiert ist, die für viele Juden zur Arbeits- und Zufluchtsstätte vor den Schergen des NS-Regimes wurde, knickt die Bahn nach Osten ab. In Richtung Tarnow, Reszow, Przemysl und Ukraine verläuft sie zunächst entlang der Autobahn.
Während zur Rechten die Autos brausen, sind weit im Norden jenseits der Weichsel die Türme der Stahlwerke von Nowa Huta zu erkennen. An einem Sonntag sind Karl und seine Tochter Jolanda dorthin mit der Straßenbahn gefahren, bis vor das Tor des Kombinats mit seinem imposanten Verwaltungsgebäude im Stil der Stalin-Ära. Hinein auf das riesige Werksgelände, das sich inzwischen in den Händen des weltweit größten Stahlkonzerns ArcelorMittal befindet, konnten sie nicht. Die Schranke ist nur für Werksangehörige zu passieren. Wohl aber pilgern sie anschließend über eine Ringstraße der 1949 speziell für die Arbeiterschaft des Eisenhüttenkombinats gegründeten sozialistischen Musterstadt. Ihr Ziel? Eine Kirche mit einer besonderen Geschichte! Die Wohnungsblöcke, die sie auf dem Weg dorthin passieren, haben grüne Vorgärten mit nun schon Jahrzehnte alten Bäumen. Das grüne Ambiente lässt erahnen, dass hier ein „Arbeiterparadies“ geplant war. Erkennbar ist diese Neue Heimat in die Jahre gekommen und bedarf sie der Renovierung. Gleichwohl lässt sich nachvollziehen, dass in dieser neuen Wohnstadt für das nahe, aber doch durch einen Parkgürtel auf Abstand gehaltene Werk eine eigene Identität der Bewohnerschaft entstanden ist.
Nowa Huta ist zwar ein Stadtteil von Krakau, aber es ist verständlich, wenn mancher Einwohner der „Neuen Hütte“ nur ein- bis zweimal im Jahr ins Zentrum der Königsstadt fährt. Man hat ein eigenes Zentrum mit einem Zentralplatz, der inzwischen bemerkenswerter Weise nach Ronald Reagan benannt ist. Man hat Sportanlagen, Kinos und man hat Kirchen. Die allerdings mussten sich die frommen Arbeiter mit jahrelangem Drängen erst erstreiten. Die „Kirche der Mutter Gottes, der Königin von Polen“ hat eine elliptische Form, die in dem abgeschrägten Flachdach optisch besonders nachdrücklich zur Geltung kommt. Das in den 60er Jahren konzipierte Bauwerk hat eine große Glasfront nach Nordwesten und ein elegant geschwungenes Betonkleid. Überragt wird die „Arche des Herrn“, wie das Gebäude in Anspielung auf seine äußere Form auch genannt wird, von einem 70 Meter hohen stählernen Kreuz. Unter einem hölzernen Kreuz hatte der damalige Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyla, bereits in den frühen 60er Jahren am selben Platz Messen im Freien abgehalten. Als sich Jolanda und Karl am Ziel ihrer Stadtwanderung diesem modernen Kirchenbau nähern, dessen Architekt Wojciech Pierzyk sich ganz offenbar von Le Corbusiers berühmter Kapelle Notre Dame du Haut de Ronchamp beeinflussen ließ, hören sie aus dem Inneren Gesang. Sie treten an die Glasfront und lugen in den Sakralbau. Es ist Sonntagvormittag. Eine Messe wird gefeiert. Behutsam öffnen sie eine der Portaltüren. Das 1977, also noch in der sozialistischen Ära eingeweihte Gotteshaus ist voll besetzt. Die Gläubigen singen andächtig und doch mit Inbrunst. Diskret ziehen sich die beiden Nichtkatholiken zurück. Aber auch von außen ist dieser Bau für Polens Erste Dame, die Mutter Gottes, die auch am Revers von Solidarnocs-Führer Lech Wałesa nie fehlte, höchst staunenswert.
Die Fahrt nach Nowa Huta hat sich also gelohnt. Auf dem Rückweg vom Haus der Königin in die Stadt der Könige begegnet den beiden ein ehemaliger Mitstreiter Wałesas. Vom Plakat der Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS) lächelt Lech Kaczynski. Der konservative Politiker hat gerade Ende Oktober 2005 die Wahl zum Staatspräsidenten gewonnen und sich dabei nicht zuletzt auf das katholische Lager gestützt. Zwei Monate zuvor hatte die PiS mit dem Slogan „Polska solidarna vs Polska liberalna“ (Solidarisches Polen gegen liberales Polen) auch die Regierungsmehrheit errungen. Ein weiteres Plakat, das die beiden Deutschen durchs Fenster der Tram erblicken, klingt fast wie ein Kommentar darauf: „Nie dla idiotów.“
Aber das ist nur die polonisierte Version des europaweiten Media-Markt-Slogans „Ich bin doch nicht blöd“. Hier im wild wuchernden Gewerbegebiet zwischen Nowa Huta und dem historischen Krakau hat sich natürlich auch der deutsche Handelsriese breit gemacht.
Mit der Straßenbahn sind Jolanda und Karl wieder nach Krakau zurückgekehrt. Mit der Eisenbahn verlässt er es nun auf dem Weg nach Osten mit Nowa Huta am nördlichen Horizont. Mit im Abteil sitzen zwei polnische Damen und ihre Töchter. Neugierig befragen sie den ausländischen Mitreisenden. Die älteren Damen sprechen ein wenig Deutsch, ihre Töchter Englisch. Stolz sind sie auf ihr prächtiges Krakau und erfreuen sich an Karls Lob und Komplimenten für ihre Metropole. Als er vom Abendmahl des Vorabends berichtet, stöhnen sie: „Ja, das Restauracja Wierzynek, einfach großartig!“ Was er denn verspeist habe? „Knedliki!“ Sie verdrehen die Augen – vor Verzückung.
Oleg – Cicerone von Černivci
Oleg steht an der Bahnsteigkante, ein großer, dunkelblonder Mann von etwa dreißig Jahren, eher Ende zwanzig. Karl ist er sofort aufgefallen. Denn die meisten anderen Wartenden schnattern miteinander, Marktfrauen mit riesengroßen Plastikreisetaschen von geringem Eigengewicht, prall gefüllt mit westlich-modischer Billigware aus den Supermärkten und Kaufhäusern Polens, die sie Gewinn bringend auf den fliegenden Märkten ihrer ukrainischen Heimat weiter zu verkaufen gedenken. Er dagegen geht in Gedanken verloren auf dem Perron von Przemysl auf und ab.
In dieser polnischen Grenzstadt war Karl nolens, volens dem Zug entstiegen. Spurwechsel! Die Transitreisenden müssen über drei durchgehende Bahnkörper hinübergehen zu einer Gleisanlage, die dort beginnt. Da gehen die Züge nach Osten in die Ukraine ab. Doch zwischen Ankunft und Weiterfahrt war ihm eine knappe Stunde Zeit geblieben, um der immer noch habsburgisch geprägten Altstadt dieser ehemals größten Garnisonsstadt Galiziens einen Kurzbesuch abzustatten. Über Kopfsteinpflaster und an barocken Gebäuden vorbei geht er die Franziskanerstraße hinunter. Er passiert die gleichnamige Kirche und schreitet über den Rynek, den Marktplatz mit seinen Patrizierhäusern, die von der reichen Vergangenheit Przemysls als Handelsplatz zwischen Krakau und Kiew, zwischen Schwarzem Meer und Ostsee zeugen.
Er blickt hoch zur katholischen Kathedrale und zur Burg aus dem 17. Jahrhundert. Aber ihm bleibt gerade noch die Zeit, hinunter zu spazieren zum Fluss San, wo im Zweiten Weltkrieg gemäß dem Molotow-Ribbentrop-Abkommen die Demarkationslinie zwischen Russen und Deutschen verlief. Karl bleibt auf der östlichen, der Altstadtseite, ersteigt wieder die Höhe, überquert am Altstadtrand die vielbefahrene Hauptstraße nach Lemberg, um wieder zum Bahnhof zu gelangen, wo sein Zug – ebenfalls mit dem Ziel Lemberg (ukrainisch: Lviv) – auf ihn warten sollte.
Bevor er den Bahnsteig Richtung Ukraine betreten kann, gilt es, schon die erste Kontrolle vor dem Eintritt in das Nachbarland über sich ergehen zu lassen. Gültiges Ticket, gültige Identitätspapiere? Ohne diese Überprüfung wird man nicht auf diesen Teil des Bahnhofs gelassen, der durch einen hohen Gitterzaun vom Teil für die polnischen Inlandszüge abgetrennt ist. Karl hat zwar ein Ticket von Krakau bis Czernowitz oder besser Černovcy, wie es auf Polnisch und Russisch heißt, oder noch besser Černivci, wie der ukrainische Name lautet, aber eine Platzkarte nur für die Strecke bis zur Grenze. Für den innerukrainischen Nachtzug fehlt ihm noch das Schlafwagen-Supplement. Was tun? Die vollbepackten Händlerinnen sehen nicht gerade so aus, als ob sie ihm Auskunft auf Englisch geben könnten.
Also fragt er den jungen Mann an der Bahnsteigkante. Es stellt sich heraus, dass Oleg, wie er sich mit Namen vorstellt, sogar ein wenig Deutsch beherrscht. Karl solle sich keine Sorgen machen. An der Grenzstation Mostyska würden die ukrainischen Schaffner an Bord kommen, die die entsprechenden Aufschläge verkaufen. „Wohin fahren Sie denn?“ fragt der junge Akademiker. Oleg ist nämlich Lektor für Ukrainisch an der Universität von Warschau. „Černivci? Das trifft sich gut! Da will ich auch hin.“
Karl und Oleg unterhalten sich angeregt über Gott und die Welt. Nach knapp drei Stunden tauchen tatsächlich die Kondukteure auf. Ganz perfekter Gastgeber, bezahlt Oleg Karls Zuschlag für den Schlafplatz bis Černivci in ukrainischer Währung. Karl hat noch keine Griwna in der Tasche. „Das kannst du mir ja morgen zurückzahlen“, bemerkt der junge Lektor. Natürlich freut sich Karl über diesen freundlichen und eloquenten Reisegefährten. Die weiteren eineinhalb Stunden Fahrt bis Lemberg vergehen wie im Flug. Dort richten sie in ihrem Kurswagen nach Černivci die Betten her. Ankunftszeit an ihrem Zielort ist in aller Herrgottsfrühe, um vier Uhr zwanzig genau. Deshalb wird es Zeit, sich in die Horizontale zu begeben.
Vorher will Oleg aber noch Eines klären. Dass Karl um halb fünf Uhr morgens einige Stunden im Wartesaal verbringen will, bevor er sich bei einem Rundgang die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt der Bukowina anschaut und am Nachmittag in den Zug nach Odessa am Schwarzen Meer steigt, hält er für keine gute Idee. Er solle ihn doch nach Hause begleiten. Dort könne man sich ein paar Stündchen ausruhen. Danach könne er ihm gerne seine Heimatstadt zeigen. Karl hat schon auf seiner Ostsee-Umrundung die geradezu bedingungslose osteuropäische Gastfreundschaft kennen gelernt und bei den Diskussionen mit Oleg auf der bereits stundenlangen Fahrt auch seinen neuen Freund schätzen gelernt. So hat er keine Bedenken, dankend zuzusagen. Er legt sich zur Seite. Noch eine Weile hört er das Rattern der Räder und das Flüstern in den anderen Schlafkojen. Dann ist er eingeschlummert.
Noch ziemlich verschlafen steigen Oleg und Karl um Viertel nach Vier von ihren Pritschen. „Mann, mir kommt’s so vor, als sei ich gerade erst eingeschlafen“, stöhnt Karl. „Du kannst froh sein, dass du jetzt nicht bis zum Morgengrauen in der Bahnhofshalle ausharren musst, bevor du mit deiner Besichtigungstour beginnen kannst“, meint Oleg. Recht hat er. Pünktlich um 4 Uhr 20 fährt der Nachtzug in Černivci ein. Schnell durchschreiten sie einen leeren Kuppelraum, die Haupthalle des unten im Tal des Flusses Pruth gelegenen Bahnhofs. Vor dem weißen, klassizistischen Gebäude verstauen sie ihr Gepäck in einem Taxi. Und schon geht die Fahrt über das Kopfsteinpflaster der Gagarin-Straße, die zunächst am Bahngelände entlang führt und sich dann in einer Rechtskurve den Hügel hinauf zum Stadtzentrum schwingt. Nur der Oberleitungsbus kommt ihnen auf der Steigung entgegen. Links und rechts stehen zwei- bis viergeschossige Bauten, die alle noch aus vorkommunistischer Zeit stammen könnten.
Oben im Zentrum geht die Gagarin- in die Golowna-Straße über, die sich über den ganzen Hügelrücken bis in den Süden der Stadt zieht. Eine schöne Kirche taucht zur Rechten auf, dann eine Zweite. „Das ist meine Kirche“, weist Oleg mit dem Finger aus dem Taxi. „Die römisch-katholische Heiligkreuz-Kirche. Sie ist schon fast 200 Jahre“, bemerkt er stolz. Klar, die polnischstämmigen Ukrainer suchen natürlich die papsttreue Kirche auf. „Wir feiern an diesem Wochenende das große Gemeindefest. Wir schlafen uns erst aus. Aber heute Nachmittag gehe ich mit dir dorthin.“
Das Taxi rattert weiter über das regennasse Pflaster. Nach ein paar hundert Metern fahren sie längs über den Zentralplatz mit dem zu österreichisch-ungarischen Zeiten errichteten Rathaus auf der Hügelkuppe. Der noch müde Karl nimmt kurz den Rathausturm wahr, nickt kurz ein, bis ihn Oleg im weiteren Verlauf der Golowna-, also Hauptstraße auf das nächste Gotteshaus zur Linken aufmerksam macht, die rosafarbene rumänisch-orthodoxe Kathedrale. „Und dahinter – kannst du jetzt nicht sehen – würdest du die armenische Kirche entdecken“, weiß sein Stadtführer. So „erfährt“ Karl bereits im Morgengrauen im doppelten Sinne das Multikulturelle der Bukowina-Hauptstadt.
Durch ein grünes Spalier von Straßenbäumen auf den Bürgersteigen, weiter vorbei an Altbauten und über Kopfsteinplaster braust der schweigsame Chauffeur. Nachdem der Zentralpark zur Rechten hinter ihnen liegt, erreichen sie schließlich die Ringstraße im Süden, den Nesaležnosti-Prospekt, die Unabhängigkeitsallee. Hier stehen links und rechts fünfstöckige Wohnblöcke aus den 60er Jahren. Der damalige sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschow hatte im Rahmen seiner Wirtschaftsreformen auch den Wohnungsbau forciert, für damalige Verhältnisse hochmoderne Bauten. Endlich wurde nicht nur in den Aufbau von Schwerindustrie und Militär investiert, sondern auch in ein besseres Leben für die Bevölkerung. Hier war auch Olegs Familie eingezogen.
Die Blöcke stehen mit der Schmalseite im rechten Winkel zum breit angelegten, ebenfalls von Baumreihen flankierten Prospekt. Karl folgt Oleg zu einem der Eingänge. Gleich im Erdgeschoss steckt er seinen Schlüssel in eine der Wohnungstüren. Als sie in den Flur treten, kommt ihnen im kurzen T-Shirt barfuß eine junge Frau in Slip entgegen. Sie hat ihren Bruder erwartet, reibt sich die schläfrigen Augen und schaut verwundert aus der Wäsche, als sie sieht, dass Oleg nicht allein ist. Der Bruder stellt den deutschen Gast seiner jüngeren Schwester vor, erklärt, dass sie beide noch todmüde seien, und bereitet auf die Schnelle im Wohnzimmer ein Morgenlager für Karl. Die vielen Kissen mit Häkelüberzügen werden zur Seite gelegt und Bettzeug zurecht gerückt. Dann wünschen sie sich zum zweiten Mal in dieser Nacht einen guten Schlaf.
Als sich Karl um halb Neun aus dem Bettzeug herausschält, hört er Geräusche aus der Küche. Oleg war bereits einkaufen und bereitet das Frühstück. Seine Schwester Marija ist schon fort, zur Arbeit in einem Büro. Sie ist die einzige der Familie, die permanent in ihrer Heimatstadt Černivci lebt. Die Mutter schafft als Krankenschwester in Rom. „In Italien?“ fragt Karl verwundert. „Ja, so ist es. Und mein Vater arbeitet als Ingenieur in einem Stahlwerk in Donezk in der Ostukraine. Ich selber bin, wie du weißt, als Lektor in Warschau tätig. So ist die Familie in alle vier Himmelsrichtungen verteilt“, erläutert Oleg mit einem leicht gequälten Lächeln.
Der schmale Küchenraum bietet doch Platz für ein Tischchen, an dem die beiden sich niederlassen. Es gibt die typischen Elemente des ukrainischen Frühstücks: Weißer Frischkäse sowie frische Gurken und Tomaten, dazu Graubrot und natürlich etwas Fleischwurst.
Gestärkt von dieser Brotzeit machen sich die beiden auf den Weg. Bei der Sberbank-Filiale an der Ecke Golowna/ Nesaležnostiti-Prospekt spendet der Automat dieser größten russischen Bank tatsächlich die Landeswährung Griwna, so wie es Oleg dem ungläubigen EC-Kartenhalter Karl versprochen hat. So für alle Eventualitäten ausgestattet, ziehen sie durch Nikitas 60er Jahre-Wohnblocksiedlung in Richtung Innenstadt. Sie wählen den Weg über die parallel zur Golowna verlaufende Fedkovyča, seit Generationen eine der bevorzugten Wohnstraßen – erst von Czernowitz und später von Černivci. Hier haben die diversen Machthaber der Bukowina ihre Spuren hinterlassen.
Die Rumänen, die 1918 die Bukowina besetzt hatten und als Gewinnler des 1. Weltkriegs im Friedensvertrag von Saint-Germain auch zugesprochen bekommen hatten, haben hier einige prächtige Wohnhäuser errichtet. Das grüne Haus in der Nr. 54 gibt ein eindrucksvolles Beispiel für den rumänischen Stil. Seinen Mittelteil mit von Balustraden geschmückten Balkons flankieren zwei Erkertürme mit spitz zulaufenden, rot gedeckten Haubendächern. Kein Wunder, dass hier nach der Besetzung durch sowjetische Truppen Offiziere der Roten Armee residierten. Andere Villenfassaden (zum Beispiel in der Nummer 24) zieren sogar Reliefs von Wappen. „Sind das die Zeichen österreichischer oder ungarischer Adelsfamilien?“ fragt Karl. Oleg ist überfragt. „Gut möglich.“
Schöne Fassaden aus der kaiserlichen und königlichen oder auch k.u. k. Zeit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie zieren auch die zur Stadtmitte hin ansteigende „Straße der Roten Armee“ (Červonoarmiijs’ka), auf die die beiden Stadtwanderer von der Fedkovyča wechseln. Die Apteka, also Apotheke in der Nr. 28 ist ein prächtiges Beispiel dafür. Die Rotarmee-Straße überquert den größten Platz der Stadt, den Soborna-Plošča. Früher hieß er einmal Austria-Platz. Im angrenzenden Park stand zu jener Zeit eine Büste von Kaiserin Elisabeth. Statt „Sissi“ beherrscht immer noch ein Sowjetsoldat die Szenerie. Die Skulptur steht mit wehendem Mantel, ein Gewehr in der Rechten, mit der Linken die aufgepflanzte Standartenfahne haltend, vor einem polierten braunen, hohen Obelisken und feiert den Sieg im 2. Weltkrieg. Indes, die Spuren der Roten Armee beginnen zu verwischen. Nach den dramatischen Ereignissen vom Februar 2014 in der Hauptstadt Kiew wird die Červonoarmiijs’ka in „Straße der Helden des Majdan“ umbenannt.
Blick vom Zentralplatz in Herrengasse
Doch davon wissen Oleg und Karl noch nichts. Sie kommen endlich am Zentralplatz mit dem Rathaus an. Der blaue Anstrich des 1843 errichteten Gebäudes kommt an diesem regennassen Tag vor dem Grau des Himmels nur schwach zur Geltung. Doch mit seinem dreistufigen Turm mitten über dem Portal beherrscht das Haus der Stadtregierung von der Stirnseite den langgestreckten Platz. In seiner Südostecke zweigt eine Fußgängerzone ab, auf die Oleg voller Stolz hinweist. „Das ist die Herrengasse. Sie war schon zur Zeit von Kaiser Franz-Joseph der Ort, wo man einkaufen und spazieren ging. Spazieren, sagt man das?“ fragt er. „Durchaus“, meint Karl. „In einem solch prächtigen städtischen Ambiente könnte man das sogar flanieren nennen.“ Das große hochherrschaftliche Haus mit Turm an der Ecke zum Ringplatz, wie der zentrale Platz unter österreichischer Herrschaft hieß, ziert heute noch eine elegante Fassade. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass im dortigen Café vor dem Ersten Weltkrieg das deutsch-jüdische Bürgertum und die vielen Literaten der mehrsprachigen Bukowina-Metropole ein- und ausgingen.
Heute ist dort eine Bank untergebracht, ebenso wie gegenüber im eleganten Gebäude des Hotel-Restaurants „Belle Vue“ mit seinem charakteristischen, langgestreckten Balkon über die gesamte erste Etage. Darunter im Erdgeschoss residiert nun die russische Sberbank. Trotz aller kyrillischen Schriftzeichen rundum fühlt Karl sich in eine vergangene „österreichische“ Zeit versetzt. Die Architektur spiegelt immer noch die Aura des Fin de Siècle.
Die Herrengasse trägt längst nicht mehr ihren deutschen Namen. Nach der ukrainischen Nationaldichterin Olga Kobyljanska ist sie heute benannt, genauso wie das Stadttheater, das 1905 als Schiller-Theater eingeweiht worden war. Nach fünf Minuten Fußweg sind Oleg und Karl dort angelangt. Den Theatervorplatz schmückt eine Parkanlage mit Bänken und Blumenrabatten. Unmittelbar vor dem Portal sitzt sie auf einem Sockel, die Verfechterin des ukrainischen Nationalgedankens. Bei der Einweihung des Kunsttempels saß dort ein Bruder im Geiste, der freiheitsliebende Friedrich Schiller. „Hey Oleg, das muss ich fotografieren“, ruft Karl. Und so posiert der blonde Oleg zusammen mit der zur überlebensgroßen Skulptur gewordenen Olga, auf den Stufen stehend, die Hand lässig auf den Sockel des Denkmals der Frau gestützt, die 1942 unter deutscher Besatzung 78jährig gestorben und zu einer Art Nationalheiligen geworden ist.
Über dem Eingang prangt eine Banderole. SALOMEA steht da. Anscheinend hat sich das Programm trotz einer wechselvollen Geschichte unter österreichischer, rumänischer, deutscher, sowjetischer und ukrainischer Leitung doch nicht total geändert. Richard Srauss hat seine Oper Salome im selben Jahr vollendet, in dem auch das heutige Kobyljanska-Theater fertig wurde. In der ersten Blütezeit gastierten hier vor vollbesetztem Haus Theatertruppen aus Wien, Berlin, Wilna und Moskau.
Ein mächtiger Portalbogen, über den sich wie eine Haube das Bühnenhaus erhebt, beherrscht den Mittelteil mit dem Eingang. Der Bogen ruht zu beiden Seiten auf einem Paar klassizistischer Säulen. Sie verstärken den weihevollen Eindruck auf den Stadtwanderer, der sich dem Musentempel über den blumengesäumten Vorplatz nähert.
Oleg führt Karl stolz um das von den Wiener Architekten Fellner & Helmer gestaltete prächtige Gebäude herum. Den paneuropäischen Anspruch, den die Erbauer im multinationalen Czernowitz des Fin de Siècle geltend machen wollten, unterstreichen die Büsten der Großdichter, die im oberen Teil der Seitenfronten vor kreisrunden, von Stuck umkränzten Fenstern platziert sind. Auf den Ehrenplätzen über den großen Fenstern der Vorderfront kommen der Brite Shakespeare und der Franzose Molière hinzu. Um die Ecke herum in der Schillerstraße – so heißt sie tatsächlich immer noch – ist als Erster der Russe Puschkin zu sehen und gleich anschließend der vom Vorplatz verbannte Schiller mit seinen wallenden Locken. „Toll, Europas ,Chefdramatiker‘ geben sich hier ein Stelldichein“, konstatiert Karl. „Wart’s ab, das ist noch nicht alles“, bittet Oleg um Geduld.
Das russisch-deutsche Paar geht hinüber zur anderen Seitenfront. Grinsend zeigt Oleg zwischen dem Blattwerk von Bäumen zur Seitenfassade hoch: „Schau mal, da ist Herr Goethe aus Frankfurt.“ Karl hätte ihn fast übersehen, denn die kyrillische Schrifttafel unter der Büste enthält nur vier Buchstaben. Tatsächlich, der deutsche Dichterfürst schaut von dort würdevoll auf ihn herab. „Gete“ steht da in kyrillischen Zeichen. Die Russen und Ukrainer belassen es, wenn sie transkribieren, eben beim reinen Umsetzen ihrer Lautung. „Deutschen Augen und Ohren kommen diese Transkription und diese Lautung ein wenig unkorrekt vor“, bekrittelt der Beckmesser Karl.
Immerhin, auch Černivci erweist dem alten Goethe noch die Ehre als Straßennamensgeber. So nehmen sie die hinter dem Theater verlaufende Gete-Straße, um hinüber zur Vulitzja Universitetska zu schreiten. Dieser Hort der Wissenschaft residiert seit der Sowjetzeit im ehemaligen Bischofspalais des orthodoxen Metropoliten der Bukowina und Dalmatiens. Das prächtige Gebäude der Nationalen Jurij-Fedkovyč-Universität wurde 2011 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die Studenten – so Oleg, der sich dort der polnischen Literatur verschrieben hatte – empfinden es als eine Ehre, „in diesen heiligen Hallen“ ihren Studien nachgehen zu dürfen. Der von 1864 bis 1882 entstandene riesige Ziegelbau des tschechischen Architekten Josef Hlavka, der im Übrigen auch die Wiener Hofoper errichtete, ist geprägt von einem Stilmix aus romanischen, gotischen und byzantinischen Elementen – auch dies ein Beleg für die Verschmelzung verschiedenster kultureller Einflüsse in der Hauptstadt der Bukowina.
An diesem Samstag bleibt die Lehrstätte verschlossen, so spazieren die beiden um den weitläufigen, U-förmigen Gebäudekomplex herum und über die Josef-Hlavka-Straße hinauf zum Park auf der Habsburghöhe. Von dort geht es durch den Wald steil hinunter ins Pruth-Tal, wo die Züge verkehren. Ein neuer September-Schauer geht hernieder. Eilig stürmen sie die Bahnhofshalle und schütteln sich wie junge Hunde ihr Fell die Feuchtigkeit aus ihren Kleidern.
Oleg ist es gewesen, der Wert darauf gelegt hat, Karls Fahrkarte ans Schwarze Meer schon vorab zu besorgen. „Dann können wir in aller Ruhe anschließend zum Gemeindefest gehen, und du ersparst dir den Stress mit dem Fahrkartenkauf unmittelbar vor der Abfahrt“, hat er schon beim Frühstück geraten. Gesagt, getan. Und tatsächlich, der Ticketerwerb ist gar nicht so unkompliziert. Karl muss als Ausländer an einen besonderen Schalter. Dort wird peinlich genau seine Reisepassnummer notiert. Bezahlt werden kann nur bar. Gut, dass er am Morgen schon die Griwna aus dem Automaten der Sberbank gezogen hat und dass er Oleg als Übersetzer dabei hat. Denn der Bahnbeamte will alles Mögliche wissen. Auch den Vornamen des Vaters. „Ebenfalls Karl? Aha. Also Karl Karlovič“, vermerkt er. „Wir Ukrainer ehren wie die Russen unsere Väter, indem wir ihre Namen zusammen mit unserem nennen“, erläutert Oleg Fjedorovič.
Auf dem Bahnhofsvorplatz nehmen sie an einem Kiosk noch schnell einen kleinen Snack zu sich. Dann endlich geht Olegs Herzenswunsch in Erfüllung. Sie fahren im Taxi zur Heiligkreuzkirche. Dort feiern an diesem Wochenende die römisch-katholischen Christen ihr Pfarrfest. Und sie tun das im ökumenischen Geiste. Alle sind eingeladen: die Orthodoxen, die Unierten (Ukrainische griechisch-katholische Kirche) und die Protestanten. Karl, der im dicht besetzten Kirchenschiff neben Oleg auf der Bank Platz genommen hat, fällt beim Einzug der Priester vor allem der Pope der Unierten auf, dieser mit Rom verbundenen Kirche, die aber weiter den byzantinischen Ritus pflegt. Wie die anderen Ehrwürden trägt er ein farbenprächtiges Gewand. Hervor sticht er durch seinen goldenen Hirtenstab und die noch prächtigere Kopfbedeckung, ein Mittelding zwischen Turban, Krone und Haube. Über dem golddurchwirkten Stirnband verbreitert sich dieser Hut etwas und schließt oben kuppelförmig ab. Der pausbäckige Pope sieht aus wie einer der Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland, die durch Karls Kindheitserinnerungen geistern.
Der festliche Charakter der Messe wird weiter durch die Fahnen vieler kirchlicher Organisationen unterstrichen, die an den Seiten des Kirchenschiffes aufgepflanzt sind. Auch die Kolpingfahne fehlt hier nicht. Der von dem deutschen Priester Adolph Kolping Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete Gesellenverein ist als internationales Sozialwerk heute noch in 60 Ländern aktiv, offenbar auch in der nunmehr ukrainischen Bukowina, wo es natürlich seit österreichischer Zeit verwurzelt ist.
In der ukrainisch gehaltenen Zeremonie wird auch eine Ansage in Polnisch gesprochen. 70 Prozent der Gläubigen der Heiligkreuz-Pfarrei sind polnischer Abstammung oder haben sogar ihre polnische Nationalität bewahrt. Oleg selber steht als Beispiel dafür. Seine Mutter hat polnische Vorfahren.
Zu Karls Überraschung betet einer der vielen Priester, die den Festgottesdienst mitgestalten, seinen Segensspruch sogar in deutscher Sprache. Man merkt seinem Akzent an, dass dies nicht seine Muttersprache ist. Aber die Worte sind korrekt und dem deutschen Zufallsgottesdienstbesucher aus ferner Kindheit vertraut. Grußworte, Gebete und Gesänge wechseln sich ab. Bevor der gastgebende Pfarrer zu seiner Predigt anhebt, stupst Karl seinen Banknachbarn an und weist auf die fortgeschrittene Zeit auf seiner Armbanduhr hin. „Du, ich muss los. Bleib nur hier. Ich kenn‘ ja jetzt den Weg. Herzlichen Dank noch einmal für alles. Und hoffentlich bis bald!“
Inmitten der Festmesse reicht es nur für eine flüchtige Umarmung. Dann mogelt sich Karl still durch die Masse der Gläubigen hinaus und tritt vor die Kirche. Sein Blick fällt auf die andere Seite des Platzes. Nicht weit davon begann das alte Judenviertel, wo im 2. Weltkrieg die deutschen Besatzer zehntausende Juden in einem Ghetto zusammenpferchten. Die meisten haben sie später nach Transnistrien deportiert und dort ermordet.
Karl eilt zum Bahnhof und nimmt den Nachmittagszug nach Odessa. Das „bis bald“, was er seinem Cicerone von Černivci zugeraunt hatte, wartet noch auf die Einlösung. Gelegentlich haben sie E-Mails ausgetauscht. Anlässlich der Orangenen Revolution führten sie eine politische Diskussion. Die optimistische Einschätzung der westlich Orientierten, dass mit einer vorbehaltlosen Zuwendung zum Westen alles gut werde, mochte Oleg nicht teilen. Von seinem Vater, der sein Geld in der Schwerindustrie im Donezker Becken verdiente, wusste er nur zu gut, dass dort im Osten der Ukraine bei vielen eine ganz andere Sicht der Dinge vorherrschte. „Im Grunde ist die Ukraine ein in Ost und West geteiltes Land“, schrieb er mit Blick auf die Russophilen im Osten schon Jahre vor der dramatischen Zuspitzung der politischen Lage in der Majdan-Revolution.
Zwei Jahre nach der Majdan-Revolution erhielt Karl eine erfreuliche Nachricht. Der ehemalige Ukrainisch-Lektor an der Uni Warschau ist mittlerweile Polnisch-Lektor an der Fedkovyč-Universität. Der Cicerone von Černivci hat in seiner Heimatstadt tiefere Wurzeln geschlagen.
Zwanzig Stunden bis Odessa
Pling! Kyivstar schaltet sich ein und meldet UMC ab. „Überall ist man ans UMS-Netz angeschlossen, auch in der tiefsten Ukraine“, stellt Karl mit Blick auf sein Mobiltelefon zufrieden fest. Er sitzt gemütlich an einem Tischchen auf seinem Fensterplatz im Schlafwagen-Coupé und schaut zurück auf seine wenigen Stunden in der Hauptstadt der Bukowina. Wie das nicht ferne Lemberg, das sein ukrainischer Freund Oleg hartnäckig „Löwenberg“ nannte, hatten die Österreicher die Stadt an der Pruth um die vorletzte Jahrhundertwende zu einem repräsentativen Außenposten des k. u. k. Reichs herausgeputzt. Während vor dem Schlafwagenfenster die Felder der ruralen Ukraine vorbeifliegen, schwelgt der Reisende immer noch in urbanen Bildern vor seinem inneren Auge.
Was für eine Stadt! Was für eine Geschichte! Innerhalb weniger Jahrzehnte Teil von fünf Staaten und Machtgebieten: Österreich-Ungarn bis zum Untergang des k. u. k. Reichs, Rumänien nach dem ersten Weltkrieg, deutsche Besatzung im zweiten Weltkrieg, Vereinnahmung durch die Sowjetunion nach dem Untergang des „Tausendjährigen Reichs“ und nach dem Ende des Kommunismus schließlich die unabhängige Ukraine. Hauptsächlich fünf Nationalitäten lebten bis zum Holocaust alles in allem friedlich zusammen. Jede von ihnen hatte ein „Nationalhaus“ in Czernowitz mit ausgeprägtem Vereinsleben: die autochthonen Ruthenen (Ukrainer) und die Rumänen, die Deutschen, die Juden und die Polen.
Paradoxer Weise erreichte die Literaturproduktion in deutscher Sprache ausgerechnet in der rumänisch dominierten Zeit ihren Höhepunkt. Der rumänische Germanist Andrei Corbea-Hoisie hält das für keinen Zufall. Die deutschen Juden verloren in jener Zeit ihre Macht in Wirtschaft, Handel und Verwaltung. Ihr kreatives Potential lebten sie verstärkt in der Kunst und insbesondere der Literatur aus. Paul Antschel, der sich als Autor Paul Celan nannte, und die Lyrikerin Rose Ausländer sind zwei der renommiertesten Protagonisten, die in jener Zeit mit dem Schreiben begannen.
Von Rose Ausländer stammt der Satz: „Der Jordan mündete damals in den Pruth.“ Von über 130.000 Einwohnern vor Beginn des Zweiten Weltkrieges sollen etwa ein Drittel Juden gewesen sein. Wenn sie nicht rechtzeitig emigrierten wie etwa Rose Ausländer und Paul Celan, fielen sie dem von Deutschen verübten Genozid zum Opfer.
Eine sehr multikulturelle Periode droht in Vergessenheit zu geraten. Selbst in Israel. In Ester Amranis deutsch-israelischem Film „Anderswo“ von 2015 halluziniert die sterbende Großmutter der zwischen Berlin und Tel Aviv hin- und hergerissenen Heldin Noa von Czernowitz. In einer alten Schmuckdose hatte die Enkelin vergilbte Familienfotos gefunden. Vorne lachende Menschen, hinten die Aufschrift „Czernowitz 1938“. Eine der Umstehenden am Sterbebett sagt: „Ach, das ist Omas Dorf in Polen, wo sie als Kind lebte.“ Das pulsierende Czernowitz mit Zeitungen in sechs Sprachen (Deutsch, Ukrainisch, Rumänisch sowie Polnisch, Jiddisch und Hebräisch) war alles andere als ein Dorf. Polnisch war es nie. Vor der langen österreichischen Ära gehörten die Stadt und die gesamte Bukowina zum Fürstentum Moldau.
Die Bukowina, zu Deutsch „Buchenland“, erhielt ihren Namen nach dem ukrainischen und russischen Wort „Buk“ für Buche. Doch Karls Bahnstrecke ans Schwarze Meer führt nicht durch das Buchenland. Sein Zug macht einen weiten Schwenk nach Norden, um an die Hauptstrecke von Lviv nach Odessa zu gelangen. Allein bis Ternopol, wo der Kurs endlich nach Südosten abknickt, benötigt der Zug laut Fahrplan über acht Stunden. Die ländliche Ukraine, einst die Kornkammer der Sowjetunion, hat Karl eingefangen. In der Kleinstadt mit dem schönen Namen Verenčanka, wo der Zug nach eineinhalb Stunden Fahrt und zuvor zwei weiteren Stationen eintrifft, watscheln zur Linken Gänse um die Häuser in Bahnhofsnähe. Zur Rechten ödet die wellige ukranische Steppe, als sich die Bahn aufreizend langsam wieder in Bewegung setzt.
Ein wenig wandelt sich die Szenerie. Vor Čertkov, wo Karls schweigsame, aber nicht unfreundliche mittelalte Mitreisende am frühen Abend aussteigt, präsentiert sich gepflegtes Ackerland bis zum Horizont, kein Strauch an den Feldrainen, am Himmelsrand ein paar Bäume, dann wieder Weiden, wo einige Pferde grasen. So war es schon zu Zeiten des Dschingis Khan-Enkels Batu Khan, dessen Reiterheer „Goldene Horde“ auf dem Zug nach Westen die Vorzüge dieser ausgedehnten Graslandschaft ausnutzte.
Doch Karl will in die entgegengesetze Richtung. Eine Stunde vor Mitternacht ist es endlich so weit. Sein Zug weicht in Ternopol vom Nordkurs ab und schwenkt nach Südosten, Richtung Čornoje More, wie das Schwarze Meer in der Landessprache heißt. Zunächst jedoch umfängt ihn das Dunkel der Nacht.
Auf dem Weg zum Waschraum entdeckt er ein schönes und sympathisches Detail der ukrainischen Staatsbahn: Die Decken der Coupé-Flure sind mit künstlichen Blumen geschmückt. Das Blattwerk rankt wie beim Erntedankfest, die Plastikblüten leuchten in immer währender Farbenpracht. Darunter sind goldene Vorhänge drapiert. Zu den Seiten sind sie elegant gerafft, so dass den Reisenden der Blick auf die Landschaft bleibt. Erst jetzt bei abendlicher Beleuchtung kommen die goldenen Reflexionen des Stoffes voll zur Geltung. Ein Hauch der Pracht orthodoxer Kirchen begleitet den Passagier somit sogar bei nächtlicher Überlandfahrt.
Als sich Karls Zug am nächsten Morgen dem Schwarzen Meer nähert, stellt sich endlich auch die Sonne ein, die in Černivci hinter Regenwolken und Schauern versteckt geblieben war. Ab Rosdilna, dem Eisenbahnknotenpunkt, wo es hinübergeht nach Moldawien, herrscht gleißendes Morgenlicht. „Ist das eine Verheißung schöner Spätsommertage am Čornoje More“, fragt sich Karl, als sein Zug um kurz vor 10 Uhr nach fast zwanzigstündiger Fahrt in Odessa-Glowna, den Hauptbahnhof der Schwarzmeer-Stadt einfährt.
Innerlich spricht Karl der ukrainischen Staatsbahn ein zweifaches Lob aus. Zum einen für das ihn erheiternde, aber dennoch ernsthafte Bemühen um Verschönerung seines Reise-Ambientes, das er trotz Kitsch-Alarms zu schätzen weiß. Zum anderen wird ihm erst am frühen Morgen richtig klar, dass er in seinem Coupé sicher wie in Abrahams Schoß geruht hat. Vor seiner offenen Abteiltür passiert nämlich der Soldat aus dem letzten Abteil des Waggons, der die geleerten Gläser seines Morgentees dem Schaffner im ersten Abteil bringt. Umgeschnallt hat er Pistole und Schlagstock. Also befand sich der junge Mann die ganze Zeit im Einsatz und nicht etwa auf einem Wochenendtrip an die See, wie Karl auf Grund seines sonst zivilen Aussehens beim Einsteigen in Černivci vermutet hatte. Eine lange Fahrt zwar, aber sicher!
Die Schöne an der See und die Schönen
Der Blick des Ankommenden fällt sofort nach Betreten des Bahnhofsvorplatzes auf die gegenüberliegende Pantaleimon-Kathedrale. Die Fassade des Portals steht nicht frei, sondern ist in die Häuserzeile mit Geschäftshäusern integriert, deren Traufhöhe wenig geringer als das Kirchenportal ist. Beim ersten Anschauen nimmt man das Kirchengebäude gar nicht als solches war, wären da nicht die hinter dem Portal stehenden Türme mit Kreuzen an ihrer Spitze, eine imposante Ansammlung von Zwiebel- und Spitztürmen – unübersehbar, aber dennoch eingeordnet in das urbane, kommerzielle Ambiente, als wollte der Erbauer zugestehen, dass Odessa vor allem eine Stadt des Handels und der Seeefahrt ist.
Pantaleimon-Kathedrale
Unter Katharina der Großen war hier am Südwestrand ihres durch den Russisch-Türkischen Krieg gerade erweiterten Reiches ein neuer, enorm internationaler Handelsplatz entstanden. Reeder, Kaufleute und Handwerker nicht nur aus Russland, sondern auch aus Griechenland, Italien, Armenien, Deutschland und sonst woher ließen sich hier nieder, nicht zuletzt viele Juden. Katharinas erster Statthalter in der 1794 gegründeten Stadt war ihr siegreicher General José de Ribas, ein in Neapel geborener spanischer Adelsspross. Katharinas Enkel Alexander I. betraute 1803 den französischen Aristokraten, Armand du Plessis, Herzog von Richelieu, mit diesem Amt. Dieser hat soviel zur Stadtentwicklung beigetragen, dass es nicht verwundert, wenn eine der Hauptarterien, die vom Bahnhof zum Hafen führen, nach ihm benannt ist. Auf die begibt sich Karl, denn dort im „Gotel Čornoje More“, im Schwarzmeer-Hotel an der Rišeljevska-Straße hat er reserviert. Nur sechs Minuten Fußweg sind das – für Karl die erste Gelegenheit, dem Herzog Richelieu zu danken. Dieser hat nämlich an den Seiten von Odessas Straßen weiße Akazien pflanzen lassen. Ihre dichte Belaubung spendet dem Neuankömmling in der Spätsommersonne wohltuenden Schatten.
Nachdem er sich in dem schlichten, aber komfortablen Hochhauskasten einquartiert und kurz verschnauft hat, macht sich Karl auf seinen Sonntagsspaziergang, um die Schöne an der See zu erkunden. Doch zunächst nimmt er sich die fünf Minuten Zeit, um zum Bahnhofsplatz zurückzukehren. Das große weiße Gebäude mit sechs hohen Säulen an der Vorderfront hat es ihm angetan. Von Odessa, früher das südliche Tor zum Meer für das Sowjetimperium und noch früher für das russische Kaiserreich, gehen Züge zu den großen Städten in alle Himmelsrichtungen ab: nach Lviv im Westen, Kiew im Norden, Charkiv im Nordosten, Dnipropetrowsk und Donezk im Osten sowie – es ist noch die Zeit vor der russischen Annexion – nach Jalta auf der Krim. Über der großen Kuppel des sowjetisch-klassizistischen Baus weht eine blaugelbe Flagge, die Standarte der Ukraine.
Als Karl sich nach Osten wendet, um zur Musikalischen Komödie zu gelangen, lässt er zur Rechten das neben dem Bahnhof gelegene Kulikow-Feld unbeachtet liegen. Er kann noch nicht ahnen, dass sich hier im Gefolge der Majdan-Revolution allerschlimmste Ereignisse abspielen sollten. Inmitten des Parkgeländes steht das Gewerkschaftshaus, nicht zu vergleichen mit den schlichten Nutzbauten von DGB oder IG Metall. Es ist ein Gewerkschaftspalast, der die Bedeutung dieser Massenoganisation im Sowjetstaat unterstrich. Im Frühling 2014 errichten prorussische Gegner der prowestlichen Majdan-Revolution vor dem Gewerkschaftshaus ein Zeltlager. In der weltoffenen Hafenstadt Odessa schauen die Menschen zwar vorwiegend mit Sympathie zum Westen. Aber die Bevölkerung ist vorwiegend russophon. Unter diesen Russischsprachigen haben sich die Anhänger eines Ausscherens aus der Ukraine und des Anschlusses an Russland formiert. Am 2. Mai organisieren proukrainische Aktivisten als Reaktion darauf einen „Marsch der Einheit“.
In der Stadt liefern sich beide Seiten regelrechte Straßenschlachten. Die proukrainischen Kräfte, darunter Anhänger des „Rechten Blocks“ marschieren schließlich zum Zeltlager, um es aufzulösen. Die prorussischen Kräfte ziehen sich ins Gewerkschaftshaus zurück. Auf einmal fliegen Brandsätze, nach drinnen und nach draußen. Das Haus brennt lichterloh. Mindestens 42 Menschen sterben.
Von diesem bösen Geist einer späteren Zeit merkt Karl noch nichts. Hingegen begegnet er am Ende der Panteleimoniwska-Straße auf dem Vorplatz der Musikalischen Komödie einem guten Geist der slawischen Mythologie, der ersten wirklich Schönen dieser schönen Stadt. Sie heißt Russaločka und ist ein Lichtblick auf dem arg herunter gekommenen Platz vor dem modernen Betonbau der Komödie. Die slawische Märchengestalt Russalke ist ein Wassergeist. Der böhmische Komponist Antonín Dvořák hat ihr seine wundervolle Oper „Rusalka“ gewidmet. Die tschechische Waldfee schwebt über Teiche, Tümpel und Bäche. Ihre Schwester in Odessa hingegen führt natürlich ein Leben als Meeresnymphe. Sie ist „Die, die auf dem Delphin reitet“. Die nackte Schöne der eisernen Skulptur sitzt dem sich hochreckenden Delphin mit angezogenen Knien graziös seitlich im Nacken und hält eine Lyra hoch. Leider singt sie nicht. Wer sie hören will, muss ihren Schwestern auf der Bühne lauschen.
Auch der in Odessa vielfach geehrte Alexander Puschkin hat über die Meerjungfrau ein Drama geschrieben. Ihn sucht Karl als Nächsten auf. In der Puschkin-Vulitzja, die parallel zur Richelieu-Straße zur See führt, steht der russische Nationaldichter auf einem niedrigen Sockel fast ebenerdig vor seinem Museum, eine lebensgroße Bronzefigur mit Zylinder und eng geschnittenem, eleganten Gehrock. Zum Zeichen ungebrochener Verehrung liegen frische Blumen zu seinen Füßen.
Nach nur wenigen hundert Meter weiter unter dem prallen Grün der Schatten spendenden weißen Akazien entdeckt Karl die nächste Schöne. Sie trägt ein eng anliegendes, reich besticktes Büstier, darüber im Dekolletée ein breites V-förmiges Collier, einen weißen Schleier sowie einen bodenlangen vielschichtigen Tüllrock. Karl ist am Ende der Puschkinska am Rathausplatz mit Blick auf das Meer angekommen. Der junge Mann im schwarzen Anzug, der die selig lächelnde Schöne die wenigen Stufen zur pompösen Stadthalle hinaufführt und dabei galant ihre mit einem oberarmlangen, weißen Seidenhandschuh bedeckte linke Hand in Brusthöhe hält, ist offenbar der Bräutigam. In der rechten Hand trägt die Braut einen Strauß mit rosa Rosen. Mit ihrer Hochzeitsgesellschaft im Gefolge gehen die künftigen Eheleute zwischen zwei riesigen Kandelabern und danach hohen Säulen hindurch und betreten den weißen Prachtbau. Odessas „Weißes Haus“ mit seinen zehn weißen Säulen am Portal diente bis 1892 dem Handelsplatz am Schwarzen Meer als Börse, nun werden hier unter anderem Verträge fürs Leben zu Zweit geschlossen.
Fröhliche Feiertagsstimmung herrscht an diesem sonnigen Sonntag auch auf der Deribasivska, über die Karl vom Rathaus zum Stadtgarten zieht. Hier haben die Flaneure auf dem breiten Pflaster zwischen den Baumreihen den Alleinanspruch. Die Autos sind von diesem Boulevard verbannt. Mitten auf der Straße bietet eine Luftballonverkäuferin ihre Ware feil. Zwischen den Fußgängern kurven Kinder in kleinen Tretfahrzeugen herum.
Inmitten des Stadtgartens haben rund um den kleinen Brunnenteich Künstler unter den Bäumen ihre Staffeleien aufgebaut. Ihre Werke stehen hier zum Verkauf an die Flaneure bereit. Auf dem steinernen Rand des Teiches sitzen Einheimische und Touristen. Eine hübsche Blondine tippt eine Botschaft in ihr Smarttelefon. Hat sich ihre Verabredung verspätet? Gelangweilt betrachtet sie ihre rot lackierten Fingernägel.
Potemkinsche Treppe
Nun aber strebt Karl endlich zur See und dem Touristenmagneten der Stadt, der Potemkinschen Treppe. Als die Besucher Odessas noch zumeist per Schiff ankamen, war sie der erste Eindruck von der Anlegestelle aus. Sie führt hoch zur Stadt mit ihrem Straßenschachbrett. Am Ende der sich nach oben verjüngenden Treppe, die dadurch noch länger wirken sollte, steht auf dem Küstenboulevard das Denkmal des Herzogs Richelieu, der unter seinem Gouvernat Odessa so sehr geprägt hat. Benannt ist die Treppe jedoch nach Grigori Potemkin, dem ehemaligen Kammerjunker der Zarin, der bis zum Feldmarschall und wichtigsten Berater von Katharina der Großen aufstieg. Ihr Liebhaber war er auch. Die größte Leistung des Organisationstalents war jedoch die Entwicklung der südlichen Provinzen und der Sieg im Krieg gegen die Türkei.
Weltberühmt wurde die Potemkinsche Treppe durch eine Sequenz in Sergej Eisensteins Revolutionsfilm „Panzerkreuzer Potemkin“. Ein Kinderwagen rollt die Treppe hinunter, während Soldaten auf der Hafentreppe den Arbeiteraufstand von 1905 niedermetzeln.
An diesem friedlichen Septembersonntag liegt im Hafen nicht der Panzerkreuzer, sondern ein griechisches Handelsschiff, dessen Besatzung ganz anderes im Sinn hat als Meuterei und Aufstand, wie Karl später bemerken sollte. Da er sich dem Katharinenplatz von der Landseite nähert, sieht er den französischen Herzog zunächst von hinten. Der Stadtgestalter auf dem hohen Sockel trägt eine Toga, als sei er ein römischer Senator. Mit der rechten Hand macht er eine Geste, als lade er die Ankömmlinge von See in die Stadt ein.
Das Hochhaus des Hotel Odessa ragt wie ein steiler Zahn hinter dem Fährbahnhof auf und drängt sich mit seiner Hässlichkeit in das Blickfeld des Stadtwanderers, der die 191 Stufen der Potemkinschen Treppe hinabsteigt. Schön ist, wie sich in der gläsernen Front des Morskij Waksal, des modernen Meeresbahnhofs, die davorstehende Skulptur „Goldenes Kind“ und die Hafentreppe spiegeln. Auf der ins Meer hineinragenden Hafenmole steht hinter dem Hotel noch die kleine Nikolai-Kirche, ein erst 1994 errichtetes Bauwerk, das dem Schutz der Seeleute, Fischer und aller Passagiere gewidmet ist.
Schwarzes Meer und Seefahrer-Kirche
In ganz anderer Weise um das Wohl der Matrosen besorgt ist eine auffällige Blondine, die in ihrem SUV vor dem griechischen Frachter vorgefahren ist. Die sexy gestylte „Dame“ im Minirock und mit knallroten Lippen verteilt Handzettel mit der Adresse ihres Etablissements. Die ersten vier „Angeheuerten“ steigen denn auch in ihren Geländewagen. Und schon braust die schöne Jelena mit ihren Kunden davon.
Kaum ist der lustgeladene Wagen fort, fahren drei blumengeschmückte Limousinen vor. Ihnen entsteigen weitere Schönheiten, diesmal jedoch erneut eine Hochzeitsgesellschaft. Nicht Minirock, sondern lange Roben ziehen nun die Blicke auf sich, die Braut recht züchtig, die Brautjungfern dafür umso wirkungsvoller in ihren eng anliegenden, geschlitzten und halb transparenten Kleidern. Zusammen posieren sie vor dem Hintergrund des Meerespanoramas für das Familienalbum.
Auf dem Rückweg in die Stadt kehrt Karl im Kumanets ein. Dieses Lokal nicht weit vom Katharinenplatz war ihm schon auf dem Hinweg in der Havanna-Straße schräg gegenüber vom Stadtgarten aufgefallen. Mitten in die Millionenstadt Odessa versucht das Kumanets ein dörfliches Ambiente zu zaubern. Die bedienenden Mädels tragen bunte Röcke, bestickte weiße Blusen und einen Kranz aus zusammengeflochtenen Feldblumen über dem Haar. Hinten hängen daran vielfarbige Bänder. Die Burschen, die sich um die Gäste kümmern, stecken in weißen Hosen und kurzen hüftlangen Hemdkitteln, um die Taillen ein rotbraun-schwarzes Band geschnürt, auf der Brust einen gestickten Einsatz in den gleichen Farben. Alle sind hübsch, freundlich und beflissen, so dass der Gast schon vor dem Essen gute Laune bekommt. Am Spätnachmittag nimmt Karl draußen auf einem Korbstuhl unter einem der Sonnenschirme Platz. Dezent fotografiert er eine der buntbedressten „Dorfschönen“ von hinten, als sie am Nebentisch die Bestellung aufnimmt. Es gibt typisch Ukrainisches. Karl wählt einen leichten Rote-Bete-Salat vorweg, eine gefüllte Roulade als Hauptgang und die obligatorischen Blini als Nachspeise, dazu ein gutes Bier. Er ist hochzufrieden und schwört sich, am nächsten Tag wieder zu kommen.
Bei seinem „Heimweg“ zurück ins Hotel fällt dem leicht alkoholisierten Dorfschenkenbesucher ein eleganter Herr am Straßenrand auf. Er rührt sich nicht von der Stelle. Beim Näherkommen erkennt er ihn. Der gute Mann steht immer noch vor seinem Museum. „Guten Abend, Herr Puschkin“, entbietet der deutsche Gast dem russischen Großdichter seinen Gruß. Der Urenkel des „Mohren des Zaren“, Abraham Petrowitsch Hannibal, hat in seinen zwanziger Jahren einige Zeit in Odessa gelebt. Der 1799 geborene Poet starb 1837 im Alter von noch 37 Jahren in Sankt Petersburg, an den Folgen eines Duells um die Ehre einer Schönen, seiner Ehefrau Natalja.
Alexander Puschkin
Blauer Montag am Schwarzen Meer
Der Sonntag ist gegangen und mit ihm das strahlende Wetter. Für Karl ist das die Gelegenheit, die Ukrainer im Alltag zu sehen und zwar bei „Arbeitswetter“. Ein bisschen „Arbeit“ hat auch er an diesem Montag zu erledigen. Die Passage nach Bukarest zu regeln, ist gar nicht so einfach. Wie befürchtet, lässt sich in Odessa kein Ticket bis in die rumänische Kapitale buchen, sondern nur bis Kischinew, der Hauptstadt von Moldawien. Erschwerend kommt hinzu, dass die Dame im Service-Center des Hauptbahnhofs behauptet, dass sein im Internet ausgewiesener Zug nicht verkehre, obwohl er ihn in der Halle mit Zugnummer und korrekter Uhrzeit angeschlagen gesehen hat. Dahinter standen allerdings fünf kyrillische große Lettern, deren Sinn sich ihm nicht erschloss. Abkürzung oder Wort? Sein Sprachführer gibt nicht so viel her, als dass er die Zeichen eindeutig interpretieren könnte.
„Wann lerne ich endlich ernsthaft Russisch und nicht so spielerisch und utilaristisch, von Satz zu Satz, von Zweck zu Zweck anhand meines Reisewörterbuchs“, schimpft Karl mit sich selbst. Diese Kommunikationsstrategie klappt wunderbar, solange die Gegenseite keine unprogrammgemäßen „Widerworte“ gibt. Aber wehe sie weicht vom Schema ab, dann steht er da in seinem sprachlich kurzen Hemd und seine Blößen werden offenbar. Nun denn, er geht auf „Nummer Sicher“, befolgt dann eben den Rat der Dame im Service-Center und bucht den Zug eine knappe Stunde später. Damit reduziert sich der Aufenthalt in Kischinew oder Chişinǎu, wie die rumänischsprachige Mehrheit am Zielort sagt, von eineinhalb Stunden auf eine halbe Stunde. „Hoffen wir, dass das reicht!“ meint der Skeptiker in Karl.