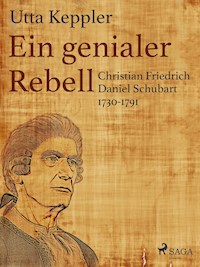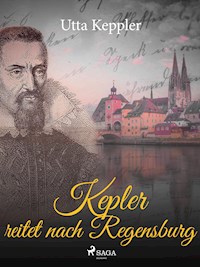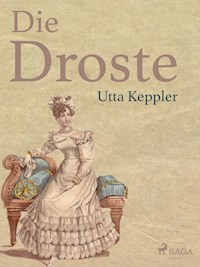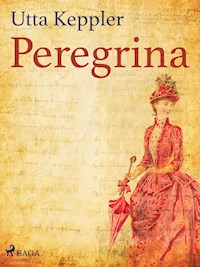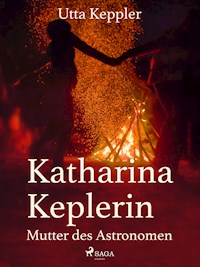
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Katharina Kepler war die Mutter des bekannten Astronomen Johannes Kepler. Sie lebte zur Zeit der Hexenverfolgung in Württemberg und wurde schließlich auch selbst als Hexe angeklagt und somit in einen Hexenprozess verwickelt. Mit der Hilfe ihres Sohnes kämpft sie gegen die Anklage. Dieser biographische Roman ist eine spannende Erzählung über Katharinas Leben und Erfahrungen in jener Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Katharina Keplerin
Mutter des Astronomen
SAGA Egmont
Katharina Keplerin - Mutter des Astronomen
Copyright © 1980, 2017 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711708521
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Ich widme dieses Buch meinenvier Söhnen.
1. Kapitel
Weil der Stadt
Das Fachwerkhaus am Markt ist schmal, steile Treppchen; muffiger Geruch nach altem Holz schlägt einem entgegen und scharfe Schwaden aus der Latrine daneben, die in der Sommerhitze die dünnen Fliegen anzieht.
Katharina nimmt wieder den Wischlappen, windet ihn in den Eimer und putzt und scheuert. Sie fegt die Klumpen zusammen, die der Mann mit seinen Stiefeln hereingeschleppt hat, und trägt den Kehricht hinters Haus. Die Nachbarskinder kommen polternd herein, hinter ihnen der Kleine, ihr Johannes. Er bleibt neben ihr stehen und schaut ihr zu, ein schmächtiges Kind mit großen Augen, ein »Zimperling« und ein »Zôchen«, wie sie hier sagen. Sie dreht sich hastig um und sieht, daß er wieder die Pusteln auf der hohen schmalen Stirn hat, wie schon oft, und die roten Augenränder. Katharina wirft den Lappen in die Schmutzbrühe und streckt die Hand nach ihm aus. Er bleibt zögernd stehen, er weiß nicht recht, was sie will, Zartsein oder Schimpfen, man weiß es nie ganz sicher bei ihr, sie ist eine »Rasche«, sagt der Vater.
Aber dann macht er doch ein paar schwankende Kinderschritte auf sie zu und läßt sich anfassen, umfassen, legt auf einmal seinen dunklen Kopf an ihre Schulter und riecht den mütterlichen Geruch.
Der Jüngste in der Wiege schreit, man hört’s bis herunter, sie fährt auf, die Muhme hat nicht aufgepaßt, oder sie ist eingeschlafen; sie verzieht das Gesicht: Alles muß ich tun, an alles selber denken. Sie hat die Suppe für den Abend auf dem Herd, Gerstensuppe mit Zwiebeln, und sie läuft hinaus. Johannes trippelt ihr nach. Sie dreht sich um. »Geh hinüber und guck’ nach dem Vater!«
Das Kind steigt die Staffeln vor dem Haus hinunter und stapft über den Vorplatz. Er tut’s nicht gern, der Kleine, er weiß schon, daß der Vater bei Soldaten und Krämern sitzt und vom Umtrieb in der Welt hört.
Die Wirtsstube ist fahl vom Dunst, bunt blitzt und funkelt es aus dem Trüben, farbige Wämser, Federbarette, das unterscheidet er allmählich mit den kurzsichtigen Augen. Es ist alles ein fleckiges Gewirr, und mitten im Haufen, wo die Bierkrüge klirren und klappern, entdeckt er den Vater.
Heinrich Kepler ist ein breiter Mann mit blondem Bart und rolligem dunklerem Haar, er hat die Kappe weggelegt, und sein Gesicht ist rot und glänzt.
Das Kind steht, den Finger im Mund, vor ihm, gedrängt und gestoßen von den Soldknechten, die mit Gläsern und Zinngeschirr fuchteln. Heinrich Kepler schiebt den Kleinen weg, dreht den Kopf nach den Soldaten, fragt, den Bart wischend, noch einmal, was der Alba seinen Knechten zahle …; die lachen bloß.
Jetzt steht der Junge zwischen den breit ausgespannten Beinen des Vaters und klopft mit dem Händchen auf sein Knie, weil er sich anders nicht zu helfen weiß. Heinrich faßt ihn unter den Achseln und hebt ihn vor sich, drückt ihn fest gegen sein Wams und schreit: »Bist endlich still, dummer Kerle, ich komm nicht, und wenn’s die Frau verreißt!«
Der Kleine weint jetzt, er greift mit ernstem Gesicht nach dem Kinn des Vaters: »Aber die Mutter hat es gesagt! Ich muß den Herrn Vater heimbringen!«
Die Leute lachen. Das Kind erschrickt vor dem Gedröhne und duckt sich an die Brust des Vaters.
»Geh nur!« sagt der und setzt es auf den Boden. »Sag, ich komm sicher nicht hinüber!«
Da schiebt sich der Waibel dazwischen. »Recht so, Heinrich, Weiber verstehen nichts von unserem Handwerk, und wenn du heimkommst als Hauptmann, wird sie kuschen.«
»Vater!« bittet der kleine Johannes. Aber der große Mann steht nicht auf, er stößt ihn weg. Er weint wieder: »Die Mütz, Vater!« Der Mann wirft die Kappe auf den Tisch, in eine Bierlache. »Kappe? Mütz?« Er lacht böse. »Kappler haben sie mich geheißen, Kappenmacher, die Affen, und von meinem Urahn weiß ich doch, daß zwei Brüder Kepler zu goldenen Rittern geschlagen worden sind, bei der Kaiserkrönung Sigismundi zu Rom.«
Die anderen johlen und reden durcheinander, das sei doch kein erwiesenes Faktum, sondern allenfalls eine Annahme und ein Dekorum, und man kenne sein großes Mundwerk und die Ruhmsucht, die immer höher hinauswolle; bei einem Kriegsmann gelte die Mannhaftigkeit – ein gewaltiger Hieb wiege mehr denn der verschollene Adelsbrief.
Sie schreien, streiten, raufen schließlich, bis der Wirt sie auseinanderreißt und Heinrich, plötzlich erschlafft, unsicher geworden, den nassen Hut ausschüttelt und zusammenknüllt. So schiebt er sich aus der Tür, das Kind geht ihm nach.
Draußen steht Katharina, sie schaut dunkel und ohne Hoffnung auf den schwankenden Mann. Wilder Ärger springt sie an, sie zwingt sich zu schweigen, faßt Johannes fest an der Hand und wartet, bis ihr Mann wirklich gegen die Tür zugeht und sie ihm nachsteigen die schmale Treppe hinauf in den düsteren Flur und in die Stube, dann erst redet sie, als wäre es lang bereit gewesen und nicht mehr aufzuschieben: »Heinrich«, sagt sie, »das Essen steht da, iß. Ich geb den Kindern aus und tu sie ins Bett. Dann muß es mit uns ins Reine kommen, so kann die Unruh nicht bleiben …«
Heinrich setzt sich, ihm ist schwindlig vom Bier, er ärgert sich über die hämischen Reden, die er noch im Abgehen von den Söldnern und Bauern gehört hat, er ärgert sich über die Ruhe der Frau, die er nicht aus ihrer Besonnenheit hat reißen können, so heftig sie manchmal sein kann.
Als die Kinder endlich schlafen – Johannes schreit auf im Traum, murmelt und plappert vor sich hin, und sie streicht ihm über die naßgeschwitzten Haare –, als sie beide endlich still sind, und leis’ schnarchend tief in die Kissen gesunken, steht sie in der Küche vor ihrem Mann, der sich an den Herd gesetzt hat, die nasse Kappe vor dem Feuerloch drehend, und jetzt zu ihr aufsieht, nur mit den Augen, den Kopf gesenkt wie ein zorniger Stier.
»Laß mich!« murrt er böse; Katharina kennt die Laune, den Drang, zu glänzen, zu gelten und recht zu haben und weiß, daß das Zureden so wenig dagegen hilft wie früher das wilde Aufbegehren, das Weinen, das Drohen und Mahnen. »Heinrich«, sagt sie müde, »du kannst doch den Handel nicht einfach liegen lassen, die Fuhrmeisterei und das Gütle und uns alle drei, du mußt doch bedenken, was werden soll – Heinrich …« Er greift die Stehende mit beiden Armen um die Knie und zieht sie an sich. »Kätterle, ich muß aber!«
»Du mußt … und hast doch auch ein Hirn und einen Verstand, du, mit deinen großmächtigen Ahnen, und nicht nur einen eitlen Trieb, und hast mich und den Hänsle und den Heinerle; und uns ließest zurück, wenn sie dich anwürben, hier im Haus bei der Ahne und der Bas’, der Wellingerin und …«, sie dreht sich zur Seite und weint.
Heinrich läßt sie los. »Das verstehst nicht.«
Sie lacht bitter. »Das alte Gerede! Und ob ich’s versteh – aber muß es denn immer bloß um deinen Ruf und Ruhm gehen?«
Er steht auf. »Ach, Ruf und Ruhm …«, sagt Heinrich Kepler auf einmal verächtlich, »es ist auch so nimmer zum Aushalten …«
Darauf schweigt sie. Sie nickt sogar, denn eben, als er stiller wird und ihr vielleicht zugehört hätte, poltert und trampelt es über ihnen, ein Stuhl fällt um oder ein Schemel; die Alte, seine Mutter, die Keplerin kreischt; die Wellingerin heult auf, ein Fenster klirrt, Katharina wird blaß, sie schiebt ihren Mann weg, der hinauflaufen will, und geht aus der Tür.
Die beiden Frauen haben sich ineinander verkrallt wie zwei Katzen, der Hund kläfft hinter dem Knäuel herum, die Kanne auf dem Tisch schwankt. Katharina springt mit einem Satz dazwischen. Die Schwieger, braun und dunkeläugig, mit faserigem weißem Haar, läuft auf sie zu. Es geht um das Geld für die Eier, die man verkauft hat, die paar Hühner hinter dem Gitter legen nicht viel jetzt im Winter, die Base hat lässig gehandelt, hätte mehr herausholen sollen, hat sogar ein paar Stück beiseite getan.
Die weint, das könne die Statthalterin nie beweisen. Sie fährt wieder auf die andere los.
Katharina hält die alte Frau fest, ihre dürren Arme spürt sie durch den Wollärmel, sie stützt sich auf eine Tischkante und winkt der anderen, sie solle gehen. Die drückt sich aus der Tür.
Jetzt fährt die alte Keplerin auf: »Du hast grad noch das Recht, mir vorzusagen, was ich tun darf! Du, Schultheißentochter von Eltingen – was das schon ist! Weil dir der Heinrich ein Kind gemacht hat vor der Zeit – wie du’s wollen hast! Du, – nichts ein’bracht, nichts gewußt und nichts können …«
Katharina Keplerin steht dabei, sie ist starr geworden, steif bewegt sie sich und sinkt dann, wie abknickend, auf den Schemel. »Weißt selber, Frau Mutter, daß es anders gewesen ist.«
»Seit wann sagst du ›du‹ zu mir?«
Katharina gibt keine Antwort. Sie horcht nach der Treppe. Bloße Füßchen tappen herauf, dann ist es still. Die alte Frau schaut hin. »Geh nur, da ist eins von deinen Kegelna …«, sagt sie leise und gehässig.
Katharina macht die Tür auf, und draußen steht im langen grauen Hemd der Johannes. Er rührt sich nicht, steht da und schaut. In seinen dunklen Augen sieht sie beim Kerzenlicht den schweren Ernst, die Verantwortlichkeit, die Angst des Buben, den sein Leben weit überfordert.
Drunten klappert Heinrich Kepler mit Geschirr und Löffeln, er sucht wahrscheinlich etwas zu trinken oder zu essen – er trappt mit den Stiefeln hin und her im Gang, es ist, als wolle er hinaus auf den Marktplatz, zu den lärmigen Kumpanen.
Katharina hastet an der alten Frau vorbei, an dem Kind, das ihr mit weitem Blick nachgeht, bis ans Ende der Treppe, – und wird zurückgestoßen.
Heinrich läuft aus der Haustür. »Geh heim, laß mich in Ruh, bleib drinnen!«
»Ach«, sagt sie ganz leise, sie macht ein paar Schritte hinter ihm drein und kehrt dann um.
Anderntags ist er fort; er kann nicht weit weg sein, man hat ihn mit einem Trupp Angeworbener auf der Landstraße gesehen; er ist ohne Abschied gegangen.
Sie mag nicht nachlaufen, nicht mehr bitten, mahnen, betteln, sie sitzt in der Küche vor dem Tisch und würgt trocken, als wolle sie ersticken am Weinen.
Das enge hohe Haus ist wie ein Kerkerturm um sie her, die streitenden Frauen, der gewalttätige jähzornige Großvater, Amtsbürgermeister und »Statthalter des Reichs«, und weil er nur über eine ganz kleine Reichsstadt Gewalt hat, hält er sich um so stolzer, will seinen Titel hören und die Schreiber im Rathaus laufen sehen. Daß der Heinrich ein unruhiger Geist ist, unnötig aufmuckt gegen den mächtigen Alten, rechnet er ihr an, der Schwieger, die bloß aus Eltingen gekommen ist und nicht aus der Freien Reichsstadt. Er steht ja unter keinem der kleinen Landesherren, sondern direkt unter der Heiligen Römischen Majestät, er hat sogar das Recht, rot zu siegeln, mit dem Adelssiegel, wenn er will.
Jetzt, im Winter, geht er in der Pelzschaube, im breiten Fellkragen über dem gefalteten Amtsrock, und kaum die eigene Frau, die er als Kätterle Müller aus Marbach am Neckar geheiratet hat, gilt ihm als ebenbürtig, obwohl ihr Vater der Reichsmüller oder der »reiche Müller« genannt worden ist.
Der Alte ist wenigstens bei seiner Amtswürde und Eitelkeit zu fassen, ihn versteht Katharina eher zu nehmen, aber die Frau, die Mutter ihres Heinrich, die ihn zuerst und vor allen und vor ihr selber im Arm gehabt, die ihn gesäugt und gewiegt hat und getragen, die will ihn nicht abtreten und hergeben und ist ihr bös und feind, wenn sie sieht, daß sie wieder ein Kind erwartet, und böse auch, wenn sie spürt, daß sie jung und stärker ist als sie, die Abnehmende.
Und dann – Katharina ist erschrocken, als sie es erkennt: Die Alte spürt, daß sie die »Fernfahrt« hat; so nennt sie es selber, die bohrende unwiderstehliche Eindringlichkeit, die sie überall hinfühlen und -tasten läßt, wo die anderen nicht mehr hinreichen.
Damit kann sie zwingen, wenn sie sich anspannt, zart rufen, liebevoll führen, als wär’s ein Gebet: So ruft sie den Heinrich jetzt, der so weit weggezogen ist. Und so, fortgerissen aus sich selber, aus Ort und Zeit, erlischt ihr Bewußtsein.
Die Wellingerin findet sie dann, sie liegt neben dem Tisch in der Küche, mit offenen Augen, die blicklos nach oben verdreht sind; das schmale Gesicht ist entspannt, die Tränenspuren laufen über die mageren Wangen bis an den Mund; jetzt lächelt sie in der Entrückung, als ob sie etwas Schönes gefunden hätte … Fast jedesmal, wenn Katharina solche »Anfälle« hat, läuft die ganze weibliche Verwandtschaft zusammen, die mit im Haus wohnt. Die Wellingerin, die sie gefunden hat, ruft die Schwieger, die Schwestern des Vaters kriechen aus allen Winkeln, wo sie spinnend oder stumpf sinnierend gehockt haben, man scheut sich, die Bewußtlose anzureden, weil man ihrer »Sucht« nicht traut, die vielleicht doch überspringen könnte.
Die junge Frau kommt zu sich, als der vierjährige Johannes sie weinerlich anruft und unaufhörlich streichelt. Heiner, der Zweijährige, habe wieder die Krämpfe, jammert er, und sie müsse jetzt kommen.
Sie fährt hoch, beschämt über ihre Anwandlung, mit einem angstvollen Blick auf die Frauen, rafft sich vom Boden auf und läuft zum Spielwinkel des Kleinen, der sich gekrümmt, Schaum vor dem bläulichen Mündchen, auf den Dielen windet.
Johannes sieht es verstört und geht erst von den beiden weg, als die starken streichenden Finger der Mutter den kleinen Bruder beruhigt haben. Der schläft danach gleich ein.
Derweil trottet der Vater, Heinrich Kepler, mit der zusammengewürfelten Truppe durchs Land. Er redet den und jenen an, den er kennt, auch Fremde will er für sich interessieren, verkündet großspurig, er sei als Sohn eines Amtsbürgermeisters imstand, ihnen allerhand Vorteile und Ehrungen zu verschaffen, wenn sie sich gut mit ihm stellten.
Allmählich wird der singende lärmende Haufen stiller, da der Marsch in den Abend geht und es kälter wird. Man weiß nicht recht, wo Quartier gemacht werden soll; es könne noch etliche Wochen dauern, das Marschieren, es gehe scheinbar den Rhein hinab, denn die Niederlande seien weit.
Gegen Mitternacht wird dann Halt befohlen, man wartet den Troß ab, und als der die Zelte auslädt, fängt man schnell mit dem Aufschlagen an. Erst am nächsten Morgen werde man dann die Fähnlein einteilen, heißt es.
Aber der Schlafplatz in den Zelten sei rar, und bloß der Waibel und die Offiziere könnten sich in den ihren recht bewegen.
Etliche gingen auch heimlich in die Dörfer ins Heu und zu den Bauernmägden, aber das sei streng verboten und werde hart gestraft.
Er liegt lang wach, halb auf einem anderen, der schnarchend vor sich hin döst und einen üblen Geruch hat.
Heinrich kann nicht einschlafen – er sieht die dunkle Frau, wie sie ihn ruhig und eindringlich und immer bohrender anschaut, wie sie ihren Mund zuhält mit der verarbeiteten Hand, als wollte sie den Schrei und Ausbruch verhalten, der seine Unbeherrschtheit anklagt. Er sieht auch die großen, seltsam verdunkelten Kinderaugen seines Johannes und das rote Köpfchen des Kleinen, der krank ist und Sorgen macht; Johannes, im Winter geboren und nach dem Kalenderheiligen getauft, Johannes ist im Mai gezeugt worden, unter dem gläsern-schimmernden Horizont, am Waldrand, als ein Sternschnuppenfall über den Himmel sprühte und die alten großen Buchen in einem hauchenden Wind dufteten. Er hat einen Sohn gewollt und Katharina auch – und daß das Kind zu früh geboren ist, mag an seiner eigenen Heftigkeit liegen, an den unguten Schlägen auch, die ihre Eltern der jungen Frau gegeben haben, weil ihnen die Ehe zu bald kam, weil sie die Tochter noch zur Arbeit im Haus halten wollten.
Sie sind dann beide im engen Keplerhaus geblieben, haben von den Alten gelebt, und er hat sich im Handel des Vaters ein bißchen umgetan, nicht viel, ihm war’s zu langweilig und eng da – Tuch und Wachs und Fuhrverleih –, während Katharina wie eine Hausmagd gehalten wurde und auch die Schwiegermutter und die kränklichen Schwestern versorgte und ihnen kochte und wusch.
Sie wird’s nicht leichter haben, wenn ich jetzt fort bin, sagt er sich, sie werden sie noch mehr ausschinden, und daß ich zu den Papisten will, ist ihnen gleich einer Todsünde – es geht ja durcheinander mit ihrem Glauben – katholisch und lutherisch und mitten in den politischen Händeln keins von beiden ganz – und nirgends eine Klarheit …
Er sieht sie, Katharina, noch immer vor sich und spürt ihr Ziehen und Drängen; endlich schläft er ein, fällt brunnentief in seine Erschöpfung und wacht erst auf, als die Trompete weckt und alles hochjagt.
Der Hauptmann hält eine Rede, kaum verständlich – er ist ein Provenzale –, kann wenig Deutsch, schreit, man habe den rebellischen Holländern das Maul zu stopfen, da sie ja der katholischen Majestät und der spanischen Kirche widerstrebten.
Bei den Landsknechten wird viel geredet: daß man den neuen Glauben nur nutze, um einen Machtvorteil und Landgewinn zu erreichen, daß man auch im alten Glauben selig werden könne, wenn man ihn recht ansehe; daß man den Alba freilich entlassen und abgestellt habe, da er es den Niederländern allzu schwer gemacht, Leute wüst gefoltert, eingegraben bis zum Hals, verbrannt, gekreuzigt – daß er auch hätte die Inquisitoren wüten lassen, wie sie wollten, da sie es doch – wie er meine – zu Gottes höherer Ehre täten, denn die Spanier hielten dafür, daß man den Teufelsdienern, den Lutherischen und Hexerischen, die Satansbuhlschaft anmerke und anrieche, so daß es dem Höchsten wohlgefällig sei, wenn man sie mit Stumpf und Stiel ausrotte. Derlei verwirrte und alberne Redereien gehen im Heer um, und die Manneszucht ist dabei scharf und nicht immer gerecht – man fürchtet den Profoß und den Priester. Denn der macht’s ihnen auch nicht leicht; wer lutherisch scheint, gilt von vornherein als verdächtig, zumal in dem bunten Haufen aus Deutschen und Kroaten und Südländern; die Priester sind oft Katholiken und nehmen sich für Kämpfer Gottes. Da ist es am besten, sich nur auf’s Handwerk zu legen, auf’s Kriegsgeschäft, und nicht einmal groß hinzuschauen, wem’s gilt.
Man läßt sich kaufen und verschieben auf den Plätzen der Welt und sieht zu, daß die eigene Haut so heil bleibt wie möglich.
Das ist freilich selten genug, und kaum einer kommt ohne Blessur und zerrissene Glieder heim, wo es noch irgendeine Heimat gibt. Denn hier am Niederrhein und in Holland sind die Dörfer verbrannt, die Leute hocken in den Wäldern, die Hilflosen und Schwachen gehen ein wie Tiere. Wer etwas Eigenes hat, und dazu noch im unbekriegten Land, ist gut dran, solange es ihm gehalten und gepflegt wird.
In Weil der Stadt, die stolz auf ihr Stadtrecht ist und jedes Schriftstück zeichnet mit: »Gegeben zu Weil, der Stadt«, kramen und wühlen sie weiter wie eh, graben und hacken, werken und treiben um, und viel Ausblick über die Mauern haben sie nicht. Man kennt das Nächste und richtet sich ein, man ist sicherer intra muros, aber man spürt doch die große Gefahr um die Mauer her und die Drohung von überall und traut auch dem Kaiser nicht und dem Papst nicht mehr, und Gott ist verschleiert und verborgen, und man weiß nicht recht, wie man ihm dienen soll, da sich die Kirchen jetzt selber bekämpfen und keine – scheint es – den ganzen Segen Gottes mehr besitzt, da sie angegriffen und angekränkelt sind, denn ihre alte Lehre hält nicht mehr stand –: »Sonne, steh still!« wie man von Aron und Gideon gelernt hat, gilt nicht mehr, nicht die Sonne dreht sich ja um die Welt – die kleine Erde wirbelt um sich selber und spiralig um die große Sonne, und die Planeten wirbeln; und sie rechnen und zirkeln darüber, sagt man.
Gilt denn noch die Macht und Gewichtigkeit der Symbole, die alles einbegriffen, da man doch das letzte nicht anders sagen kann?
Und der neue Glaube stellt das Denken und Urteilen in die Mitte aller Werte, und die »überschaubare Wirklichkeit« – aber die – ist nicht zu überschauen!
Das freilich sagt und schreibt niemand in dem kleinen Gemeinwesen, aber sie spüren es und suchen Zuflucht. Denn wo ist die Welt noch zu erfassen, wenn man auf sich selber gestellt ist, dem unendlichen Gott gegenüber? Und keine Autorität der Kirche, die doch sein Haus ist? Vater unser … aber was will er von ihnen? Da fliehen die einen ins starre unantastbare Recht und verdammen und rotten aus, was ihren Buchstaben zuwider ist; und die anderen, die Dumpfen, Gedankenlosen, klammern sich ans Nächtige, an Wunder und Zeichen, an Geheimnis und Geraune, ans Verdeckte und Verbotene, das um so ziehender lockt und unwiderstehlicher reizt, je verborgener es umherschleicht.
Vor langen Zeiten hat es ja Macht gehabt, das Zauberwesen; von Kelten, Arabern und germanischen Zauberinnen, den Hagedisen, soll es gehütet worden sein, es hat den Lüsten und Trieben nicht alles Recht versagt, sie in geheime Kulte verkleidet und gepflegt, geheiligt und erhoben. Schwarze Messen habe man da gehalten, schaurige heilwirkende Kulte geübt, und da es das Versagte erlaubte und das Verfemte erreichbar machte, da es ungeheuerliche Lust versprach und neue erdgewachsene Feuerwonnen, ist es jetzt wie ein Magnet. Die Frauen sind Träger des Unterirdischen, der Erdschoß ist ihre Heimat – das Chthonische haben’s die Griechen genannt. Weiber, den Priestern versagt, fühlen sich in der kirchlichen Ordnung verachtet, sie seien denn der Jungfrau Maria geweiht. Und die Ängste vor dem Unsichtbaren, vor kriechender Pest und Lepra und Franzosenseuche, vor den unverständlichen Entschlüssen der Großen – das alles treibt sie, die Kindlichen, die Leichtverführbaren, ins Dunkle.
»Gefäße der Sünde« – die Weiber glauben’s selber fast, da doch die Urmutter Eva den Mann von der Paradieseswonne weggelockt und sie dafür ganz verloren hat … Und wo sie rein sind und groß und zu verehren, ist es die unfaßliche Ausnahme: Katharina war’s dem Heinrich, das wußten sie beide. Aber er ist fort, der Unruhige, in ihm gärt zuviel, das keinen Ausweg weiß, da ihm Bildung und Weisung fehlt und der klare Blick. Katharina ist ausgeblutet von einer Fehlgeburt und wird mit Geschrei und Gezänke zur schweren Arbeit getrieben, wäscht Fässer aus und bürstet die Holztische, schwenkt die Bierseidel … Sie werfen ihr vor, sie sei nur da, weil sie des Heinrich Weib sei, und der habe sie verlassen und also verworfen.
Ein heißer Sommer kommt herauf, die Dorfgasse stinkt vom Unrat; man mäht zeitig, denn das dürre Heu könnten die Gewitter verderben. Die Geißen, die im Stall des Bürgermeisters stehen, geben weniger Milch als sonst, und das Äckerlein, das er von einem alten Taglöhner schneiden läßt, hat kurzes Stroh und daran dünne Ähren getragen.
Da ist an einem schwülen Abend der Heinrich wieder da, narbig und zerzaust, mit einem schweren Sack auf der Schulter, das Roß hat er vor dem Ort verkauft, er hat’s erworben als Beute – wenn er wieder auszieht, ist er ein Einrösser, ein Ehrentitel mit der Pflicht, nicht ohne Pferd anzutreten.
Der Alte, den man aus dem Rathaus holt, ist böse; er sieht’s als Schande an, daß der Sohn »entlaufen« ist, glaubt’s nicht recht, daß sie ihn regelrecht entlassen und entlohnt haben, und nimmt’s ihm übel, daß er die Beute unter den Päpstlichen gemacht hat und nicht unter den Lutherischen. Denn er hält scharf darauf, daß die Keplerischen als lutherisch gelten, eben weil er selber, der Amtsbürgermeister, anno 1571 dem Kaiser auf einem Reichstag die Treue zum alten Glauben zugeschworen hat – um seinem Städtlein den Kaiserschutz zu sichern, nachher aber umgeschwenkt und sich protestantisch gehalten hat, im gleichen Jahr, in welchem sein erster Enkel, Johannes, geboren wurde, der noch katholisch getauft war, aber protestantisch erzogen. Da kümmert sich denn der Alte um die Reputation der Sippe, beantragt im Rathaus die feierliche Bewirtung des heimgekommenen Sohnes. Sie tun ihm den Gefallen, laden den Heinrich zu einem Ehrentrunk ein und überreichen ihm den silbernen Becher. Katharina freut sich, und der Vater ist stolz – er sorgt dafür, daß die Kosten für das Ehrenmahl genau aufgeschrieben sind und dem Heinrich sogar ein Geleit zum Ratssaal gegeben wird; die Frau ist freilich nicht mitgeladen, das wäre gegen alle Regel … Sie fürchtet die Augen der Schwieger und das vertrotzte Schweigen des Alten. Johannes, der gescheiter ist als es seinem Alter zusteht, kommt ein paarmal heulend und zerbeult heim, man hätte ihn wegen der Mutter geschlagen, hätte ganz Übles über sie gesagt, und die Buben auf der Gasse wollten’s von ihren Müttern haben. Irgendeine der Frauen will auch gesehen haben, daß die Kätter, als der Mann aufs Rathaus geführt worden zur Ehrung, noch eh er mit hochrotem Kopf vom Trunk bei den Oberen zurückgewesen, sich im Haus und am Fenster gedreht und in einem festlichen blauen Gewand prachtiert habe.
Jetzt, wo der Neid sie beutelt, wissen sie auf einmal wieder von ihrer Verwandtschaft und Kinderheimat bei einer Hexe, und das ist eins der ärgsten Male, an denen Unholde und Unnennbare erkannt werden – Belehrung und Verführung durch das Teufelsgeschwader.
Einmal wirft einer – Katharina erkennt nicht, wer’s war – einen Stein in ihr Fenster; jemand schiebt einen Zettel unter die Tür, auf dem steht, daß es eine Schande sei, wenn eine die »Reine« heiße, Katharina, und mit dem rußigen Bösen zu tun gehabt habe. Die Leute kommen seltener ins Wirtshaus; sogar der Heinrich sieht sie schief an, sie merkt, daß er sie meiden möchte und es nicht kann, da er die alte Vertrautheit spürt und dankbar und zart sein möchte im Gedanken an die Kinder. In der Nacht weint die Frau lange und haltlos. Heinrich nimmt sie in den Arm und tröstet sie derb und ungeschickt, bis sie einschläft.
Aber am Morgen ist sie hellwach und entschlossen. »Heinrich«, sagt sie, »wenn du wieder fortgehst, geh ich mit, ich bleib nicht da, es sei wohin es gehe.«
»Und die Kinder?« Sie hat es erwartet. Ja, das wäre das Ärgste, mitnehmen könne man die nicht. Aber die Großmutter möchte doch ein Erbarmen haben, und die Basen, es seien ja so viel Frauen im Haus. Sie halte es einfach nimmer aus so … denn nur sie sei Anstoß und Vorwurf, und man sehe in allem, was sie tue, etwas Verworfenes.
»Woher weißt’ für gewiß, daß ich wieder geh?« fragt er, ernst und doch erleichtert.
»Du hast’s im Traum gesagt, hast gebrummt und gestöhnt, bis ich dich geweckt habe, und dann noch einmal ganz klar – es sei zu eng da hinnen. Weißt’s nicht mehr?«
Die Eltern sind fort, heimlich sind sie in der Nacht beide gegangen, Heinrich hat einen Kumpan getroffen und mit zwei Pferden in den Wald bestellt, und jetzt reiten sie; die Frau weint und zittert.
Es geht gegen Norden, sie brauchen jetzt nicht mehr heimlich zu tun, denn die Sippe wird ihnen nicht nachforschen: Das Weib hat den Heinrich behext, und sie sind beide in bösen Händeln verschwunden. Bloß der alte Bürgermeister glaubt nicht an die Geschichten – er sieht, daß sein zerfahrener, unordentlicher Sohn die Frau nicht hat schützen können, die es nicht aushielt bei seiner bissigen Sippschaft. Er sieht auch, was es ist, wenn die junge Mutter ihre Kinder allein läßt in dieser Behausung: Sie muß arg verzweifelt gewesen sein, daß sie das tut und wird es nicht lang aushalten; so weit kennt er sie, denn für das Echte hat er noch ein Gefühl.
Katharina ist starr vor Grauen, was ihr da draußen alles geschieht und begegnet. Das hat sie nicht gewollt und nicht vorausgesehen. Der Gedanke an die Buben läßt sie nicht schlafen, sie hört im Traum den Johannes weinen und den Heinrich jammern, und wenn sie aufwacht, ist der Trubel des Lagers um sie her – Geschrei, Händel und, während der Bataille, die unterschiedlichen Botschaften und Gerüchte um den Mann, während sie mit den üblen Weibern vom Troß im Lager sitzt und der Hurenwaibel keinen Unterschied kennt zwischen ihr und denen.
Auch ist sie einmal angefallen worden von ein paar betrunkenen Knechten, und der Korporal hat sie herausgeholt aus dem Knäuel, in dem sie sich gewehrt hat wie eine Wildkatze – und als der Heinrich zurückkam, siegreich, mit Beute, haben sie’s ihm erzählt, und sie hat’s von weitem gesehen, wie zwei von den Wildesten am Baum gehangen sind – sie hat’s sehen müssen, hat sich an ihren Mann gekrallt und die Augen zugepreßt. Dann kam die Seuche ins Lager, eine Ruhr, man hat nicht recht gewußt, ob’s eine Pest sei oder werde, und die Männer waren froh, wenn sie wieder hinausziehen und andere Luft atmen konnten; unter den Verwundeten ist’s umgegangen, sie hat gepflegt und geholfen, brandige Wunden gewaschen und das Stroh ausgewechselt, bis sie selber krank war. Sie habe sich verhoben, hat sie dem Feldscher erklärt, es sei nichts weiter. Der hat den Mann ermahnt, er solle seine Frau aus dem Soldatenknäuel herausholen und heimschicken. Aber der Waibel und der Korporal haben dagegengesprochen – sie sei ein Halt für die verkommenen Weiber und eine Hilfe für die Kranken.
Heinrich schwankt auch diesmal; er hätte gerne die ganze Freiheit gehabt, was er Freiheit heißt – das Ungebundensein ohne Aufsicht, obwohl Katharina ihm nichts dreinredet und ihn nicht ausfragt. Aber sie wird ja wissen, was er mit den Troßweibern treibt und wie es beim Plündern und Niederbrennen zugeht; wenn sie ein Dorf erobert haben und zurück sind im Lager, hört sie davon reden, ruhmreden und renommieren, und Heinrich steigert sich hinein, mehr als die anderen, weil ihn im Grund seines Wesens das alles anekelt. Nicht nur, weil’s oft genug die Protestanten sind, die sie pressen und plagen und die ihre Quäler anflehen um Schonung, mit Bibelworten, die er von der Heimat her kennt, auch wenn’s niederländisch ist.
Da kommt eine Botschaft aus Weil der Stadt, mit einem Troßknecht, der sich hat anwerben lassen, weil der Statthalter ihm Geld dafür gegeben hat; er solle sehen, daß er mit dem Marschtrupp nach Vlissingen komme, und dann, daß er irgendwoher Erlaubnis erhalte, zu der Truppe des Heinrich Kepler zu stoßen; und weil der inzwischen Sergeant geworden ist, läßt man ihn zu ihm.
Katharina pflegt im Lazarett, Heinrich meidet sie jetzt, weil er Angst vor der Seuche hat, die sie einschleppen könnte, und sie badet im Zuber, ehe sie ihn besucht, wenn sie einen findet, und einen Winkel in der Wirtschaft, wo man sie alleinläßt.
Der Bote verlangt den Kepler zu sprechen, und Heinrich nimmt ihn mit ins Zelt, wo die anderen in einer Ecke würfeln.
»Ich soll sagen«, meldet der Junge, »es sei nicht zum Besten zu Weil der Stadt.« Er sieht Heinrich an und wartet, aber der winkt ihm ungeduldig.
»Die Pocken gingen um«, sagt der Junge, »man hat davon geredet, daß sie auch in der Bürgermeisterei schon seien.«
»Die Kinder?« fragt der Soldat.
»Ja, die auch.«
»Der Hannes?«
»Ja, auch, aber er lebe, nur die Äuglein seien arg verklebt.«
»Bursch!« sagt Heinrich, »vorläufig redest du mit keinem ein Wort davon, auch mit – keiner! Ich mein, mein Weib soll nicht erschrecken. Sag nichts.«
Aber er wird es selber tun, nur anders, und, wie er meint, zarter als der junge Bote.
Inzwischen liegt der kleine Johannes im Bett und stöhnt.
Die Lade ist zu steil und hart, die ihn wie ein Kasten gefangenhält, die Augen brennen und die Haut, die sich langsam abschält; er hat furchtbaren Durst, er wirft sich hin und her, und so altklug er sonst ist, er muß der Mutter rufen. Er ruft leise, wagt kaum zu weinen, weil die Tränen noch mehr wehtun, aber er kann’s doch nicht unterdrücken. Hunger hat er auch. Die Großmutter ist zu langsam, zu lässig – ach, sie hat einfach Angst, sich etwas vom »bösen Anhauch« der Seuche zu holen, und die Base Wellinger kommt nur einmal am Tag und bringt einen starkriechenden Kräuterdampf, den er einatmen muß, obwohl er kaum sitzen kann, und stützen mag die ihn auch nicht.
Er ißt Suppen, die man ihm kocht, aber die er nicht mag, weil das Schlucken schwierig ist, – alles ist verschwollen, alles eine Mühsal. Er ist elend allein, und nicht einmal den kleinen Heinrich hört er mehr, die Ohren sind ihm wie zu.
Sie wechseln manchmal sogar sein Hemd, wenn’s verklebt ist, aber das Losreißen tut auch weh, und das Bettzeug machen sie auch hie und da neu mit frischen Tüchern – er zählt keine Tage. Er friert auch, wenn das Fieber nachläßt, vor Schwäche. Man hält das Fenster offen, damit der Stank hinausziehe, aber der Herbstwind wird so kühl, daß ihm die Hände wehtun, wenn er sie nicht unter die Decke steckt.
Die Vaterschwestern heulen und jammern, eine ist jetzt auch krank geworden, und die Pflegfrau, die kommen soll, bleibt aus. Es seien viele gestorben. Da fürchtet die sich, sagt die Großmutter, wenn sie geschwinde hereinsieht.
Er ist so schwach, daß er fast immer träumt: Gestalten wie weiße Nonnen steigen an der Stubendecke herauf und hinunter. Er krampft sich ins Leintuch und drückt die wunden Lider zu.
Heinrich bittet um die Löhnung; er muß auf einen Teil verzichten, auch ein paar silberne Becher und ein Wildpret zurücklassen, ehe er freikommt und die Frau mitnehmen kann. Sie ist wieder schwanger, das gibt den Anlaß, heimzufahren. Auf einem Fouragewagen rattern sie durchs Land.
Katharina weint, sie hat Angst um die Kinder, Angst auch um das Ungeborene. Es ist soviel Angst in der Welt, und sie kann nachts nicht schlafen. Der Planwagen rasselt und rattert, manchmal hält er. Es gibt hier und dort etwas zu löffeln.
Heinrich schimpft, er gönnt dem Bauern, der auf dem Bock sitzt, kaum noch Ruhe. Der läßt sich mit Beutesilber zahlen, das aus einer Truhe stammt – Katharina will nicht wissen, woher und wie sie es genommen haben, Heinrich hat’s in den Hosensack gestopft und holt, wenn’s nottut, zwei oder drei Münzen heraus.
Es geht ein paar Wochen so, südwärts am Rhein hinauf, streckenweise fahren ein paar halbverhungerte Weiber mit; ein Kind, verwildert, verlaust, läßt er widerwillig unters Stroh kriechen. Drüben am Himmel brennen die Dörfer.
Sie sind noch nicht weit genug vom Krieg, und wenn ein Trupp Musketiere daherkommt, müssen sie ausweichen und warten.
Heinrich trägt den Flachhut mit den Federn, der ihn als »Fendrich« ausweist, er hat einen Adelsbrief vom Alten vorgezeigt, dem er ihn verdankt; den Gaul hat er verkauft, die Frau kann nicht mehr reiten, ein zweites Pferd hat er auch nicht.
Das Land ist eben und voll Nebel, »der Herbst wächst herein«, sagt Katharina, »er schwillt auf und deckt alles zu«, keine Sonne mehr, kaum Licht, wie sie so fahren. Sie sagt wieder: »Wenn der Heinerle nicht mehr lebte …«, dann leiser: »… oder mein Hannes!«
Er tröstet sie, der sei dürr und zäh und habe lebendige Augen. Die Ahne werde schon achtgeben.
Sie übernachten im Heu bei einem Bauern, der auch das Pferd einstellt. Heinrich hält sie im Arm. Sie drückt das Gesicht gegen den Koller, den er jetzt aufknöpft, damit sie näher ist. »Noch zwei Wochen«, sagt er. Katharina sitzt gekrümmt im Stroh und stöhnt. Sie hat Schmerzen, er fragt, was sei – da sieht er, daß sie blutet. Die Bäuerin nimmt sie auf, zögernd, die fremden Weiber mit dem Kind fahren weiter, Heinrich sitzt verzweifelt neben ihr; das Würmlein, das sie von sich gleiten sieht, ist tot.
Dann, bald danach, müssen sie weiter. Es ist in den Orten seltsam still. Kein Truppenzug trampelt und trappelt über die Straßen, hier brennt kein Haus, niemand schreit Befehle, kein Bauer ist auf dem Acker, im Dorf sei – die Pest, heißt es. Das ist eine andere Angst als seither, da sie es trommeln hörten, schreien und schießen, eine lautlose Angst, schleichend und schwarz, sie sind mitten in einem Übergreifenden, Übermächtigen; es gibt nur Flucht, und wer weiß, was mitflieht? Im Wams, im Mantel, im Schuh, im Staub?
Überall, in und außer den Fliehenden, kann es nisten und knospen und wuchern …
Katharina fiebert. Sie nimmt nichts wahr, es ist ihr nichts »gewärtig« – das ist das Wort, das Heinrich immer wieder flüstert in seinem verschollenen Schwäbisch.
Einmal am Abend, nach einem kalten Tag, zieht der Bauer die Plane ab, es ist sternklar – sternklar und kalt –, er will das Stroh aufschütten, die Plane auf einen langen Zaun zum Trocknen aushängen, und plötzlich faucht es bös aus dem Horizont; Dunstberge brauen sich ineinander, die Sterne verschwimmen wie in trüben Wellen, es wird dunkler, und das Klare löscht aus. Es donnert. Und ist doch Herbst und ein Sternenhimmel war da – es donnert! Katharina sitzt im Stroh, das graue Tuch um den Kopf, der Mann daneben. Seit dem verpesteten Dorf haben sie keine Mitfahrer mehr aufgenommen.
Es kracht, berstend knallen Wolkenzüge ineinander, wie Meerwogen und Weltungeheuer ringt und schlingt sich das Gestaltlose über ihren Köpfen, der Wagen steht, die Gäule steigen und wiehern. Heinrich springt ab und faßt einen Zügel, der Bauer den zweiten. Es klatscht jetzt wild um sie her, spritzt und strömt, die Pferde suchen den Waldrand, wo es matter rieselt; Katharina ist naß und friert.
Sie fahren weiter, schlafen erschöpft irgendwo im Heu, fahren noch eine Woche: Im knackenden bläulichen Frost liegt Weil der Stadt, ein Häuflein Dächer um den Kirchturm geduckt, Nest und Wärme auch jetzt, wo sie geschlagen heimkommen, sorgenvoll, ohne Nachricht, halbkrank und – der Soldat ohne Beute.
Heinrich schickt einen Buben voraus, den er am Weg findet. Da steht die Ahne unter dem Tor an der Staffel, die Buben stehen da, Heiner und Johannes, und die Frauen – Johannes ganz mager, hohläugig, blaß, das Haar strähnig in der hohen schmalen Stirn. Er verbirgt eine Hand hinter dem Rücken.
Der kleinere schreit jubelnd auf: »Hannes, Ahne! Gukket! D’Mueder! D’r Vadder! Älle boide!«
Johannes schaut nur mit den dunklen Augen und sagt nichts. Er sieht die abgerissene erschöpfte Frau, den verwilderten Landsknecht mit der bunten Uniform, fremd und großspurig. Es riecht nach Bier aus dem blonden Bart, den er an die Stirn des Buben drückt.
Er sei »Fendrich« geworden, sagt er gleich, da er den gierigen Blick der alten Frau merkt, der nach dem Beutesack zielt. Er tritt in die Stube, verlangt zu trinken und schiebt der Frau den Becher hin, die gebeugt, schmal, zitternd das dunkle krause Haar aus der Stirn schiebt.
»Hannesle«, sagt sie und zieht den Buben zu sich heran; Heiner drängt sich davor, drückt den Größeren weg und bohrt seinen dicken blonden Kopf in den Schoß der Mutter.
Die Ahne hat einen Zuber gerichtet und verlangt, die Buben sollten in der Küche gewaschen werden, solang Heinrich, der Landsknecht, mit dem Bauern und den Pferden zu tun hat.
Während Katharina ihre zwei Kinder abreibt, stockt sie auf einmal. »Hannesle, was ist mit deiner Hand da?«
Es sei nichts weiter, brummelt der Fünfjährige, die Hand sei so seit den Pocken und die andere ein bißle besser, aber weh tue sie auch, nicht arg, ein bißle … Katharina nimmt die hager-gekrümmte kleine Hand in ihre und streichelt sie; sie merkt auch, daß die Augen des Kindes rote Lider haben, geschwollene Ränder, und daß er blinzelt und das Badewasser nicht verträgt, wenn’s hineinspritzt. »Die Pocken?« fragt sie, »ich hab’s gehört! Wie war denn das?«
Heiner mischt sich krähend in ihre Rede, er sei auch krank gewesen, ärger als der Hannes, und er habe manchmal das Schäumen und Krümmen, das sei ganz »wehlich«.
Katharina stöhnt. Was mag das werden mit den Kindern? Sie hebt den Kleinen vorsichtig aus dem Zuber, damit er nicht vom Wasser den Krampf kriegen soll, und trocknet ihn mit dem Leinentuch ab.
Johannes kann das selber. Mit dem dürren bräunlichen Körperchen, an dem sie die Rippen sieht, steht er vor dem Herdfeuer und reibt sich tapfer ab – sie merkt, wie’s ihn anstrengt, wie müde er ist, wie geschwächt. Es war nicht recht, daß ich mit dem Heinrich gezogen bin, ich hätte bei den Kindern bleiben sollen, und auch das Dritte wär’ vielleicht jetzt in der Wiege, wenn ich nicht da herumgezogen wär’ … Aber er hat’s wollen und wär ohne mich gar nicht mehr heimgekommen, denkt sie.
Sie haben sich in Leonberg angekauft, ein Wirtshaus erworben, schwer gearbeitet. Katharina hat gemeint, es bleibe so, während weit draußen, weiter als sie denken will, die Knechte aufeinanderschlagen, die Waibel und Fendriche und Pikeure und was weiß man noch – während die fetten Markedenterinnen kreischen und lachen und sich in die Ecken drücken lassen und schreien … »Nichts für uns, Heinrich, bleib da, bei uns, bei mir …«
Vier Jahre später gebiert sie den kleinen Sebald, nach dem Großvater genannt, und zwei Jahre danach Friedrich, der klein stirbt.
Johannes ist in der Schule, der Lehrer bestellt den Vater zu sich, es sei etwas Besonderes mit dem Kerle, der sei heller als andere, habe eigene Ideen, sei schon jetzt ein Gelehrter, müsse geistlich werden …
»Geistlich?« brummt Heinrich; es fällt ihm ein, daß das Kind katholisch getauft und lutherisch erzogen ist – »geistlich?« Der solle das Wirtshaus erben, Bier holen und Holz tragen und Pferde füttern. Freilich, zu schwerer Arbeit tauge er ohnehin nicht, sei zart, schmächtig, schlage der Mutter nach; freilich, manchmal schon blitzgescheit, möcht’ sein, er brächt’s einmal zum Officierer, wie sein Vater, möcht’ sein, zu so einem Schreiber, neben dem Feldhauptmann, möcht’ sein, zu so einem Basteibauer und Pionier, möcht’ sein.
Er träumt, ist schon in Gedanken wieder im Feldlager, er verschwindet in einer grauen Nacht …
Katharina wartet wieder, sie wird gezankt und geschunden. »Wenn du den Mann recht hieltest, wär’ er schon dageblieben …«
Abends weint sie oft. Es ist, als wollten ihr die Augen ausrinnen, sie sitzt und starrt durch den Schleier, den irisierenden, den Nebel der Tränen.
Es ist ein später Sommer diesmal, ein paar kalte Nächte haben schon den Herbst hergerufen, denkt sie – es ist spät, spät …
Da hat ihr die Nachbarsfrau ein paar Rosen hereingestellt, dicke flache Rosen aus dem Bauerngarten; sie sieht sie an, und das Kerzenlicht scheint durch, da sind sie bläulich und purpurn, und ein grünlicher Schimmer ist in der Tiefe, wo sie sich auffalten um das Herz, und wulstig-rosa kreisen die schwachen zarten Blätter darum wie Fingerchen von einem Säugling, wenn er um den Daumen der Mutter herumgreift.
Rosen – denkt sie, das ist beinah’ nichts mehr für eine wie mich …
1584 wird eine winzige Margarethe geboren, aber es ist ein kräftiges Kind, und Mädchen, sagt man ihr, sind leichter durchzubringen als Buben.
Fast ist sie froh, daß der Heinrich nur noch selten da ist, sie weiß sich vor den Schwangerschaften nicht zu schützen, es ist ja ihr Mann, sein gutes Recht, längst nicht mehr Zärtlichkeit und Verlangen in ihr selber.
Er kommt noch einmal unerwartet heim und geht wieder. Drei Jahre nach dem Mädelchen kommt ein kleiner Christoph zur Welt – rundköpfig und stur und eigensinnig, aber die Geburt war leicht. Wenigstens hat keins der Jüngeren mehr die Fallsucht wie der Heinerle. Vielleicht hat ihn auch der Mann einmal geschlagen, als er unruhig war, der Vater getrunken hatte und schlafen wollte.
Den Bernhard, zwei Jahre danach, ein zartes Büblein, behält sie nicht lang und hat sich mit ihm arg quälen müssen.
Von ihrem Mann weiß sie nichts seit ein paar Monaten.
Da klopft es am Laden, ruft, sie kennt die Stimme kaum. »Heinrich!« schreit sie erschreckt, weil es so gequetscht und seltsam klingt. Sie reißt die Tür auf und sieht ihn hereintraben, einen dicken Schal um den Mund, der Kinn und Nase deckt; sie erkennt auch, daß er prächtige geschlitzte Hosen anhat, breit gefaltet, und ein Schwert an der Seite; draußen sei das Pferd, murmelt er, er sei »Leutenant« geworden. Den federwallenden Rundhut wirft er hin, erst dann fällt er breit auf die Fensterbank, zieht Katharina am Arm her, reißt den Schal ab, zwingt sie herum: »Die Augen auf, Frau!« und weist ihr grinsend ein rotes zerstörtes Gesicht: der Mund vernarbt, die Nase zerdrückt, zerrissen, die Augen – sie sieht es gleich und ist glücklich –, die hellblauen kleinen Augen sind noch unverstellt, aber der Bart ist schief aus der schrundigen Haut gesprossen, wie Pilzgeflecht.
»Heinrich!« Sie versucht, nicht zurückzufahren, stemmt sich gegen den Tisch, als er sie herzieht, und streicht ihm übers Haar, greift in die welligen Locken, die noch da sind.
Sie hält sich daran, senkt den Kopf gegen seine Schulter und drückt das Gesicht dagegen – so sieht sie nichts mehr.
»Was war das? Heinrich?«
»Du kennst doch Haubitzen und Feldschlangen, Kätterle«, sagt er weicher und führt sie zum Stuhl. »So ein Vieh ist krepiert, das Rohr hat’s verrissen, mir ins Gesicht die ganze Ladung und die Eisensplitter. Nicht einmal der Feind, die eigene Schlange war’s!«