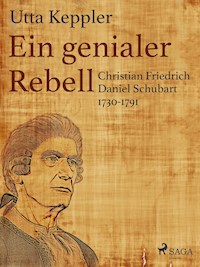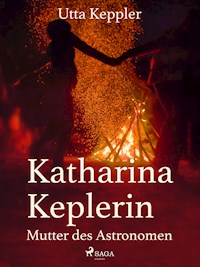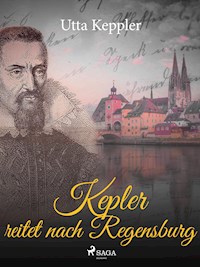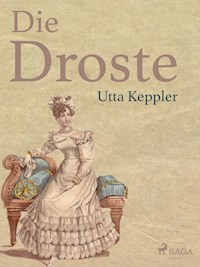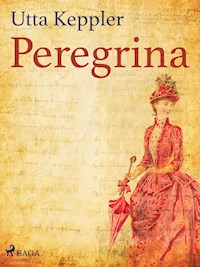Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Malerin Ludovike Simanowiz wuchs in Ludwigsburg gemeinsam mit Friedrich Schiller und dessen Schwestern auf. Insbesondere mit Christophine verband sie immer eine gute Freundschaft. Obwohl es nicht die gesellschaftliche Norm war, schlug die junge Frau eine künstlerische Laufbahn ein. Durch ihre Heirat musste Ludovike zwischen der Kunst und ihrer Ehe balancieren und einige schwierige Zeiten meistern.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Der verwehte Brief
SAGA Egmont
Der verwehte Brief
Copyright © 1974, 2018 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788726030884
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
I
Straßburg! In der ersten Morgendämmerung hielt die Postkutsche aus Paris. Man gähnte, streckte sich, fragte verwirrt wo und was? Der alte Mann neben Ludovike zog die prallsitzende Weste stramm, griff über einen schmalen Jungen hinüber und rüttelte am Fenster. Schneeluft fuhr scharf herein und stieß in die verschlafenen Gesichter. Eine blasse Frau, Ludovike gegenüber, faßte instinktiv nach ihrem Kind, das sich wie ein Kätzchen auf ihrem Schoß zusammengerollt hatte. In der Enge waren seine Beine mit den langen Spitzenhosen einem schwarzbärtigen Herrn auf die Knie gerutscht, der sie ärgerlich zurückschob.
Ludovike nahm sich zusammen: Unwirklich war das alles, die verzerrten, dämmerdummen Mienen, gedrängte Gestalten, verbrauchte Luft, Geschrei von der Straße. Sie hob das Kinn und sog begierig den Winterhauch ein, der sie streifte.
Da wurde die Tür aufgerissen. Kutscher und Pferdeknechte sprangen ab und traten zurück, die Reisenden stiegen aus. Ein paar Männer beruhigten die Frauen, jetzt sei es nicht mehr gefährlich, sie hätten doch alle ihre Pässe und Papiere, die sie sich, mühsam genug, in Paris verschafft, und die Ausweise, in denen stehe, daß man nicht – weiß Gott, noch niemals – dem verwerflichen lästerlichen Louis Capet angehangen habe. Für die Geflüchteten war er freilich noch immer der König, Ludwig der Sechzehnte von Frankreich, der nun gefangen auf sein Ende wartete. Wenn sie erst in Süddeutschland unterkamen, waren sie gerettet, ob willkommen und auf die Dauer geliebt, mußte sich erweisen. Sie waren heraus, an Land gezogen, entronnen: Unzählige Verdächtige lagen noch in den Kellern der Bastille.
Ludovike zeigte den Uniformierten ihre Papiere vor: Ludovike Simanowiz, geborene Reichenbach, Gattin eines wirtenbergischen Leutnants, dessen Verbleib ungewiß, auf der Heimreise vom Studium in Paris, Malerin, Porträtistin, dort auch im Kreise des Brigadegenerals Bonaparte und des Finanzministers Necker bekannt.
»Und wo in Paris gewesen?«
Sie murmelte etwas, und man gab sich mit dem halbverstandenen Bescheid zufrieden, sie habe bei einer Freundin aus der Heimat gewohnt; das war genug, denn Rosa Helene Baletti, Sängerin aus Ludwigsburg, hatte den spanischen Grafen Lacoste geheiratet und ein kleines Pariser Palais bewohnt.
Niemand hielt sie auf. Der Bärtige in den gestreiften Hosen war auf einmal fort. Er hatte sich um irgendeine Ecke, in eine Tür geschoben, und Ludovike fand beim Wiedereinsteigen auf seinem Sitz eine Uhr, die er wohl in der Eile vergessen hatte. Man rief ihm besser nicht nach; sie reichte das Ding mit dem eingravierten Krönchen auf den Kutschbock hinauf, ehe die Pferde wieder anzogen.
Weiter, der Heimat zu! Breite Hoftore in den Dörfern, dazwischen die Täler weiß von Schnee, flache Hügel, bräunlich vereistes Wasser; dann, wie Inseln aufgetaucht aus dem Nebel, strähnige Buschgerippe.
Ludovike schlief ein. Erschöpft und gelöst schaukelte sie in der schlecht gefederten Kutsche über Mulden und Schneewehen. Langsam verwischte sich die Gegenwart. Da tauchte es herauf, halb Traum, halb Erinnerung: der Hof hinter dem Lorcher Haus, schattig, von blitzenden Sonnenflecken gesprenkelt, der bittere Holundergeruch; und vom Brunnenrand spritzt bei jedem Windhauch ein Sprühregen über die Steinplatten, der schnell verdunstet. Die Kinder kauern auf dem Rasenstreifen, die Conzischen und Schillers Christophine, sie selber im Haustor; und alle starren zum Fritz hinüber, der mit den dünnen weißbestrumpften Beinen auf einem Schemel steht. Sie sieht die hellgrauen Augen blinzeln und hört das heisere Stimmchen: »Liebe Gemeinde im Herrn!« Die Hände breiten sich aus.
»Herr Pfarr!« ruft Christophine dazwischen, »Herr Pfarr, Euer Ehren haben den Talar vergessen!« Christophine ist schon acht Jahre alt, zwei Jahre über ihr und dem Fritz, und fühlt sich erhaben.
Der kleine Prediger schweigt verwirrt, das rote Zöpfchen bebt, er will schon heruntersteigen vom Kanzelpodest, als sie selber aufspringt und ins Haus läuft. »Ich hol ihm einen!« Die Küchentür steht offen, Frau Schiller dreht sich am Herd um. »Frau Hauptmännin, Ihr habet doch gewiß was Schwarzes, das ein bißle feierlich aussieht?«
Frau Elisabeth hebt den Deckel von einem Topf. »Was Schwarzes? Was treibet ihr denn schon wieder?«
»Ha, der Fritz predigt!« Kurz darauf läuft sie mit einer seidenen Sonntagsschürze wieder auf den Hof. Ludovike schrak bei ihrem eigenen Lachen zusammen: die Schillerkinder, Getuschel und Gehüpfe und Gekicher, der Duft vom Holunderbaum, die Stimme der Frau Elisabeth… hat’s das wirklich gegeben? Der »liebe Fritz« ist inzwischen vierunddreißig, Professor in Jena, liest Geschichte, ein berühmter Mann, ein großer Dichter… Man möchte ihn fragen, ganz schnell, gleich jetzt, was er heute denkt über den französischen Aufbruch, den er zuerst begrüßt hatte.
Vor das gute Bild unter dem Holunder schiebt sich ein anderes: ein schauerlicher Baum ragt gegen den Dunsthimmel von Paris, gegen die Mauern – das Gerüst. Und der Troß schiebender, keuchender Männer und Weiber taumelt darauf zu, die Karren rattern; es klingt anders als das friedliche Rumpeln und Mahlen hier im elsässischen Schmelzschnee. Durch den Lärm der Masse dringt ein unmenschliches Ächzen; gebunden, gekrümmt hängen die Verurteilten in den Stricken und holpern dem Schafott zu…
Ludovike schrie, jemand griff nach ihrem Arm.
»Madame, Sie träumt immer noch davon – es liegt doch hinter uns!«
Sie riß die blauen, kindlichen Augen auf und erkannte im hellen Winterlicht, das die schütternde Scheibe hereinließ, die Reisenden um sich, den Alten, der sie angesprochen hatte, braune Pferderücken, ihr Auf und Ab im Trott, und den grauen Umriß des Kutschers. Sie bedankte sich verlegen.
Der Dicke neben ihr sah sie lächelnd an. »Wir sind schon bald am Ziel, Madame. Dort ist doch wohl jemand, der Sie erwartet?«
»Mein Mann war im September bei Valmy.«
»Dann ist er ja heraus, vielleicht ist er schon da, wenn Sie heimkommen.«
Ludovike lächelte beklommen.
Dann stand sie mit steifen Gliedern, verwirrt und frierend, in Ludwigsburg vor dem Wagen. Sie schickte einen der Burschen, die immer vor den Poststationen warteten, zum Elternhaus, und einen zweiten mit dem Gepäck dem ersten nach. Sie selbst wartete unschlüssig und sah dem wackelnden Zweiradkarren nach, auf dem jetzt ihre Tasche schwankte. Dann ging sie mit entschlossenen Schritten durch den Schneematsch heim. Der Vater mochte Botschaft haben, Franz konnte schon bei ihm sein – aber der lähmende Druck auf ihrer Seele wurde nicht leichter. Sie ahnte, daß ihr Mann nicht da war.
Sie sah den Alten in seiner Hauptmannsuniform am Tor stehen, die Hand über den Augen, durch Sonne und Schnee geblendet. »O Kind, Mädle, bist da?!« Ludovike lag ihm im Arm, roch den abgestandenen Tabaksduft, spürte den zitternden Mund auf ihrer Wange; dann schob sie den Vater vor sich her in die Stube. Mit dem ersten Blick erfaßte sie den schiefgeknöpften Rock, die Flecken, die unordentliche Frisur, und weiter das ungeputzte Zimmer, das Suppentöpfchen in der Ofenmulde. Die beiden sprachen kaum; der Vater fing übereilt von der Mutter an, von ihrem Tod und seinem Alleinsein. Von einem Brief war keine Rede. Schließlich fragte sie. Reichenbach senkte den Kopf, dünnsträhniges graues Haar fiel ihm in die Stirn. Er habe nach Stuttgart geschickt, wo Franzens Regimentskameraden wohnten, habe auch die eigenen alten Freunde gefragt, von denen der und jener ja noch in der Etappe mitmachte, die Schillerschen auch, und auch Christophine, die manchmal nach ihm schaue. Doch niemand wisse etwas.
Ludovike besuchte in den ersten Tagen nur diese Freundin, aber es kamen andere, die Voßler, die Conzin, und alle fragten nach ihrem Mann, dem blassen, freundlichen Franz, dem guten Simanowiz.
Ludovike gab gequält Antwort. Sie empfand das Fremde dieser kaum Versehrten Welt – sie hatten im Krieg liebe Menschen verloren, in den Kämpfen oder kleinen Gefechten gegen die vorrückende Revolutionsarmee, sie hatten Einquartierungen überstanden und Hunger gelitten; aber sie hatten nicht das tägliche unentrinnbare Gemetzel um sich her erlebt, das sie selbst wie einen Alptraum durchwatete, dieses Entsetzliche, das sich dem Mitlebenden darbot als ein zerfleischtes, fleischlüsternes Fratzengesicht.
Ludovike ging bedrückt herum, putzte, räumte auf, wusch und flickte ohne Lust und nur dem Vater zuliebe. Endlich nahm sie sich – zum wievielten Mal! – vor, zu malen: exakt, gegenständlich und phantasielos, eine Fleißarbeit, eine Übung – wenigstens das müßte ihr gelingen, damit es die Träume verstellte.
Der Vater Reichenbach hatte ihr Atelier zu seinem Rauchzimmer gemacht, die Mappen waren an die Wand gelehnt, die Stifte und Tuben in ein Kistchen verpackt, nur ein alter Ohrenstuhl stand noch da. Ludovike war froh über die Unordnung, die sie mit ihren raschen Händen zurechtbringen konnte. Reichenbach ließ sie gewähren, er fügte sich sogar gern, jetzt, wo sie den Takt seines ereignisarmen Lebens bestimmte.
II
Der Februar dämmerte, die Tage wurden nie ganz hell, ein kraftloser Wind schlich um die Ecken, manchmal flirrte dünner Schnee aus den verblasenen Wolken. Christophine Schiller kam oft und erzählte Ludovike von ihrem großen Bruder. Er sei viel krank, sagte sie bekümmert, er huste und brauche Medizinen, aber er schreibe, lese seine Kollegs, zu denen freilich nicht mehr so viele Hörer kämen wie anfangs – ach, er lebe nur seinen Schriften.
Ludovike tastete über das blaue Tuch ihres Kleides, als male sie.
»Du solltest ihm schreiben, daß ich da bin.«
»Das hab’ ich längst getan.«
Die beiden saßen noch eine Weile stumm vor dem Ofen, Christophine zeichnete, und Ludovike verbesserte mit sicheren Strichen, lobte und erklärte. Reichenbach machte einen »Schneegang«, wie er seine Wege vor die Stadt nannte.