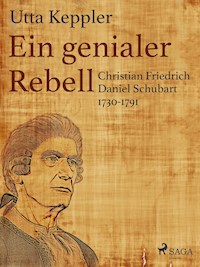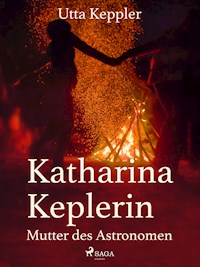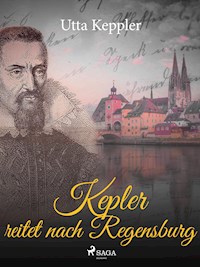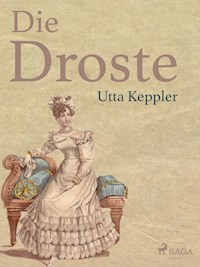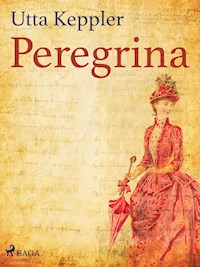
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Peregrina, so nennt Eduard Mörike die junge Frau, die er 1823 in Ludwigsburg trifft und in seinen Gedichten verewigt. Das junge Mädchen, welches bereits mit 15 Jahren beginnt durch die Welt zu reisen, ist insbesondere für seine Schönheit bekannt. Die faszinierende junge Frau lässt den Dichter sein ganzes Leben lang nicht los. Doch was ist es, das die Peregrina so besonders macht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Peregrina
SAGA Egmont
Peregrina
Copyright © 1982, 2017 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711730515
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Vorspiel
Vor der Lampe tanzt ein brauner Nachtfalter. Der Student – er ist es noch gar nicht, will’s erst werden – sieht ihm mit aufgestütztem Kopf zu, seinen zackenden taumelnden Kreisen und Zirkeln, die er, blind geführt wie in Trance, um das Licht her aufführt; sie werden enger, kleiner im Umriß, näher der Wärme, und der dicke behaarte Körper stößt sich mit einem schwachen Anprall an der Lampenglocke, schwingt zurück, torkelt ohne Richtung, sucht den weiteren Bogen und dann wieder die Flammennähe.
Der Junge sieht ihn als Schattenbild, abgehoben vom Hellen. Der flaumige Leib ist wie eine kleine Walze, halb verdeckt und verwischt wird seine Kontur von den flirrenden Flügeln, die nichts von Schwingen haben. Der junge Mann rückt an der Lampe und wedelt mit der Hand.
Aber gleich wieder ist der Schmetterling da, wo er’s wie eine Sonne spürt, getrieben und hilflos. Der tödliche Zirkel wird bald unsicher, die Flügelränder sind zackige Fetzen, der Falter fällt auf den Tisch. Zuckend zittern die braunfleckigen Stummel, – wär’ er tot! Aber er regt sich, er versucht Schritte mit den versengten Füßchen, er taumelt zur Seite; er kreist in einem irren Todestanz, dann bleibt er liegen.
Der Mann am Tisch nimmt ihn auf und trägt ihn in den Garten. Dort vergräbt er ihn im Boden. An diesem Abend liest er nicht weiter.
1. Kapitel
Die Wasserfälle
In Schaffhausen waren die Häuser eng nebeneinander gebaut, geschachtelt und verfilzt, wenn man das von Häusern sagen könnte; manchmal paßte dieser Ausdruck sogar, wo Moos und Flechtwerk der übergreifenden Äste sich ineinander verfingen, unter denen die braunen Dächer spitz gegeneinander giebelten. Die kleinen gewölbten Scheiben boten sich gegenseitig ihre Geranien- und Petunienstöcke an, man sah herüber und hinüber, sobald man die Vorhänge zurückzog.
Man sah, ob die sauber gewaschen und gestärkt waren oder etwa staubig vergilbt; man sah die umgestülpten Milchsatten und Krüge auf den Fensterbrettern und merkte, wie oft sie herausgestellt wurden, und man nahm im Herbst die Zwiebeln wichtig, zum Trocknen auf Schnüre gezogen, oder die Dörrbohnen, ordentlich aufgereiht, solang es nicht regnete oder fror.
Jeder kannte den anderen, man hielt die Augen offen und verzeichnete gewissenhaft, ob die Frau vom Schneider in der Kirche gewesen war oder ob die vom Bäcker aussah, als wäre sie schwanger.
Hinter den Häusern gab es Winkel mit Hasengittern, mitunter Ziegenverschläge, und ein paar Reichere hatten weiter draußen ihre breiten Höfe mit Kuhställen und Schweinekoben.
Noch weiter, unter dem zitternden Luftschwall, am Wald zwischen den Baumschatten und -lichtem, brauste es dumpf; über der Flußbreite schwirrten verstörte Vögel, zwischen denen regenbogenfarbig die sprühenden Wirbel sich in Wolken hinaufwarfen über dem Fall, mächtig und unwirklich herunterbrechend, wie Donner und Gebrüll und eine Götterstimme, aus der der Tod schrie.
Die Bürger hörten sie nicht, wenn sie sonntags mit Stöcken und roten Sonnenschirmchen, umwedelt von ihren Zwergspitzen, mit Schuten und faltigen Röcken die Frauen, mit taillierten Anzügen die Männer, Zylinder hebend, bartzwirbelnd, patriarchalisch und schwitzend heranspazierten. – Auch Kinder waren dabei, die Buben liefen voraus, die Mädchen in langen Röcken gingen an den Händen der Mütter, straff gescheitelt und stramm gezöpft.
Da wandelte der Metzgermeister Meyer, ein würdiger Mann mit den Abzeichen der Bürgerwehr, deren Adjutant er war, und seine schnaufende Ehefrau mit den gedrehten steifen Locken neben den roten Backen. Sieben Kinder hatte sie, und vier davon liefen und zottelten da am Wasserfall vorbei. Eigentlich waren es elf! gewesen, vier waren klein gestorben, wie man das als unvermeidlich hinnahm.
»Die Helene macht sich kräftig«, sagte der Papa zufrieden, »mit ihren zehn Jahren.«
Später, mehr als ein Jahrzehnt danach, 1802, sah er das Mädchen grimmig an, und täglich grimmiger und zorniger, und die dicke Mutter schlich seufzend herum.
Man beriet, ob man die »Husch« nicht wegtun solle, irgendwohin aus den Augen und weitab von den Mäulern der Verwandten und Nachbarinnen, ehe es soweit sei; aber dann ließ man sie doch da und versteckte die Hochschwangere in der Dachstube, und die Metzgersfrau – (»und ich komm’ aus dem ehrbarsten Geschlecht, und die Ermatinger waren schon um 1600 achtbar«) – holte sogar die Wehmutter, weil sie sich’s allein nicht zutraute, der Stöhnenden das rote schmächtige Kind aus dem Leib zu holen, das die Hebamme dann zutage brachte: Es war ein Mädchen, und als Vater gab Helene einen wandernden Weißgerbergesellen aus Dresden an, mit Namen Jakobus Fried.
Man wußte nicht recht, wie und wo sie gerade an den geraten sei, und gemeldet habe er sich auch nie mehr, klagte die Alte.
Die junge Frau nährte das Kind, jammerte viel, schob es in die Wiege, wenn es weinte, und nahm es selten genug liebevoll an sich; und da man es doch taufen mußte – der Pfarrer drängte darauf –, hieß man es Anna Maria nach der Großmutter, im Kirchenbuch als ein Winterkind eingetragen, am 27. Dezember 1802, unter dem Zeichen des Schützen und des Steinbocks, was nur die Großmutter im Gespräch erwähnte und der Pfarrer nicht, denn die Alte hatte von der flammenden spontanen Natur dieses Feuerzeichens Schütze gehört, die man dem pfeilschwingenden Sagittarius und seinen Zugeborenen nachredete, denn sie hatte früher bei einem gelehrten Mann gedient, der auch Astrologie betrieb.
In den spitzgiebeligen Häusern klatschten und flüsterten die Weiber. Man nahm Helene nicht mehr zur Waschhilfe oder zur Gartenarbeit, man ließ sie nicht mehr zum Tanz in die angesehenen Wirtshäuser, und wenn sich andere als die Zugelaufenen um sie gekümmert hätten, das wäre eine Gnade und ein Wunder und allenfalls ein schnell unterlassenes Probieren gewesen: Die Helene war nun einmal in den Morast geraten und mit dem schmierigen schwarzbraunen Schlamm gezeichnet, der ihr immerfort anhing, nie mehr abzuwaschen …
Drei Jahre alt war das Kind, dunkel und mit großen schräg geschnittenen Augen, lebhaft und unruhig, als die Mutter wieder niederkam, und zwei Jahre später wurde noch ein Geschwisterchen geboren, und jetzt galt die »Husch« als ganz Verlorene, man zwang sie ins Arbeitshaus, eine Zeitlang sogar ins Frauengefängnis, und ließ die Kinder der Großmutter, und als die starb und die kleine Maria nach der Mutter fragte, hieß es, von der könne man nicht reden, das sei eine Böse … Der Metzgermeister trat aus der Bürgerwehr aus, »sein Stolz sei gebrochen«, sagten die Leute und lächelten ein wenig hämisch dabei.
Seine Frau traute sich kaum mehr auf die Straße, sie ließ die Magd – die war alt und hörte schlecht – das Nötige besorgen; der Laden verkam, die Kunden kauften beim zweiten Fleischer, manche ließen anschreiben und vergaßen zu bezahlen.
Die Geschwister – im Dienst, in der Lehre, in der Schulklasse – hörten häßliche Schimpfereien und kamen heulend heim.
Das Mädchen mit den drei Bastarden blieb in der Fremde, im Spinnhaus, im Gefängnis wegen Herumtreiberei, und ihr Kind, die Maria, inzwischen vierzehnjährig, schlich verstört in den Nachbardörfern herum.
Sie schluckte den Haß der Mutter, kränkelte an den verbitterten Reden, die sie in kurzen Besuchszeiten im Gefängnis anhörte, haßte bald selbst alles Geordnete, Glänzende, Sichere, und saugte verbissen und wild die verlogenen Schönreden in sich auf, die man »Mitleid« nannte und mit denen ihre Mutter beleidigt und beschmutzt wurde, als sollte sie die abtun und verleugnen, aus der sie entstanden und herausgeboren war.
Sie lernte, daß man die »regelrechte« Macht hinnehmen müsse und nicht ändern könne, die sie, wie die Mutter, ausschloß; sie lernte verachten und täuschen, hochmütig und unsicher zugleich, und sehnte sich danach, etwas Besonderes zu sein, das außer der Regel stand und Achtung erzwang bei denen, die sie jetzt wegstießen.
Sie war, was die Burschen »schön« hießen, schlank, hochbusig, dunkelgelockt. Ihre Augen seien wie Kohlen, sagte man, und sie wische, geschmeidig und huschend, wie ein Nachtmahr an den Waldrändern vorbei.
Dunkel und volltönig war ihre Stimme, sie hatte eine verzweifelte Sicherheit, von deren Ursprung niemand etwas ahnte, weil sie sich außerhalb fühlte und gefährdet und die Ungeborgenheit sie kühn machte wie jemand, der nichts zu verlieren hat.
Wenn einer der Männer aus den Wirtschaften ihre starke Schönheit lobte, hieß es, sie sei dämonisch, eine Hexerische, und habe dunkle Kräfte. Wenn sie mitleidig und aus Spaß an ihrer Wirkung einem kranken Kind streichelnd Gesundheit ansagte, schrie die Mutter von Zauberei.
Der Fluß rauschte durch die Morgendämmerung, Maria spürte seinen Geruch. Weit, schwebend wie die Luft, die darüberstand, atmend wie ein lebendes Wesen – ach, lebendig war er, aber das Unbegrenzte hatte doch seinen Rand, sein Ufer, an dem es leckte und im Frühjahr bockig stoßend sich brach, es war eingefaßt und an sein gegrabenes Bett gefesselt.
Morgens war der Fluß am herrlichsten, als dämmere er drüben am anderen Rand kaum mehr irdisch in die Büsche und die schleifend hingezogenen Sträucher hinein und schwelle in seiner Mitte zusammen mit dem Spiegelbild des Wolkenhimmels, der in Schlitzen schon Blau anzeigte und streifiges rosiges Licht, im Strom als Funken tanzend.
Himmelsspiegel und Fluß verschwisterten sich, redeten mit schwachen zwitschernden Lauten gegeneinander, mit dem rieselnden Tau von oben und dem aufspritzenden Gesprüh aus dem Wasser; und als die Lichtbündel durchbrachen, in breiten Strahlenbahnen, fing alles an zu funkeln, Luft und Wasser, und wer es sah, hätte singen müssen, schreien vor Freude, daß es dieses Spiel gab: Ineinanderstrahlen und sich auflösen und sich aufgeben und empfangen …
Schmalere Wasserarme waren dem Strom zugelaufen, der hier schon breiter war; und wie er weiterzog, trug er starke Zuflüsse und vielerlei Spiegelbilder, die er eingetrunken hatte.
Die Maria Meyer, die an seinem Ufer hinwanderte, sah ihn so – und sah ihn nicht. Sie nahm die frühe Lichtfarbigkeit wie eine Stimme auf, als verwischten sich Töne und Farben in eines.
Sie hätte gern gesungen, aber man hätte sie vielleicht gehört und ausgelacht, denn sie war die Tochter der Husch und kein eheliches Kind; und war schon einmal im Findel- und im Bewahrhaus gewesen, wo sie von faden grauen, in jeder Regung »festgelegten« Leuten bewacht und eingeengt worden war.
Sie war dort durchgegangen, suchte unterwegs Arbeit, diente bei Bauern, half in Wirtschaften, bis man von ihrer Schaffhausener Herkunft hörte oder sich aus ihrem Anblick und Gehabe etwas zusammendachte – dann jagte man sie weg.
Sie ließ sich nichts anmerken, tat hochmütig, als hätte sie nur auf ihre Freiheit gewartet, und ging oft ohne Lohn, weil sie sich nicht demütigen mochte.
Jetzt hatte sie kein Ziel, und es war ihr recht so. Sie war lang gewandert, hatte nichts gegessen, und die Schuhe schlappten ausgetreten um ihre bloßen Füße; eine Sohle hing weg und rieb bei jedem Schritt am Ballen, sie hatte sie festgebunden, aber die Schnur dann verloren.
Maria setzte sich ans Ufer und sah der aufsteigenden Sonne zu, die jetzt die lang bekannten Formen und Farben, das Randgras und die Mauer, die Bäume mit den rissigen Stämmen und die dünnfiedrigen Blätterzweige heranholte, die Häuser dahinter und einen Weg, einen festgemachten Kahn, der schaukelnd wippte, und über ihr den blauen, gleichförmig hellen Himmel, kaum mehr bewölkt, ganz eben und alltäglich und ohne etwas Besonderes.
So kam auch das Wasser jetzt daher, wenn sie sich hinunterbeugte, gewöhnlich, abgenutzt, schleppend, wie es ein paar große Blätter, verbogene Zweige, einen toten Vogel kreiselnd mittrieb.
Das Gefühl des Gleichförmigen, Monotonen, das erschöpfend Wiederholte ärgerte sie, unwertes Gefolge des frühen Sonnenwagens leuchtend im Wechsel der lichtgelben, rubinenen, türkisfarbenen Strahlen, den sie eben erlebt hatte.
Da suchte ihre Phantasie das Spiel aus sich selber wieder hervorzuholen, aus eigener Fähigkeit, und das Ebenmäßige, Gewöhnliche damit zu übermalen. Sie legte sich ins besprühte Gras und machte die Augen zu.
Wolkenschiff, Traumbarke, es schwamm silberviolett, grünbewimpelt auf sie zu und über sie weg, Schatten riesiger weißlicher Vögel, Wolken, getüpfelt und gepunktet von quirlenden. Schmetterlingen, und jetzt eine schmale braune Fasergestalt wie ein Rauch, die aus ihrem Umriß in die Länge strebte, und um die her ein glühgelbes Gewinde und Geschlinge, enger und beengend.
Maria wälzte sich unbewußt zur Seite und wieder auf den Rücken und stöhnte, sie biß die Zähne aufeinander, krampfte eine Hand ins Haar und die andere unter sich ins Moos, und erst als sie mit dem Gesicht ins nasse Gras kam, fuhr sie zusammen und, kreisend um sich selbst, wand sie sich auf die Knie und stemmte sich hoch.
Sie war völlig erschöpft, als sie zu sich kam, feucht vom Schweiß hingen ihr die Haare in die Augen, sie hörte sich stöhnen und versuchte aufzustehen; aber dann legte sie sich ausgestreckt, die Hände neben sich, reglos unter einen Baum.
Später erzählte sie – und wußte selbst nicht, ob sie träumte, schwindelte oder etwas Erlebtes angab –, ein Wirt aus dem Schwäbischen habe sie so gefunden und sei von Mitleid erfaßt worden. Jedenfalls hatte ein grauhaariger Mann, der sein Ruder im Fluß verloren hatte, sich an der Böschung kriechend zu schaffen gemacht und das liegende Weibsbild entdeckt. Vielleicht hatte er sie für eine Zigeunerin gehalten, ihr Schmutz und Armut angesehen und sie vollends aufgeweckt. Wahrscheinlich auch hatte Maria, weil sie einen Alten neben sich erkannte, nichts Blitzendes und Anmutiges darzustellen versucht, sondern auf sein Erbarmen gerechnet: Die Geordneten – und so muß er ausgesehen haben – hatten es ja lieber, wenn sie sich überlegen fühlen durften dem Verworrenen gegenüber, das sie hilflos glaubten. Das hatte sie gelernt.
Danach war sie auf einem Gefährt, hinter sich das aufgebundene Boot, halbschlafend über die Landstraßen gefahren und hatte dann in einer schrägwandigen Kammer auf einem Strohbett ausgeruht.
Sie hatte ihre Kleider geputzt und sich gerichtet und in der Gaststube des Wirtes Helm Mergenthaler in Ludwigsburg als Schankmagd geholfen.
Gäste kamen, mehr als vorher.
Sie geht gelassen, unnahbar, zwischen den ungedeckten Tischen herum, schenkt ein, bringt Brot, Würste, Butterballen, Käse, sie holt die Weinflaschen aus dem Keller. Wenn einer ihren Arm anfaßt, stößt sie die Hand weg. Sie sieht »glutäugig und ohne Ausdruck« – so sonderbar das zusammenstimmt – auf einen, der sie umschlingt, und er läßt los.
Aber dann, unerwartet, draußen an der Hausmauer, streift sie einem anderen übers Haar, der wie verzaubert stehen bleibt, und sie greift nach seinem Halstuch, zieht es enger, fährt darunter an den Hals, streicht und reibt die Schultern, das Gesicht, und fällt dem in den Arm, der starr, traumverwandelt, wie ein Fieberkranker nach ihrer Hand faßt, um sie zu küssen.
Ein paar Jahre zuvor saßen zwei junge Burschen an einem Fall – das war bei Urach im Württembergischen, und es war ein zierlicher Wassersturz, wenn sie ihn verglichen hätten mit dem urweltwilden Fall, an dem Maria geboren war.
Der Wald lag dicht um sie her, Felsengetrümmer hinter und neben ihnen, grünes sattes Moos, kurzes dunkleres Gras. Und das Sprühen und Spritzen des schmalen steilen Katarakts dröhnte lauter als ihr Gerede, das manchmal nur ein Summen war, oder, wenn sie es bubenhaft wichtig nahmen, jähes Geschrei. Und dazwischen packten sie sich bei den Haaren und Schultern und lachten oder sangen und wiegten sich, als wären sie mit allen Sinnen in das Gebraus des schmalen Falles hineingeraten.
Es waren junge Kerle, höchstens fünfzehnjährig, aus dem Uracher Seminar, sie hatten dort Theologie zu studieren, das einzig Rechte und Mögliche, da es Eltern und Lehrer empfohlen hatten, und ihre träumerische Empfindsamkeit sah Gottesgedanken und bunte Natur in eines, ob es nun System hatte oder wildwüchsig um sie hertrieb.
Aus dem wuchernden Laubwerk brach eine helle Lücke auf, Lichtbündel, Sonnenbahnen, in denen Mücken tanzten, und zwischen dem winzig-blitzenden Gewirre schien es blau heraus, sommerlicher Azur, in dem gewölbte Wolkenberge schwammen, sich breit lagerten über den grauen, dunkler schattierten Felsbrocken, als wären’s ihre gemäßen Stühle.
Die Burschen schwärmten, sangen schließlich, hieben mit Flitzgerten durch die Luft, sprangen den Hang hinunter zwischen kollernden Steinen und redeten Unsinn und dazwischen Lebensweisheiten, die sie aus ihren Schulstunden aufgenommen und hin- und herbedacht hatten, ahnungsvoll und kindlich und mit leuchtenden Augen.
Man könnte sie jetzt reden lassen und »Mörike« und »Lohbauer« zueinander sagen, und sie beschreiben: Füllig und kräftig den einen mit wilden Haaren, die Lippen voll und rötlich glänzend; und feiner den anderen, mit hellen großen klaren Augen und einem Knabenschimmer um die hohe Stirn und etwas rührend Reinem im Gesicht.
Vier Jahre sind vergangen seitdem. Aus dem Seminar, das noch viel klösterliche Disziplin und manchmal für die jungen Burschen unverständliche Strenge verlangt hatte, sind sie in den größeren Kreis der Universität umgesiedelt, auch in einen größeren Freundeskreis, in freiere Entfaltungen; aber darüber steht noch immer (und hier noch bewußter) die Stiftszucht im Blick auf die künftigen Pfarrherren, die als Vorbilder und lutherische Nachbilder herangezogen werden. In den Ferien fahren sie heim, die wenigsten leisten sich freilich einen Wagen und selten einer ein Pferd. Mörike ist nach Ludwigsburg gewandert, trifft da Freunde, sieht Mädchen, die ihm neu und wunderbar vorkommen, und Lohbauer nimmt ihn mit in die Wirtschaft des Helm Mergenthaler und zeigt ihm Maria.
Das Licht über der Tischplatte flackerte im hängenden Leuchter. Alles war da – wie ein nächtlicher Melodienstrom – früheste Erinnerung und reife Ahnung, alle Sinne schlossen sich auf – Augen und Ohr, Gespür und Getaste – obwohl niemand ihn berührte, eine Wolke schien ihm um das Wesen zu schwellen, dunstig und verklärend, alle Töne, alle Gedanken, alle wehenden Bänder und webenden Rhythmen, und so – verzaubert, verschämt, verschreckt – zog er sich zurück, daß niemand seinen Augen ansehe, was er sah, und seiner Stimme anspüre, was sie zittern ließ. Er erstarrte bei ihrer Bewegung, dem stillen gesättigten Ausdruck, einer Wendung des Kopfes, des Halses, noch ehe sie ihr Gesicht preisgab, und in dem Nebel seiner Betroffenheit sprang ein funkelndes Leuchten über, das aus ihren Augen kam, und der Bursche neben ihm sagte: »Eduard, bist ganz weg auf ei’mal?«
Das Mädchen lehnte sich an den Tisch, die bogig hochgesteckte Schürze trug sie wie einen Theaterumhang um die Hüften, die gefaltete Bluse und das schwarze Mieder waren sorgsam und genau und sauber wie aus einem Modellblatt, er merkte, daß sie sich ein bißchen wiegte, die Arme gekreuzt, und das lange lockere Haar zurückwarf, das ungebunden und ohne Kamm und Nadeln um das Gesicht fiel.
Er schaute weg; das Gesicht wäre nicht zu beschreiben gewesen – kein Wort fiel ihm ein; und sonst hatte er für alles eine Chiffre, und damit bannte er, was ihn überwältigen wollte.
Maria nahm die leeren Gläser vom Holztisch und wischte mit einem Tuch nach. Sie streifte seine Hand, die neben dem Glas gelegen hatte, und tat, als hätte sich der Lappen an seinem Ärmelknopf verhakt, faßte den Arm und nestelte am Saum, strich übers Gelenk und sagte: »Verzeihung«.
Mörike saß steif und verstört dabei, drückte den Mund zu und die Augen, und als sie ihn losließ, stand er gleich auf und sagte, er wolle zahlen.
2. Kapitel
Spinnwebschaukel
Als er sie wieder traf, fragte er, ob sie mit ihm durch die Dämmerung laufen wolle, ganz kurz und schnell, und gleich wieder umkehren. Es zog ihn zu ihr, und es graute ihm vor dem Zusammensein, er wollte sich sichern gegen irgendeine Lockung, die seine Grenzen überschreiten konnte.
Sie kam dann, langsam trat sie aus der grauen Dunkelheit hinter den Büschen. Das Wort »gelassen« fiel ihm ein … Gelassen stieg die Nacht … War sie die Nacht? Gelassen … sie war so sicher, als täte sie etwas längst Eingeübtes, ganz Vertrautes, als wäre er ihr anheimgegeben, um genommen, gebettet, ganz überflutet und eingebunden zu werden.
Später sah er sie beruhigter, er fühlte ihr »Gelassensein« wie eine gnadenvolle Macht, eine mütterliche Umwallung, viel stärker als er selbst, ein Schoß, ein Todesfluß; und danach kamen die kleinen goldzuckenden Wellen und Quellen, süßes Spiel, Sprudeln und Springen, aber das blieb an der Oberfläche, Schaum und Spiegelung. In der Tiefe, wo Zug und Strömung wirkten, war das Dunkle, die Nacht, das Anheimgegebensein, das unentrinnbare Auflösen und Mitströmen …
Maria Meyer hatte schwarze umrandete Augen unter hochgeschwungenen Brauen, sie sang mit einer tiefen Altstimme, sie bewegte sich langsam wie eine Königin aus dem fremden Land, und sie verschloß sich unversehens, wenn sie sich wild und wirr und verwirrend verloren hatte, als wäre ein tobender Flußwirbel auf einmal in einer Untiefe verlandet.
Anfangs sprachen sie nicht viel; dann verlangte der junge Student von ihr zu wissen, wer sie sei und was sie erlebt habe, woher sie diese hohe Gestalt habe und »die unergründlichen Augen« und solches mehr, wie Verliebte sich durchdringen und durchleuchten wollen und doch nicht ganz klar sehen möchten.
Schließlich erzählte sie einiges Unzusammenhängendes, sie gebrauchte lateinische Wendungen und griechische Worte, Mörike hörte ihr erstaunt zu und fragte wieder; sie habe bei gelehrten Leuten ausgeholfen, sagte sie beiläufig, und endlich auch: sie habe den Studenten Sand gekannt, den Theologen, der ein verworrener Kauz und ein verkrampfter und unfreier Kerl gewesen sei.
»Der gleiche, der ein Mörder wurde? Der den Staatsrat Kotzebue erstach?«
»Gerade der.« Den habe sie gekannt, vorher, eh’ er das getan habe, lang vorher.
»Und was hat man ihm denn angemerkt? War er jähzornig, war er verschlagen oder was?«
Nichts sei er gewesen als ein frommes Lamm, ein stilles, sagte Maria zögernd. Übrigens habe er im Herbst 1814 in Tübingen gewohnt, bei einem Kaufmann Spellenberg. Sie wußte vielerlei: von der »sprudelnden strudelnden« Freiheitsbewegung, wie sie die Gärung unter den Studenten nannte, der Empörung gegen Unterdrücker und Fremde, die noch aus der Zeit des großen Korsen herkam, der »die Völker gefressen hatte«.
Sie hatte vom Lützowschen Corps gehört, von tollkühnen Anschlägen, vom Tod des jungen Schill, des Freicorpsführers, der gegen die Franzosen angetreten war. Maria hatte ein sensibles Gespür, eine »dünne Haut«, die alle Vibrationen zittern ließen, für Regungen, die in der Luft lagen; sie wußte schnell, daß der Junge da neben ihr, der, den Kopf auf den Armen, rücklings im Gras lag, solchem Aufwind geöffnet war: der Abneigung gegen den eingefahrenen Trott, den raffinierten, routinierten Gang des geschickten Verhandlers, Agenten, Enthüllers, der für ihn mit dem häßlichen Namen Kotzebue auch gleich ein unschönes Bild weckte; denn Klänge schwangen für ihn in Farben, Wesen wurden zu Konturen wie ein Ornament, die Überwältigung durchs Gefühl überrannte und bannte ihn, bis er sich, selber beschwörend, durch die Magie, des Wortes aus der Umschlingung zog …
Als er die dunkle Zauberin fragte, wie sie heiße, schien ihm der Name banal; er fragte wieder und wollt’s nicht glauben, er suchte nach einem Wesentlichen und Umfassenden, das sie festhielte und ganz umgriffe, aber sie entglitt ihm; sie war jede Stunde anders, fremd und tief vertraut, da sie ein Element schien, ein Hauch aus dem Baum, unter dem sie lagen, ein anschwellender Fluß und das verblassende Abendrot, Windwehen und Ästewiegen und eine schwere Wolke über dem Berg.
Sie sprachen nicht viel von Politik, obwohl sie von der manches erkannt hatte, selbständiger als er, dem das alles noch neu war, denn er kam aus der gesicherten, gepanzerten, ummauerten Burg des Elternhauses und wollte im Grunde nicht einmal gern da heraus.
Sie nannte ihn einmal eine Schnecke im Gehäus, ein anderes Mal eine Muschel, und ahnte nicht, wie das Bild traf.
Er sagte: »Die Muschelschale meinst du, aber innen ist alles weich, Maria, und wenn ein Sandkorn da hineinbohrt und – drängt, das tut weh.«
Sie fragte lachend – ein tief ansetzendes, gesanghaftes Lachen aus der Kehle –, ob sie so hart sei, so ein Sandkorn, und er sagte erschrocken, wenn sie es wäre, die Muschel könne das umkleiden und einhüllen, was sie verletze, und ganz in sich einnehmen, daß es ein Eigenes werden müsse.
»Einbetten …«, sagte sie und drückte sich an ihn. Mörike strich behutsam und ängstlich über das knisternde Haar, das er in der Dunkelheit Funken sprühen sah, und sagte plötzlich aufgestört:
»Einnehmen, einhüllen – aber da wachsen ja Perlen in der Muschel?«
Maria Meyer verstand nicht gleich und schon gar nicht, daß er bei einem solchen Gedanken erschrak. Sie sagte laut: »Perlen sind doch schön, ich hätte gern so eine Kette …«
Der Herr von Münch habe ihr eine versprochen gehabt, sagte sie dann, aber den habe sie jetzt aus den Augen verloren. Der hätte auch den Hofrat Fries und den Professor Oken gekannt und mit dem geheimen Studentenorden zu tun gehabt, und sie wisse auch davon, daß man dem Professor Fichte einmal die Fenster eingeworfen habe, weshalb der ein paar Monate seine Vorlesungen eingestellt.
Das alles war ein verworrenes Geflüster, untergehend in jäh aufwachenden Zärtlichkeiten, und der junge Mann hatte den Verdacht, daß das Mädchen nur flüchtig und wie huschende Bilder solche Namen und Kenntnisse aufgefaßt habe; aber er nahm sich doch vor – beinah’ mit schlechtem Gewissen –, mehr darüber zu erfahren. Für jetzt, im nächtigen Augenblick, unter den streifenden Zweigen der Fichte, im tiefverhängten Dunkeln, undurchsichtiger noch, da ihm Marias Haar das Gesicht deckte, war er nicht zum Nachdenken gestimmt. Denn solche Verszeilen, wie sie ihm da durch den Kopf gingen, aufzuckende Funken, keine logische Kette – die hießen vielleicht „Purpurschwärze webt … mir vor dem Auge dicht“.
Maria ließ sich das vorsagen, manchmal vorsingen – sie summte mit und wiegte sich darin …
Einmal ging so ein Träumen und Weggenommensein für sie ins Halbbewußte über, und sie lag mit geschlossenen Augen und zuckte wie in Trance. Mörike wurde sie dann unheimlich, befremdlich, er versuchte sie zu wekken, zu necken und mit ein bißchen schwäbischer Derbheit aus dem Pathetisch-Visionären herauszukommen und sie mitzunehmen an ein festes gefestigtes Ufer.
Er spürte wohl, daß sie halb in einem Zwang gefesselt sei und halb das Überschwengliche wollte: Taumel, Maßlosigkeit, Exaltation …
Ihm half da ein lächelnder Geist, ein heiterer Ariel, und – die Angst vor dem gleichen Abgrund.
Sie sagte unvermittelt:
»Keine Angst, der Sand war ein Lamm.«
Sie redeten so fort und spielten schöpferisch mit Worten und lachten.
»Sand …«, sagte er, dabei müsse er wieder an das eckige Sandkorn denken, das, in die Muschel eingegraben, sie verletze und um das sich die Perle bilde. Aber diesen »Sand« solle sie doch jetzt nicht heraufrufen.
Er erzählte dann, als er in ihren Augen ein funkelndes Glimmen aufsteigen sah, ablenkend, von einem Gespräch mit Freunden: Sie hatten sich über die Herkünfte ihrer Namen Gedanken gemacht; Waiblinger hatte von den Ghibellinen, den Waiblingern, geredet, den Hölderlin, von dem sie ehrfürchtig gelesen hatten, sahen sie als den Holden, den Engelhaften, Lohbauer hieß sich einen Bauern am Wald und – Mörike fragte, was denn mit seinem Namen sei.
Das berichtete er ihr.
»Der paßt doch nicht ins Schwäbische«, sagte sie, wandte den Kopf weg und legte die Hand ins Gras, damit er das Zittern nicht spürte, wie es in ihr aufstieg.
Des Vaters Ahnen seien aus Brandenburg, aus dem Havelland gekommen, erzählte er, und die der Mutter vielleicht aus Bayern, da sie eine »Beyer« gewesen sei, eine Pfarrerstochter. Im Schwäbischen sei keine »ke« – Nachsilbe zu Haus, da müßte er schon »gelbs Rüble« geheißen haben, sein Ahnherr. Er freute sich, daß sie lachte, und spann die Sache aus:
»Möhrke, kleine Möhre, kleine gelbe Rübe.«
Immerhin habe er zwei Mohren im Wappen und vielleicht sei er auch ein halber – so eine Mixtur sei gar nicht übel –, in Frankreich gebe es einen jungen Romanschreiber, zwei Jahre älter als er, Alexandre Dumas, der ein halber Mulatte sei. Er sah sie fragend an. Sie lachte wieder, diesmal gepreßt und unterdrückt: »Ich bin ja auch so ein Halbes, weiß nicht, woher und wohin – und von meinem Vater nur den Namen und Dresden – Jakob Fried … ist dir das nicht recht geheuer?«
Er schwieg und nahm ihre Hand in seine, um sie in seine heitere Stille zu führen, die doch von dem ersten Bienengesumm tönte und über das Gras hin mit leis gurgelnden Akkorden das Gespräch des Wassers herantrug. »Vielleicht hieß er auch anders und war vom hohen Adel.«
Es ist Mai, ein kühler schwebender Tag, unruhig zittert die durchschienene Luft, ein ganz behutsamer Wind haucht über das Gras, Bläue ist in allen Farben; nicht im Grün, das ist zart gelblich, noch nicht sonnengefärbt und luftgegerbt, fast noch wie ein bleicher Wurzelkeim aus dem Dunkeln der Erde, aber Blau schwingt in der Luft, am ganz hellen Himmel, zwischen den Zirruswolken, im schnellen, schnellenden Bach, gespiegelt da, wo er stiller hinzieht; zerrissen, gestückelt, rund kreisend, wenn er Steinen und Laubhügelchen ausweicht, zwischen dem roten Astwerk am Ufer, zwischen Schatten, die noch leicht und licht sind.
Unter den Wurzeln, zwischen den vorjährigen bräunlichen Blättern, schimmert das Blau ins Lila im Geniste der Veilchen und weißlich-rosa mit Schatten aus Aquamarin in den glockigen, zackigen zitternden Anemonenblüten. Es riecht nach feuchter Frische, den Veilchengeruch glaubt man zu spüren, als wäre er überall. Summen, melodisches Schwingen zieht sich über die Wiese, am Waldsaum entlang, obwohl kein Vogel singt und noch kaum eine Biene in der Morgenkühle schwirrt; alles ist im Anfang, in der Ahnung …
„Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte,
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, wollen balde kommen.
Horch! Von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja, du bist’s, dich hab ich vernommen!“
Später, gegen den Sommer zu, saßen sie wieder beisammen. Irgendeine verwünschte Unruhe bohrte in Mörikes Kopf und Herzen und ließ ihn nicht schweigend zusehen, wie das Mädchen neben ihm ihre Haare flocht, daß die glänzenden schwarzblauen Strähnen über den hellen Stoff der Ärmel glitten wie Schlangen.
Sie legte endlich den Kopf in die Arme und weinte, unbewußt und ohne Zusammenhang, und er saß verstört und wehrlos neben ihr und versuchte zu verstehen, was sie meinte, nicht nur die Worte, sondern den Grund ihres Leidens, das jetzt, in der Benommenheit, endlich einen Ausdruck fand.
Er hatte, als triebe ihn ein unfreundlicher Dämon, von Karl Ludwig Sand gesprochen.
Es war etwas Zwiespältiges und schwer Erträgliches, wenn die jungen Leute von dem Unglücklichen redeten: Er hatte gemordet, heimtückisch, wohlvorbereitet, zäh andringend und ohne jedes Mitleid, das »Böse vernichten« wollen, das Schmutzige hinauskehren.
Nur – den Ahnungslosen, Wehrlosen niederstoßen … das war ein Verbrechen.
Mörike wollte mehr hören, wenn er den Namen nannte, da er ja wußte, Maria habe ihn gekannt. Aber daß sie so zusammenbrach, so hilflos und in einer Art Trance hinsank, erschreckte ihn.
Es war dann ein verwirrender Traum, den sie ihm vorsprach oder vorsang, Wortsplitter und Seufzen und Gewimmer, und der Unerfahrene versuchte mit weichen Worten dagegen anzugehen …
Im Sommer 1819 war der Raum dumpfig vor Hitze, es roch nach Medizin, nach Schweiß. Der Gefängnisarzt war eben gegangen, seufzend, denn er hatte in seiner langen seltsamen Praxis noch kaum einen so grotesken Fall zu behandeln gehabt, eine so grausame Heilung zustande bringen sollen: Der junge Mensch, dem er bei aller Staatstreue seine Sympathie nicht ganz entziehen konnte, war ein verhinderter Selbstmörder, er hatte versucht zu sterben, es war mißlungen. Seine Tat, ein geplanter, heimtückischer Mord, war als Heldentat und Vaterlandsbefreiung mit den erhabensten Namen belegt und belobt worden, nicht nur von ihm selber, dem Attentäter. Er hatte sich nicht entzogen, war nicht geflohen und hatte sich willig gefangennehmen lassen, in vollem Bewußtsein seines unabwendbaren Todes durch das Beil. Und er blieb tapfer und gelassen, obwohl er die grausige Art der Hinrichtung durch das Schwert kannte, die ihm weder die Guillotine noch auch den Richtblock gönnte. Die vergitterten Fenster ließen nur ein gelbliches Licht ein, das alles veränderte, auch die Laken im Bett auf dem angeketteten Brett, die zerfurcht und zerwühlt waren, und das gedunsene Gesicht des Kranken, mit dem dicken Brustwickel oder was immer es war, den ihm der Doktor angelegt hatte, und das Wasser in der Schüssel auf dem Stuhl, in dem ein Lappen lag, und die Wand, an der die Fliegen krochen.
»Nicht ganz – nicht ganz so …« murmelte der junge Mann, der da lag. »Nicht, wie ich’s tun sollte – ich lebe ja noch!« Er focht mit den Armen und stach mit der freien Hand, als hielte sie den selber entworfenen Dolch; die andere steckte in der Schlinge, die am Brustverband hing. Er streifte und stieß die Decke vollends weg, daß sie auf die Fliesen rutschte.