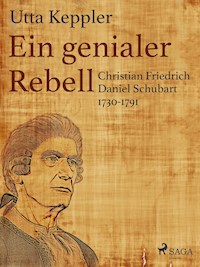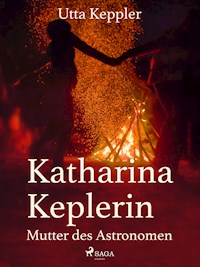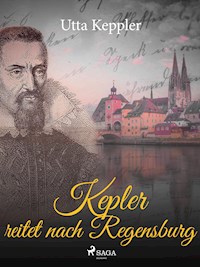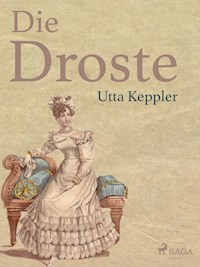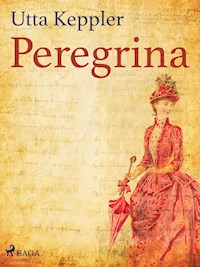Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch erzählt in Form eines biographischen Romans über das Leben von Katharina von Württemberg. Insbesondere geht es um ihre Beziehung zu und Ehe mit Jérôme Bonaparte, dem jüngeren Bruder Napoleon Bonapartes, mit dem sie gemeinsam zwischen 1807 und 1813 Westphalen regierte. Auch über das darauf folgende Exil und vieles mehr werden in diesem Werk berichtet.Utta Keppler (1905-2004) wurde als Tochter eines Pfarrers in Stuttgart geboren und wuchs dort auf. Sie besuchte die Stuttgarter Kunstakademie bis Sie die Meisterreife erreichte. 1929 heiratete sie und hat vier Söhne. Sie arbeitete frei bei Zeitungen und Zeitschriften und schrieb mehrere biographische Romane, meist über weibliche historische Persönlichkeiten, für welche sie ein intensives Quellenstudium betrieb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Utta Keppler
Für mich gab’s nur Jérôme
Katharina von Württemberg und Jérôme Bonaparte
SAGA Egmont
Für mich gab’s nur Jérôme - Katharina von Württemberg und Jérôme Bonaparte
Copyright © 1985, 2017 Utta Keppler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711708552
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Abenteuer auf Haiti
In den ersten Aprilwochen des Jahres 1802 brannte der Boden unter der bleiernen Luft, die Mauern der Forts und Gärten staubten ausgedörrt, und die Hibiskusstauden verloren in der Hitze ihre schrumpeligen Blüten. Ein penetranter Kampfergeruch dunstete aus den Eukalyptusbäumen in die unbewegte Atmosphäre. Ein paar Hafenarbeiter, deren schwarze Haut fleckig von den zerfetzten Hemden abstach, schauten stumpfsinnig auf die Wasserwüste hinaus, die sich um Port-au-Prince zog. Stumm und lethargisch lag das Meer, als brüte es etwas aus, einen jäh losbrechenden Regenguß, ein Tropengewitter, das Erde und Sträucher wegfegt.
Am Himmel schoben sich grüne Streifen auseinander wie Jalousien, Orange und Rot brachen durch, die Abendsonne schoß unverhofft grelle Strahlenbündel in die monotone Fläche, zog Rillen, spiegelte Silber und Kupfer und zeichnete, hart aufleuchtend, ein Segel an den Rand des Horizonts.
Die Schwarzen drehten sich jetzt um, hinter ihnen wurde die Gasse laut. Zwischen flachen maisstrohgedeckten Hütten lag ein gemauerter Bau, seine bläulich und gelb erleuchteten Fenster schienen auf wie gebleckte Zähne, und der verworrene Lärm von Stimmen und Blechmusik drang heraus. Vor dem breiten Tor standen Wachen, angeschienen von den Lichtbündeln, die aus der weitoffenen Tür quollen. In der hellen Bahn leuchteten bunte Waffenröcke, ein Trüppchen Offiziere schlenderte auf den Eingang zu, die Wachen salutierten.
»Die Herren Franzosen«, murmelten die Leute am Kai in ihrem sonderbaren Gemisch aus Spanisch, Französisch und einer verschollenen Negersprache.
Drinnen schloß ein eifriger Mulatte hinter den Offizieren die Tür, und um sie her ging sofort ein Höllenspektakel los. Alle schrien durcheinander, aus dem Dunst der Holländerpfeifen schimmerten Gesichter; durch das Geklapper aus der Küche, durch Klirren und Stühlescharren hörte man Rufe: »Bürger Bonaparte! Fähnrich zur See! Parbleu, wie sehen Sie denn aus!«
Grölen und Lachen, ein langer Mensch stand auf: »Laß untersuchen! Eine neue Uniform aus Paris? Oder ein Papagei? Ein Indianerfürst?«
Eine laute zitternde Stimme fuhr dazwischen: »Wer wagt’s, den Bruder des Ersten Konsuls zu beleidigen? Gustave? Ich werde dich melden, dich und dein laienhaftes Gerede! Mein Bruder …«
Es wurde sofort still.
»Jérôme, niemand will dich kränken! Wir haben doch nur über deinen Anzug gelacht, du siehst ja aus wie auf dem Maskenball! Laß dich anschauen! Ah, charmant, charmant!«
»Wo hast du das her?« fragte ein anderer.
Jérôme, schnell beruhigt, drehte sich geschmeichelt im Kreis und lachte. Er war ein bildhübscher Bursche, mit schmalen Hüften, die schlanken Beine in engen hellblauen Hosen, den knappen Dolman, eine Jacke ohne Schöße, reich mit Goldschnüren bestickt, den Samtumhang wie eine Tänzerin anmutig um die Schultern gewirbelt.
Er wiegte sich. »Und steht es mir nicht?« Er warf die Lippen auf, blinzelte aus nah zusammenstehenden schwarzen Augen in den Dunst der Pfeifen und Kerzen, hinter dem er ein paar dunkle Mädchengesichter witterte.
»Étonnant«, urteilte einer der jungen Leute, »setz dich und zeig die Berlocken am Gürtel her! Bezahlt die auch der Erste Konsul? Oder die Schwester Pauline und dein lieber Schwager Leclerc?«
»Leclerc«, murrte Jérôme und setzte sich, vorsichtig den Prunkdegen neben sein linkes Bein plazierend, »wird sich wundern, er muß sich daran gewöhnen, daß sich ein Bonaparte nicht befehlen läßt, auch wenn er erst siebzehn Jahre zählt.«
»Mag sein, wenn er Erster Konsul ist!« Das sagte ein älterer Offizier und griff neugierig nach dem glitzernden Gebaumel an Jérômes Hüfte. »Brillanten – im Ernst, Junge, wer bezahlt die?«
»Ihr Spießer!« rief Jérôme lachend, »ihr faden Böcke, ihr …«
Aus dem Dunst tauchte eine Gestalt auf, eine Ordonnanz in der blau-roten, bordierten Uniform der französischen Matrosen.
Jérôme warf sich sofort in die entsprechende Pose – ihm kam Bewunderung zu, einem der glänzendsten Offiziere der Kolonialarmee, wenn auch noch nicht dem ranghöchsten; und was er vor aller Augen darstellte, das glaubte er zu sein.
Man schwieg jetzt erwartungsvoll und insgeheim ein bißchen belustigt, aber jeder spürte, daß der gutmütige Spott nicht so weit gehen durfte, den Bruder des großen Mannes, den »lieben Kleinen«, wirklich zu verstimmen; und sein jungenhafter Charme machte das leicht.
Der Bursche, der eben eingetreten war, sah allerdings wenig von solchem Glanz, er schaute ernsthaft auf den turbulenten Kreis und zog, als er nahe genug heran war, ein Schreiben aus der umgehängten Ledertasche.
»An den Bürger Jérôme Bonaparte, Fähnrich zur See, unter dem Kommando des Generalkapitäns Leclerc …« Er drehte suchend den Kopf. »Wo finde …?«
Jérôme trat vor. »Kennt Er mich nicht, Bürger?« fragte er scharf, und der Soldat wurde blaß, da er als Zivilist angeredet wurde. Er entschuldigte sich leise. Jérôme nickte gnädig, nahm den Brief entgegen und winkte abschließend. Der Bote stand stramm, drehte mit dem vorgeschriebenen Ruck um und stelzte zur Tür. Sofort fielen die Kameraden über den Jungen her.
»Was ist los? Ein Befehl? Eine Rechnung? Ein Liebesbrief?«
Jérôme wehrte sie ab und setzte sich. Er hatte das Siegel und die Pariser Zensurzeichen erkannt, die roten Streifen des Sonderkuriers auf dem Umschlag, und steckte das Kuvert ungeöffnet in die Hosentasche. Aber ein dünnbärtiger Leutnant, der ihm zunächst saß, packte sein Handgelenk und zog das Papier zurück. Eine Rauferei begann, bei der ein Stuhl umfiel und der Tisch wankte; der Wirt sprang zu und hielt die Flaschen fest, so gut es ging.
»Vom großen Bruder!« schrien die Freunde, als einer das Papier hochhielt, und Jérôme, mit gespieltem Zorn, streckte die Hand danach aus. »Gib’s her, ich werd’s lesen!«
»Laut! Ohne Abzug! Lies vor!« hieß es.
Jérôme entfaltete die penibel geschriebenen Seiten – Napoleons Sekretäre waren dazu erzogen, rasch und doch deutlich zu schreiben.
»Bürger Bonaparte!« las er. »Er könnte mich wohl mit meinem Rang anreden, er hat ihn mir selbst verliehen!« murrte er.
»Weiter!« drängten die anderen. Er zögerte. Murmelnd hatte er das Folgende überflogen. »… ich erhielt soeben einen Mahnbrief des Bürgers Bourrienne, den Sie, Bruder, zu Ihrem Bankier ernannt zu haben scheinen. Dieser ehrliche Makler meldet mir das Ausbleiben Ihrer Wechsel, den Zinsverlust, die verzweifelten Klagen der nie bezahlten Lieferanten. Er berichtet mir, daß Sie ein Toilette-Necessaire im Wert von 16 000 Francs gekauft und diese kostbare Torheit – zwölf Stück aus Gold und Elfenbein – für mich auf Kredit genommen haben …«
Jérôme vergaß, wo er war. »Das hat Bourrienne nie getan, er ist mir treu!« kreischte er aufgeregt, »das verdanke ich nur dem Juwelier Biennais in der Rue St. Honoré, keinem anderen … Der Hund! Der schäbige Hund …«
Eine Woge von Gelächter antwortete dem Ausbruch. »Und stimmt es denn?«
»Warum nicht?« Jérôme drehte den schönen Kopf und riß die dunklen Augen weit auf. »Ich war einer Dame verpflichtet, ritterlich und ehrenhalber, und …«
Wieder das tobende Gelächter.
»Und du konntest dich nicht billiger revanchieren?«
»Billiger? Meint ihr mit Geld, ihr gamins?« Er stieß auf den Sprecher zu wie ein wütender Vogel. »Das war eine Dame! Und mein Rivale …«
»Dann hättest du dich natürlich duellieren müssen, Freund …«
Jérôme sprang auf den anderen zu. »Hast du etwa schon ein Duell hinter dir?« Er packte ihn am Latz. Er war blaß geworden, griff ins Jabot und riß es auf. »Hier – hier im Brustbein steckt die Kugel, und wenn ich zum Ruhme Frankreichs falle, wird man sie finden – bei meiner Autopsie …« Er warf die Spitzen seines Seidenhemdes wieder übereinander, atmete laut hörbar, stand da, den Oberkörper anmutig gedreht und darauf bedacht, eine gute Figur zu machen.
»Erzähl, erzähl!« schrien jetzt die jungen Leute. Einige von ihnen kannten das Histörchen schon, aber Jérômes Drang nach Bewunderung war so zwingend, daß man ihm gern den Gefallen tat, noch einmal zuzuhören. Er selber war froh, daß er von dem fatalen Brief ablenken konnte, von dem er in der Aufregung zuviel vorgelesen hatte …
Man rückte näher heran, er im Mittelpunkt, hochaufgereckt vor den erhobenen neugierigen Gesichtern, hinter denen die Bedienten und die braunen Mädchen in der rauchigen Dämmerung sich drängten.
Das war die Atmosphäre, die Jérôme brauchte.
»Was ist das wieder für ein tolles Abenteuer?«
»Ach, nichts weiter: es ging um eine Dame.«
»Und der andere? Hast du ihn getötet? Sag schnell!«
»Davout hat mich beleidigt, eine hinterhältige Intrige versucht – wir schlugen uns mit Pistolen bis zur Kampfunfähigkeit!«
»Und da du umfielst …?«
»Ja, gewiß, man hielt mich für tot, auch der Arzt sah kein Leben mehr in meinem Körper. Davout war tief erschüttert, aber dann, ich weiß nicht wie, muß ich mich bewegt haben, ihr kennt ja die Weissagung, daß kein Bonaparte durch eine Kugel fällt.« Er sah sich um. »Meinen Vater haben sie auf das Blutgerüst geschleppt …«
Man schwieg und schaute ihn an, aber Jérôme vertrug keine bedrückende Stimmung. »Die Dame«, sagte er pathetisch, »fuhr danach an den Kampfplatz und ließ sich den Stein zeigen, der von meinem Blut gezeichnet war, im Wald von Vincenne.«
»Warst du denn in Paris damals?« wollte einer wissen.
»Ich gehörte zur Leibgarde, neben Eugène de Beauharnais übrigens, der brav seinen Dienst tat, braver als ich, wie ihr euch vielleicht denken könnt.«
»Du bist ja auch der Bruder des Ersten Konsuls!« tönte es, und Jérôme war nicht ganz sicher, ob das nicht ironisch klang; aber er nahm solche Nuancen nicht ernst, wenn sie ihm nicht paßten. Freilich, der Name des großen Bruders trieb ihm jetzt das Blut in den Kopf, der Brief, die Schulden – und mit Napoleone war nicht so leicht fertig zu werden wie mit den gutwilligen und leicht bezauberten Kameraden.
Im Wirtshaus von Port-au-Prince endete der Abend wie jedesmal mit einem ausgelassenen Gelage, Mestizinnen und Kreolenmädchen, die sich sonst stolz zurückhielten, wurden johlend herbeigeholt, man schäkerte und tanzte, torkelte und schlich in die dunkleren Ecken und hinaus in die dampfende Tropennacht.
Jérôme Bonaparte, der Sohn der asketischen Madame Letizia, rasselte im Wagen eines Kameraden ins Quartier zurück, summend und pfeifend, zwei braune Mädchen im Arm. Den Mantel hatte er liegenlassen; anderntags verschlief er, wie ein paarmal schon, den Dienstantritt auf seinem Übungsschiff, aber da wurde die Meldung an den Admiral direkt weitergeleitet und dort »vergessen«.
Den kostbaren Samtumhang brachte ein übereifriger Mulatte aus dem Wirtshaus zum Kommandeur, dem General Leclerc, von dem man wußte, daß er Jérômes Schwager war. Seine Frau, die hübsche, leichtfertige Pauline, war mit ihm in die Tropen gereist. Leclerc wohnte in einem palmenumstandenen weißen Gebäude, das man eigens als Präsidentenpalais aufgebaut und für ihn hergerichtet hatte. Unter dem Säulenportikus standen Wachen in farbigen Uniformen, im Eingang Palmen in großen Kübeln, als wäre es mit denen draußen nicht genug, und ein Springbrunnen schoß seinen dünnen Strahl in ein glitzerndes Becken. Das alles war nicht eigentlich nach Leclercs Geschmack, aber die zum Überschwang neigende Pauline liebte solche Zurschaustellung ihrer wichtigen Position.
Ein gelblivrierter Soldat öffnete dem Kellner, der Jérômes Mantel offen auf dem Arm trug; er fragte, wie er die Wachen passiert habe, und erfuhr, man kenne ihn hierzuland. Als dann der Mulatte endlich vor Leclerc stand, machte der Kommandant ein düsteres Gesicht. Er war ein gutaussehender hagerer Mann; schwarze Bartkoteletten ließen sein gelbliches Gesicht noch schmaler erscheinen. Er trug die betreßte Uniform mit freier, natürlicher Würde und winkte dem Türsteher, dabeizusein, während er den Kellner ausfragte.
Der Mann dienerte, während er das schwere dunkelrote Gewand vor sich hinhielt wie ein Tablett. Leclerc mußte lächeln – zum Lachen war ihm nicht zumut, denn er durchschaute schnell den Zusammenhang. Als er dann hörte, wo Jérôme sein prunkvolles Stück verloren und wie er darunter gekleidet gewesen war, sprang er verärgert auf. Das sei doch nicht die Uniform eines Marinefähnrichs, schrie er den Boten an, und ob er sich nicht täusche, daß dieses da der Fähnrich zur See Bonaparte getragen habe?
Und schließlich ließ er sich, penibel wie er war, die farbigen Bilderlisten bringen, auf denen ein Malergeselle die vorgeschriebenen Uniformen »bis auf den Knopf genau«, wie die Vorschrift hieß, abgeschildert hatte, rote mit blauen Tressen und weißen Hosen, und grüne und schwarze, verschnürte und geschlitzte, und ausgeschnittene Stiefel und Schuhe. Er erhitzte sich bei dem Anblick; denn der Erste Konsul selber hatte diese und jene Uniform für die Kolonien genehmigt, da es wichtig sei, la grande nation dort würdig zu vertreten.
Er ließ Pauline rufen, und sie kam nach einer Weile, mit wehendem Seidenschal, die dunklen Locken ins Gesicht gekämmt, und hörte sich die Reden ihres empörten Gemahls an. »Aber, mon cher! Wieviel Firlefanz trägt man zur Schau! Und wenn der Kleine sich in seinem kindischen Spiel gefällt, als Berchinyhusar, was schadet das? Er hat vermutlich bezaubernd darin ausgesehen, denn er ist der hübscheste von meinen Brüdern, Lucien ist zu düster, Louis zu fade, und Giuseppe ist ein Kahlkopf.«
Leclerc hörte gar nicht zu. »Es ist Vorschrift, und er hat ein Muster zu sein als Offizier. Wenn ich ihm eine Nachlässigkeit erlaube, kommt bald jeder als Zieraffe daher, als Indianer, als Mulatte …«
Pauline sagte nichts mehr, sie nahm den Fächer vors Gesicht und kicherte heimlich.
Leclerc nahm Bagatellen ernst, er hielt sich beharrlich an die Formen, die den Dienst hier ausmachten, da der große Atem fehlte, die echte Gefahr, jetzt, wo das Land unterworfen war. Sein starres spitzes Gesicht verkrampfte sich, während er die Uniformbilder eins ums andere beiseite tat.
Jérôme wurde zitiert, er nannte es freilich vor den Kameraden eine Einladung, und Pauline hatte Likör und Gebäck auftragen lassen.
Leclerc saß, vertieft in irgendein Schriftstück, an seinem Schreibtisch. Pauline lächelte gequält, erhob sich, was sie sonst nie tat, wenn ein Mann gemeldet wurde, und schwebte mit wogenden Gazeschleiern dem »Kleinen« entgegen. Jérôme stand etwas verlegen, mit trotzigem Gesicht, auf dem Rand des riesigen roten Perserteppichs, der die Tür vom Schreibtisch trennte. Pauline erwartete jeden Augenblick einen Ausbruch, einen frechen, taktlosen, nie wieder zu glättenden Ausbruch, und sah ihn flehend an. Schließlich trat sie von hinten an Leclerc heran und legte die Hand auf seine Schulter. Er zuckte zusammen und sah sich um, so schnell, daß die Goldschnüre an seinen Epauletten wirbelten. »Ma chérie!« Aber er drehte dann doch endlich den Sessel in Jérômes Richtung, der zuerst rot und dann bleich geworden war und sich sichtlich kaum mehr beherrschen konnte.
»Sie haben mich rufen lassen, monsieur mon beau-frère«, sagte er halblaut mit schwankender Stimme und tat einen Schritt vorwärts: er war im Gesellschaftsanzug, mit weißen engen Hosen und einem goldgeschnürten langschößigen Rock, den Prunkdegen an der Seite.
Leclerc schlug ein Bein übers andere und betrachtete ihn ausgiebig. »Ihr Dienst, Fähnrich, scheint Ihnen viel Zeit zu lassen? Sie haben, wie ich sehe, die Modejournale ausgiebig studiert?«
Jérôme deutete eine Verbeugung an. »Es ist die vorgeschriebene Galauniform, mon beau-frère, für große Empfänge beim Gouverneur!«
Leclerc sprang auf. »Das ist kein Galaempfang, Jérôme, das ist eine Vorladung, wenn Ihnen das noch nicht klargeworden ist! Ich erwarte Auskunft über Ihr unmögliches, disziplinloses Benehmen, Ihre Affereien, Ihre Maskeraden, mit denen Sie die französische Armee lächerlich machen! Ich erwarte Entschuldigungen wegen Ihrer allzuhäufigen Besuche in den übelsten Spelunken, über Ihre Schulden, Ihre Angebereien und Aufschneidereien und Ihren laschen Dienst!« Er winkte Pauline, die noch immer neben dem Sessel stand. »Setz dich doch, ma chère, ma fleur!«
Sie lächelte halb belustigt, halb kokett und sank, die winzigen seidenen Schuhe gekreuzt, in einen Stuhl.
Jérôme zögerte noch, er wußte nicht recht, welche Geste hier angebracht sei, die des hübschen Familienlieblings schien ihm nicht zu genügen. Immerhin war Leclerc sein Vorgesetzter, und er spürte, daß der über die Sippenzusammenhänge hinausdachte. Und er war auch kein Italiener wie die Bonapartes und Ramolinos, und das hieß, daß er nüchtern einstufte und sich kein alles überwindendes sentimento della famiglia erlaubte, wie gelegentlich sogar der ruhmreiche Napoleon.
Jérômes Verstand war der eines großen Jungen, nicht mehr; aber sein Instinkt, die fast feminine Einfühlung in das Wesen seines Gegenübers, die ihn auch für Frauen oft so unwiderstehlich machte, gab ihm ein zu sagen: »Verzeihen Sie, mon général, ich habe die Seeschlacht von Saint Domingue mitgekämpft, und der Admiral gab mir den ehrenvollen Auftrag, die – nach zweimaligem Ansatz endlich geglückte – Unterwerfung der englischen Swiftburne …« Er stockte plötzlich, trotz aller Keckheit aus dem Konzept gebracht. »Nun, Sie werden wissen, ich habe die eroberte feindliche Prise bemannt und aus den Händen des unterlegenen Kapitäns seinen Degen empfangen.«
Pauline hob die Hände. »Oh, Jérôme, das muß ein wundervoller Anblick gewesen sein! Du im Moment des Sieges, auf dem zerschossenen Schiff, in Gegenwart der gefangenen Mannschaft, noch im Pulverdampf …« Sie sprach auf einmal italienisch, und Jérôme antwortete hingerissen: »Si, travolgente, Paolina!« Überwältigend, das war es, und er selber war von seinem Ruhm überwältigt!
Leclerc schwieg, da er kaum Italienisch verstand, aber den Sinn dieser Tirade hatte er erfaßt und auch die Motive des Admirals Gantheaume richtig eingeschätzt, der die erste, einzige Gelegenheit nutzte, den kleinen Bruder auszuzeichnen und dem großen Konsul gefällig zu sein, in dessen Diensten er stand.
»Sehr gut, mein Schwager, und zweifellos hatten Sie eine solche persönliche Hervorhebung damals verdient – nach der Schlacht.« Er wies jetzt auf einen der herumstehenden Stühle. Pauline lächelte.
»Im Januar 1800«, sagte Jérôme jetzt, »kam dem Admiral ein böses Unwetter zustatten. Wir kreuzten in wilden Regenböen, das Admiralsschiff drohte zu kentern, einige Segler verloren die Masten, die Flottille wurde auseinandergetrieben … und das mitten in der finstersten Nacht; man wartete besseres Wetter ab, bis schließlich doch die Engländer – der Admiral Warren – auftauchten und uns so zusetzten, daß wir nach Toulon auswichen.« Er atmete auf, wenigstens hatte ihn sein Gedächtnis nicht im Stich gelassen. »Drei Monate danach dasselbe – Sie wissen ja. Aber dann kam der Sieg über die Swiftburne, das schönste Schiff, das der englische König auf See zu schicken vermochte.«
»Das haben Sie bereits erzählt, Degen abgefordert und Prise bemannt«, sagte Leclerc nüchtern. »Und dann?«
»Es war meine erste Seeschlacht, und ich habe die Kugeln nicht gefürchtet.«
»Gewiß, das hat Ihnen auch der Erste Konsul bestätigt, Gantheaume hat es mir berichtet.«
Von Paris, das er als junger Held wieder betrat, erwähnte Jérôme nichts; er ließ lediglich beiläufig verlauten, er habe seinem Bruder den Admiral warm empfohlen. (Gantheaume hatte, da ihn Jérôme um eine größere Geldsumme angegangen hatte, als Gegengabe diese Hilfe erbeten …)
Leclerc lag daran, diese sonderbare Audienz abzuschließen. Er beschied den Schwager kurz: »Das genügt; halten Sie sich in Zukunft auch in Ihrem Auftreten so, wie es einem Seeoffizier der grande nation zukommt, und erregen Sie kein Ärgernis mehr. Ihren Mantel habe ich reinigen lassen, er wird Ihnen beim ersten Sekretär übergeben werden. Ich lasse einen Wagen vorfahren. Pauline?«
Pauline stand auf, anmutig mit dem Schleier hantierend, und trat zu Jérôme, der ihr die Hand küßte. Strammstehen, Aufstechen, ein freches Blitzen aus den kleinen schwarzen Augen – dann war er draußen.
Leclerc ließ sich seufzend in seinen Sessel zurückfallen, streckte die Hand nach Pauline aus und zog sie zu sich herüber; sie schmiegte sich auf seine Knie und streichelte sein Haar. Dann ging sie langsam zur Tür.
Gelegentlich gab es Jérômes wegen einen gereizten ehelichen Disput zwischen Leclerc und Pauline; daß er nun schon das zweite Mal in den Kolonien sei, meinte sie, zeige doch, daß Napoleon ihn für bewährt und fähig halte, und immerhin habe er sich ja bei der Einnahme von Port-au-Prince recht gut bewährt, sonst hätte ihn doch der Admiral nicht gleich zum Fähnrich zur See gemacht. Und Latouche-Tréville sei keiner von den unkritischen Admiralen.
Persönliche Tapferkeit und Wagemut – die habe er, sagte der Gouverneur, aber das genüge eben nicht; er hätte den Schwager gern verantwortungsvoller gesehen und auch »politischer« in seinen Auftritten. Er hätte sehnlich gewünscht, diese schwierige, kaum mehr übersehbare Lage mit ihm zu bereden und den »Kleinen« nicht bloß als Dekorations- und Zierstück einzusetzen.
Pauline widersprach, da ihr jedes Gespür für Leclercs Sorgen abging. Sie hatte in den Jahren ihrer Kolonialzeit gerade gelernt, die Kreolen von den Mulatten und diese von den Negern zu unterscheiden, die vielerlei Nuancen der Mischungen ersten und zweiten Grades, die in diesem Schmelztiegel wirbelten und agierten, so weit zu trennen, daß sie keine Taktlosigkeiten beging und ihm schadete. Kreolen hießen ursprünglich die seit Generationen in Haiti ansäßigen Weißen. Es gab die »großen Weißen«, Aristokraten und Großgrundbesitzer, und die »kleinen Weißen«, die ein Handwerk trieben, keine Pflanzungen hatten und nur »Haussklaven«, keine Plantagenarbeiter hielten. Mulatten nannte man die Mischlinge aus der Verbindung Weißer und Schwarzer, später auch alle freien Farbigen, gleich welcher Abstammung sie waren. Und endlich gab es »neue Freie«, ehemalige Sklaven, die das Dekret des Nationalkonvents vom 4. Februar 1792 losgesprochen hatte, als Folge der großen Kolonialdebatte vom Mai 91, in der Robespierre für die Abschaffung des Menschenhandels und der Sklaverei plädiert hatte.
Verständlicher als diese politischen und juristischen Begriffe waren Pauline die Bitten der Joséphine Beauharnais um die Befriedung Haitis. Sie war ja selbst Kreolin und stammte aus Mozambique.
Befriedung – das war freilich ein fernes Ziel. Leclerc wußte das. Die Kolonisten, durch billige Sklavenarbeit reich geworden, zögerten mit vielerlei Vorwänden die Durchführung der Beschlüsse aus dem fernen Paris hinaus, die Schwarzen, die Bescheid wußten, empörten sich und lieferten damit das Argument, das Dekret zu widerrufen: neue Aufstände, Widerspruch der weißen Grundbesitzer, die einsahen, daß sie mit den freien Farbigen besser arbeiten konnten als mit unzuverlässigen und aufsässigen Sklaven. Es gab ein erbittertes Hin und Her, und Paris erwog militärische Eingriffe gegen die unbotmäßigen Landsleute in der Kolonie.
Leclerc – eingezwängt zwischen Auftrag und Einsicht – machte dringend auf die Agenten Englands aufmerksam, die den Zwiespalt ausnutzten und den Kolonisten Hilfe anboten … Spannungen, Emotionen, zwischen denen der Kommandeur sich wand, ohne Rückhalt und auch nur Verständnis bei seinen Nächsten. Pauline erfuhr durch Briefe aus der Heimat von der Enthauptung Ludwigs XVI., redete sprudelnd und naiv über den armen, dummen König, machte sich gegen Leclercs Wunsch wichtig damit und verstand erst zu spät, daß die Spanier, noch immer begierig auf den Besitz der Kolonie, aus diesem Königsmord eine Legende machten, um die Schwarzen aufzuhetzen, denen der König noch immer ein magisches Symbol und ein halbgöttlicher Heros war, auch bei einem fremden Volk. Übrigens nutzten gerade die spanischen Pflanzer ihre Sklaven, die Unfreien, barbarisch aus und straften Ungehorsam mit grausamen Folterungen.
Einer der Freigelassenen, ein riesiger, reinblütiger Neger, Toussaint Louverture, organisierte seine Landsleute, trieb sie zu Massakern in einsam gelegenen Gehöften an, drillte sie nach europäischem Muster und ließ sie glauben, ihre Seelen kehrten, nach dem Tod durch die verhaßten Weißen, in die afrikanische Heimat, zu ihren Geistern, Medizinmännern und Wodu-Heiligtümern zurück …
Leclerc versuchte den Rebellen mit hinhaltenden Scharmützeln zu begegnen, setzte auf ihre Desorganisation und allmähliche Ermüdung, hoffte auf ein langsames Versickern des Widerstandes, als er von einer üblen Nachricht aufgeschreckt wurde: Jérôme hatte eine junge Negerin entführt, geschwängert und verschwinden lassen … Das war nicht mehr nur ein harmloser Streich, sondern lieferte der Hetze gegen Frankreich reichliche Nahrung. Aber noch viel brisanter wurde die Sache, als bekannt wurde, daß es sich bei dem Mädchen um eine Verwandte des Generals Toussaint Louverture handle. Daß sie mit einem Boot verschwunden war und die Ruderer schließlich, scharf verhört, zugaben, man habe sie nicht getötet, ließ vermuten, daß sie das Abenteuer weiterverbreitete und daß Toussaint inzwischen davon wußte.
Leclerc wurde ungeachtet seiner trockenen, verbissenen Redeweise so heftig, daß Pauline aus dem Zimmer lief. Jérôme weinte fast; er jammerte, er habe bei seiner Jugend und seinem romantischen Feuer ja nicht anders handeln können – aber Leclerc schnitt ihm brutal das Wort ab, und gemahnt, das Mädchen zu suchen und abzufinden, stöhnte Jérôme, er habe doch kein Geld, nur große Schulden …
Schließlich drehte sich dér Generalgouverneur angewidert weg. »Ich werde die Sache bereinigen«, sagte er, »und das arme Geschöpf bezahlen.« Nicht einmal Paulines Schwesternzärtlichkeit kam dem Leichtsinnigen mehr zu Hilfe: Solche Eskapaden, vollends wenn sie bekannt geworden waren, mochte sie nicht.
Leclerc ließ sich trotz seines Ärgers herbei, Jérôme noch einmal über die Vorgeschichte und die politischen Schwierigkeiten und Ziele der Kolonialisierung Haitis aufzuklären. Müde, sichtlich von Jérômes Unverständnis überzeugt, zeigte er ihm auf der Karte die portugiesischen, englischen und spanischen Eroberungen und Verluste, Toussaints Unternehmungen, seine – Leclercs – Gegenzüge und die Erlasse und Dokumente, die zwischen Napoleon und dem Rebellenführer gewechselt worden waren. Jérôme bekam zum erstenmal Papiere in die Hand, die ihm das Maskenspiel, in dem er sich vergnüglich umzutreiben glaubte, als Aufgabe, als Verantwortung, als Arbeit, die einen reifen Mann verlangte, auswies.
»Sie sehen, Bürger Jérôme«, sagte Leclerc, »welch großes Ansehen dieser Schwarze genießt, Sie verstehen, daß der Erste Konsul wünscht, ihn zu schonen und freundlich zu stimmen, und Sie ahnen wohl jetzt endlich« – seine Stimme wurde scharf –, »wie aufgebracht er sein wird, wenn er von Ihrem üblen Streich erfährt. Segeln Sie nach Paris und stiften Sie hier keine Unruhe mehr, das ist ein Befehl!«
Es war nur die halbe Wahrheit, die Leclerc preisgegeben hatte, aber weder Pauline noch gar Jérôme durchschauten das.
Nach den Kämpfen, die noch während des Briefwechsels der Anführer wieder ausbrachen, nach Toussaints bissigen Vorwürfen gegen Napoleon, dem er den eigenen ungesetzlichen Staatsstreich vorwarf, lag weder dem Generalgouverneur noch dem Ersten Konsul mehr allzuviel an Toussaints Schonung und Freundschaft. Schließlich erließ Leclerc einen Tagesbefehl, mit dem er die Aufständischen außerhalb des Gesetzes stellte.
Obwohl der Partisanenkampf in dem mörderischen Klima, die Moskitos und der Durst die Franzosen furchtbar schwächten, hatte Leclerc die Festung Crête Pierrot erobert, sechshundert Schwarze gefangennehmen und erbarmungslos niedermachen lassen. Und eben jetzt, fast gleichzeitig mit der Verabschiedung des Schwagers, verlangte Leclerc die bedingungslose Unterwerfung Toussaints, seiner Unterführer und Vasallen und plante gleichzeitig die Überlistung und Gefangennahme des gefürchteten Feindes. Der harmlose »Kleine« sollte Leclercs freundliche Gesinnung bekannt machen und zugleich gemaßregelt und aus der bedrängten Kolonie entfernt werden.
Toussaint, militärisch durch den Verrat seiner Verbündeten fast wehrlos, baute auf einen bösen Helfer: Er verzögerte durch Guerillakämpfe die Übergabe, versteckte sich und ließ hier und dort einen unübersichtlichen grausamen Buschkrieg auflodern; denn er hoffte auf die Regenzeit, die alljährlich das Gelbfieber brachte, die Seuchen, gegen die seine Schwarzen nahezu immun, die Franzosen aber kaum widerstandsfähig waren – es würde sie, schrieb er, »niederwalzen wie Gras«, vielleicht, wie schon einmal bei der ersten Eroberung vor Jahrhunderten die Spanier, zu Aufgabe und Verzicht zwingen …
Jérôme schiffte sich auf der Cisalpin ein und landete am 11. April in Brest.
Pauline hatte ihn – trotz allem – gerührt fortgewinkt, Leclerc war erleichtert, den unberechenbaren und letztlich unbrauchbaren Burschen loszusein, den er nicht maßregeln durfte.
In Saint Domingue nahm die Hitze zu, in der brütenden Glut brachen fast täglich Tropengewitter und Regengüsse los, die wie Urweltkatastrophen niederstürzten, alles überschwemmten und wegrissen, was nicht fest verankert war, Felsen kahlfegten und Hütten mitspülten. Die Keller liefen voll, die Pferde standen bis an den Bauch im Wasser. Danach wurde es dann schnell kühler, aber nur für Viertelstunden. Die Hitze drückte bald wieder auf die Dächer, und auch im Gouverneursbau halfen die Springbrunnen nicht viel; Pauline lag den Tag über auf einem Diwan und ließ sich Luft zufächeln, man trug Wassersprenger mit duftenden Essenzen durch die Zimmer, die schwarzen Mädchen standen um Pauline herum und schwitzten; sie verlangte mehr und anderes Parfum und plagte Leclerc mit immer neuen Wünschen, die sie ihm melden ließ.
Schließlich unterbrach er seine Arbeit und ging zu ihr hinüber. »Liebe, du mußt dich zufriedengeben«, sagte er matt, »wir haben gewußt, daß uns das Tropenklima drücken würde, mich quält es auch. Aber schau, es regnet ja schon. Und wenn ich das Fenster öffne, wie kühl es hereinweht – spürst du den Schauder, Pauline?«
Sie sah ihn erstaunt an. »Ich spüre keinen Schauder, mein Freund!« Sie stöhnte weinerlich. »Ich spüre bloß die trockene Glut. Komm, setz dich zu mir und tröste mich!«
Leclerc ließ sich auf den Rand des Lagers sinken. Er nahm ihre Hand, und sie zuckte zurück.
»Du bist heiß – fast zu heiß!« murmelte sie und legte ihre Fingerspitzen auf seine Stirn, wo das dunkle Haar klebte. Er warf die Hände vor die Augen und ächzte: »Mir ist schlecht, Pauline, ich fürchte …«
»Du hast Fieber, mon cher!« schrie sie ekstatisch und sprang auf. »Ein Arzt soll kommen, schnell!«
Eines der schwarzen Mädchen lief kreischend hinaus, Leclerc fiel auf das Lager und krümmte sich wimmernd. Es war das Gelbfieber, das schon seit Tagen unter den Soldaten grassierte und das die Fliegen, die Moskitos eingeschleppt hatten. Man brachte ihn zu Bett.
Der Kranke phantasierte, er schüttelte sich in Frost und Glut, sein helles Gesicht wurde fast braun. Der Arzt verbot Pauline, ihn zu besuchen, spülte und wusch, gab Fiebermittel und legte, nach indianischem Rezept, Blätter auf gegen das »schwarze Erbrechen«. Nach vier Tagen kam die gefürchtete Krise, der abgemagerte Körper bäumte sich in Krämpfen, der General ächzte, den Mund weit offen, zerrte am Laken und verlangte zu trinken, und endlich, in der fünften Nacht, starb er.
Pauline war nicht bei ihm, sie lag weinend, aufgeregt wartend in einem bequemen Landhaus, das ihr Leclerc im Gebirge hatte bauen lassen, in der Mitte der Insel, dort, wo sich die Hügel, wie die Geographen schrieben, »wie Papier falteten«.
Nach dem Tod des fähigen Mannes, nach den tausendfachen Toden seiner Soldaten, erwogen die französischen Führer, wie sie schnell, rücksichtslos, ohne sich noch mehr zu schwächen, den angeschlagenen Schwarzen und ihrem fähigsten Strategen ein Ende machen könnten. Am 7. Juni 1802 schrieb der General Brunet, Leclercs Nachfolger, an Toussaint Louverture:
»Der Augenblick ist gekommen, Bürger General, wo Sie dem Oberkommandierenden unwiderleglich beweisen müssen, daß diejenigen, die ihm Zweifel an Ihrer Glaubwürdigkeit einzuflüstern versuchen, böswillige Verleumder sind. Wir haben … einige Fragen zu klären, die unmöglich brieflich zu regeln sind, für die jedoch eine kürzere Unterredung von einer Stunde ausreicht. Wenn ich nicht mit Arbeit und Geschäften überlastet wäre, käme ich zu Ihnen … Kommen Sie zu mir … Sie werden in meiner ländlichen Wohnung nicht alle Bequemlichkeiten vorfinden, über die ich zu Ihrem Empfang gern verfügen würde, aber Sie werden die Offenheit eines Ehrenmannes zu schätzen wissen … Ich wiederhole es, Bürger General, Sie finden nirgends einen aufrichtigeren Freund als mich, vertrauen Sie … halten Sie Freundschaft mit unseren Untergebenen, und Sie werden endlich Ruhe genießen. Ich grüße Sie herzlichst!
Brunet.«
Toussaint schrieb später: »Um acht Uhr traf ich im Haus des Generals ein. Nachdem er mich in ein Zimmer geführt hatte, entschuldigte er sich, daß er mich einen Augenblick allein lassen müsse, und ließ einen Offizier rufen, um mir Gesellschaft zu leisten. Er war kaum gegangen, als ich brutal gefesselt und hinausgezerrt wurde …«
Zwischenspiel
In Paris bezog Jérôme seine alte Wohnung in den Tuilerien; Feste, Empfänge, Bälle, Assembleen wechselten auf seinem Kalender, er hielt es nicht ohne Trubel aus, ohne Bewunderung, und natürlich war es unumgänglich, sich einen neuen Anzug beim ersten Pariser Schneider machen zu lassen, halb Uniform eines Fähnrichs zur See, halb Hofkleid mit Seidenhosen. Er kaufte die kostbarsten Schmuckstücke für seine Freundinnen, zog Wechsel auf den Bankier Bourrienne, der mit den »Hoflieferanten« ein Abkommen getroffen hatte und sich dafür bezahlen ließ. Sie boten dem »kleinen Verschwender« immer herrlichere Preziosen an, und wenn Napoleon ihn wegen seiner Ausgaben zur Rede stellte, hatte er die nicht mehr ganz neue Ausrede: »Ich liebe eben die schönen Dinge« – eine hübsche Wendung, die nur den Fehler hatte, daß das »gut und schön« der Griechen, von dem Jérôme gewiß einmal im Internat gehört hatte, sich zwar auf die »Schönheit des Guten«, nicht aber in jedem Fall auf »Gutsein des Schönen« beziehen ließ. Leider hatte der große Bruder schon als Konsul eine sehr agile Geheimpolizei eingerichtet, die über Jérômes Unmäßigkeit jetzt haarsträubende Einzelheiten meldete, so daß Napoleon ihn wieder aus Paris entfernte.
Er wurde – ob willig oder nicht – auf der Epervier eingeschifft, die nach den Antillen segelte. Wenigstens setzte er mit sanfter Schmeichelei durch, daß sein Freund aus Saint Domingue, der junge Kapitänleutnant Halgan, die Brigg befehligte. Auch die übrigen Offiziere waren ehemalige Kameraden aus der Kolonie.
Und er wäre nicht Jérôme gewesen, wenn er nicht einige Verzögerungen als unabdingbar notwendig erklärt hätte, Reparaturen am Schiff, Verschönerungen, die Herstellung neuer Wimpel und Fahnen, die er – als Ratgeber und Vertreter des Kommandanten – entwarf. Also Aufenthalt in Nantes – erst mußte ja die Brigg betakelt werden – und endlich Abreise.
Am 28. Oktober erreichte man Saint Pierre de la Martinique. Admiral Villaret-Joyeuse ernannte Jérôme zum Kapitänleutnant, in der Hoffnung, beim Konsul empfohlen zu werden. Und da Halgan krank wurde, meldete sich Jérôme für den Posten des Kommandanten und – bekam ihn.
Napoleon erfuhr zu spät davon, vielleicht dachte er, wie manch anderer von Jérômes Vorgesetzten: »Die Antillen sind weit genug weg …«
Talleyrand, der von der Sache hörte, sagte zu einem seiner Sekretäre: »Dieser Bursche ist anmaßend und ohne Maß!«
Und der, ein gescheiter Mensch, gab zurück: »In unserer Epoche, Exzellenz, wo man die große Gebärde, das Pathos, die Bilder und Symbole im Blut ertränkt hat, fallen die Leute auf jede hohle theatralische Geste herein. Ein hübsches Gesicht und eine modische Frisur, eine gutgeschneiderte Uniform und ein sicheres anmaßendes Benehmen täuschen ihnen das vor, was sie entbehren. Mit ein bißchen Frechheit und savoir vivre ist das meiste getan!«
Der Minister lachte und meinte, einiges an Wissen und Können gehöre doch wohl auch noch dazu; für den Moment und vor dem Hintergrund des brüderlichen Ruhmes möge allerdings das blenden, was Jérôme zu bieten habe.
Dieser Ruhm des Ersten Konsuls wuchs beständig, nicht nur, weil die Nation das Bedürfnis nach »Gloire« verspürte.