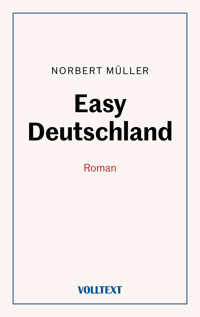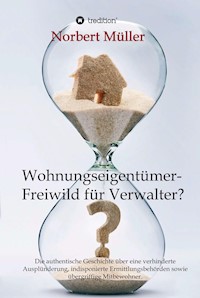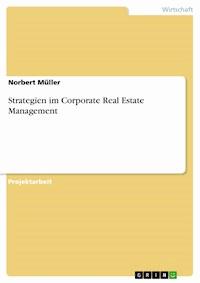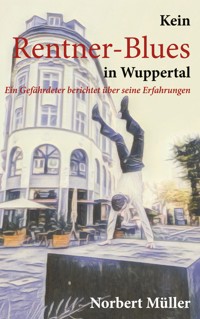
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
"Kein Rentner-Blues in Wuppertal" ist nach - Wohnungseigentümer - Freiwild für Verwalter? das zweite Buch des Autors. Sein Erstlingswerk ist im Stile eines Wirtschaftskrimis geschrieben. Der Medien- und Leser-Zuspruch ermutigt ihn nun, sich seinem zweiten Buch zu widmen. In diesem geht es um seine Ängste, die ihn vor dem "drohenden" Renteneintritt plagten. Mit "Kein Rentner-Blues in Wuppertal" ermöglicht der Autor einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Ehrenämter, die ihn vor Langeweile und Depression bewahrt haben. So berichtet er über sein jahrelanges Engagement als Verwaltungsrat eines bekannten Fußball-Vereines. Hier setzt er sich kritisch mit den Unzulänglichkeiten dieses Aufsichtsorgans auseinander. Weiterhin gibt er Einblicke in die Aufgaben eines Schöffen am Gericht, eines Prüfers an der IHK, sowie in den spannenden Tätigkeitsbereich eines Dozenten in der Erwachsenenbildung. Und "last but not least" wie er letztlich zum Buchautor wurde. Hier nutzt er nun auch die Gelegenheit, über seine Erfahrungen nach Erscheinen seines Erstlingswerkes einen Nachtrag liefern zu können. Seine Erfahrungen und Erlebnisse gibt der Autor mit der Absicht weiter, vielen seiner "Rentner-KollegenINNEN" Anregungen zu verschaffen, ihr Dasein erfüllender gestalten zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“
(Wilhelm von Humboldt)
Inhalt
Einleitung
Muss dieses Buch sein?
Verwaltungsrat beim Wuppertaler SV
Mit Naivität, aber viel Euphorie ging es an die Aufgabe
Wie begann es für mich beim Wuppertaler SV?
Ich stelle mich auf der Mitgliederversammlung zur Wahl
Der Geldgeber aus alten Zeiten kommt zurück
Eine nicht rechtsgültige Wahl und der Gang vors Gericht
Mit Peter Neururer kommt Glanz in den Verein
Der wieder vollständige Verwaltungsrat nimmt seine Arbeit auf
Die Tabelle lügt nicht
Nun auch noch das: Peter Neururer schmeißt hin
Ein problematisches Rollenverständnis
Auf der Suche nach einem neuen Trainer
Unsere Nachlässigkeit fällt uns auf die Füße
Wir sind in der Pflicht und müssen handeln!
Welche Optionen zur Problemlösung hat der Verwaltungsrat?
Ein weiterer Verlust muss verkraftet werden
„Der Verwaltungsrat tut ja nichts!“
Welche Handlungsoptionen hatte der Verwaltungsrat?
Nun gab es für mich nur eine Konsequenz: Rücktritt!
Termin Jahreshauptversammlung 7.11.23 und meine Anträge
Tag der Mitgliederversammlung
Und ewig grüßt das Murmeltier
Nun sind es die „Strukturen“ …
Der Wuppertaler SV braucht ein neues Gesicht!
Wie blicke ich auf meine Zeit im Verwaltungsrat zurück?
Ich und „Dozent“, wie kann das sein?
Ich bekomme eine Chance
Mein erster Unterrichtstag
Ein weiteres Unterrichtsfach bereichert mich
Eine weitere Akademie bietet mir eine Chance
Corona erfordert eine neue Art des Unterrichtens
Noch ein Fach und andere Schüler*innen
Welche Fächer kann man unterrichten?
Was mich motiviert
Warum ich 2021 Buchautor wurde
Ein Zufall hilft mir weiter
Ich halte tatsächlich mein erstes Buch in den Händen
Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit
Das Fernsehen kommt für Filmaufnahmen vorbei
Es gibt ja noch die LIT.ronsdorf
Dann mache ich eben meinen eigenen Karnevalszug
„DIE ZEIT“ adelt mich!
Ein Phänomen, das ich bis heute nicht verstanden habe
Wir verlieren den Prozess um diese SAT-Schüssel, die angeblich …
Scham ist für einige Menschen ein Fremdwort
Hat mein Buch irgendetwas bewegt?
Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer Wuppertal
Was ist die Aufgabe der Prüfer*innen, z. B. bei der IHK
Ein ganz besonderes Erlebnis
Schöffe am Landgericht Wuppertal
Wie wurde ich nun Schöffe?
Mein erster Einsatz und weitere als Schöffe
Schlussbemerkung
Danksagung
Einleitung
Hätte ich doch vorher gewusst, wie spannend sich mein Rentnerdasein – entgegen meiner Befürchtungen – entwickeln würde, dann wäre ich schon gleich nach der Lehre in die Rente gegangen und hätte mir damit einige Angstattacken erspart.
Dieser nicht ganz ernstzunehmende Ausspruch meinerseits ist immer meine Antwort auf die Frage, wie es mir als Rentner denn geht. Besonders häufig gestellt von ehemaligen Kolleg*innen, und zwar deshalb, weil sie mich vor sechs Jahren mehr oder weniger aus der Firma tragen mussten. Während ein nicht unerheblicher Teil meiner damaligen Kolleg*innen gefühlsmäßig seit dem dreißigsten Lebensjahr dem Renteneintritt entgegenlechzten, gehörte ich zu der Minderheit, die mit Grauen diesem Zeitpunkt entgegensah.
Sie lesen richtig: Ich hatte richtig Angst vor dem Tag, an dem gewohnte Tagesabläufe enden und ich nicht mehr gebraucht und – vor allen Dingen – gefragt sein würde.
Ich kann jeden verstehen, der einen Beruf mit enormer körperlicher Belastung ausübt und schon aus diesem Grunde den Renteneintritt als das Ende der Qualen ansieht. Nur war ich als Key-Account-Manager ein „Bürohengst“ mit vielfältigen Möglichkeiten, diesem Büroalltag durch Geschäftsreisen zu entgehen. Dazu war ich Teil eines tollen Teams, und ein gut aufgebauter und ertragreicher Kundenstamm machte nicht mehr die Arbeit vergangener Tage. Es war eher „Ernte einfahren“ angesagt als „Urwald roden“.
Da hätte ich es noch Jahrzehnte aushalten können. Nur eben Melanie nicht, meine Trainee, die nun schon seit fast drei Jahren mit mir durch die Kundschaft tingelte und endlich allein die Verantwortung übernehmen wollte. So gern sie wohl auch mit mir auf „Tournee“ war, wurden unsere Geschäftsreisen doch von ihrer Seite immer mehr zum „betreuten Fahren“.
Mir war klar, dass ich über die vertragliche Grenze von 65 Jahren und 5 Monaten hinaus nicht bleiben konnte. Die hatte ich schon für mich großzügig ausgelegt, denn eigentlich hätte ich schon mit 65 Jahren ohne Abzug gehen können. Je näher der Termin also rückte, umso mehr fragte ich Kolleg*innen, die entweder vorher oder zeitgleich mit mir zur Pensionierung anstanden, welche Pläne sie denn für die Gestaltung ihres Rentnerdaseins hätten.
Wer mir da nicht alles von Hausrenovierungen und „endlich mal den Garten in Ordnung bringen“ oder „lange Reisen machen“ erzählte. Demnach dürfte es in unserem Lande kaum noch renovierungsbedürftige Häuser und keine verwilderten Gärten mehr geben. Und, wer die Flughäfen und Autobahnen verstopft, ist mir jetzt auch klar.
Ich hatte in Ermangelung eines eigenen Hauses und somit auch Gartens keine adäquaten Pläne, zumal mir, was handwerkliche Fähigkeiten angeht, jedes Talent fehlt. Ich bin da eher der Generalist: also viel Breite, aber wenig Tiefe, wenn man die Tatsache, dass man eigentlich nichts richtig kann, aber überall mitredet, mal so freundlich umschreiben möchte.
Da meine Frau ein paar Jahre jünger ist als ich, war es mit langen Reisen auch erst einmal nichts. Rund drei Jahre musste ich „einsam“ überbrücken, obwohl meine Frau nicht meinen Ehrgeiz hatte, erst zum letztmöglichen Termin Rente zu erhalten.
Sie nahm schon die Möglichkeit des vorgezogenen Renteneintritts wahr, was für mich aus damaliger Sicht die Verkürzung meiner wohl unvermeidlichen Depressionsphase auf maximal drei Jahre bedeutete. Dass alles ganz, ganz anders kam, konnte ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht ahnen, sonst wäre ich „bereits nach der Lehre direkt in Rente gegangen“. Mittlerweile ist mir auch bekannt, dass ich mit meinen Ängsten nicht allein war. Durch Recherche zu diesem Buch kam ich auch darauf, dass meine Ängste mehr waren als bloße Spinnerei. Am Ende des Buches zitiere ich aus einem Interview im „Stern“, und durch dieses wurde mir mehr klar, als ich vorher wusste. Unter anderem war diese Erkenntnis Teil meiner Inspiration und somit Idee für dieses, mein zweites Buch.
Mit diesem Buch möchte ich meinen Leser*innen, die vielleicht auch von einem baldigen Renteneintritt „betroffen“ sein werden, ermöglichen, vorher einmal einen Blick „hinter die Kulissen“ mir bekannter Institutionen oder Organisationen werfen zu können, ist doch ein soziales Engagement geradezu gesundheitsfördernd. Dadurch kann man sich dann ein Bild machen und entscheiden, wie man sich wann und wo einbringen möchte – oder auch nicht. Mir haben die Ausübung dieser Ehrenämter sowie meine Tätigkeit als Dozent und Buch-Autor auf jeden Fall geholfen, meinen letzten Lebensabschnitt als erfüllend zu erleben.
Bieten kann ich spannende Einblicke in die Strukturen und verschlungenen Wege eines bekannten Fußball-Vereins, in die Aufgaben eines Prüfungsausschusses an einer IHK und ins Schöffenamt. Also alles Ehrenämter, die jeder ausüben kann und die außer Erfahrung, wenn es gut läuft, auch etwas Anerkennung einbringen können. Darauf aber bitte nicht im Voraus wetten! Darüber hinaus geht es um den Bereich der Erwachsenenbildung und somit das vielfältige Aufgabengebiet eines dort tätigen Dozenten, wobei ich schon vorwegnehmen möchte, dass ich hierin meine persönliche Erfüllung gefunden habe.
Last but not least beschreibe ich meinen nicht minder spannenden und interessanten Weg zum Buch-Autor, den nicht nur ich in den Bereich, dass es heute noch Wunder gibt, einordnen würde. Von einigen Leser*innen meines Erstlingswerkes Wohnungseigentümer – Freiwild für Verwalter? darauf angesprochen, ob es eine Fortsetzung dieser von mir niedergeschriebenen Geschichte geben würde, kann ich insofern beantworten, dass es einige interessante Entwicklungen gab. Diese gebe ich in einem Kapitel dieses Buches wieder, denn für eine separate Publikation hätten sie nicht gereicht.
Mit diesem Buch möchte ich Sie als Leser*in ermuntern, über machbare Aktivitäten nachzudenken. Ich hoffe, ich kann durch spannende Einblicke die ein oder andere Leserin, den ein oder anderen Leser neugierig machen. Alle geschilderten Erlebnisse entsprechen der Wahrheit, und die Zusammenhänge wurden von mir so geschildert, wie ich diese in Erinnerung habe.
Auf individuelle Persönlichkeitsrechte nehme ich so weit Rücksicht, wie die genannten Personen nicht schon durch andere Publikationen oder die Art ihrer jeweiligen Funktionen öffentlich bekannt sind. Ich habe mich bemüht, die Ereignisse so zu schildern, dass diese nicht unmittelbar den jeweiligen Personen zugeordnet werden können.
Dass die Schilderungen über meine Erlebnisse beim Wuppertaler SV einen sehr großen Raum einnehmen, ist der Tatsache geschuldet, dort zeitlich lange, und dann auch noch sehr umfangreich engagiert gewesen zu sein. Die emotionale Bindung und Betroffenheit kommen dann noch hinzu und diese konnte ich nicht immer unterdrücken. Die von mir eingestreute Ironie bitte ich zu verzeihen, da ich dieses Buch nicht als Sachbuch, sondern mehr als Biografie verstehe. Da die Erfahrungen, die ich als Verwaltungsrat beim WSV, also dem Wuppertaler SV, gemacht habe für mich prägend waren, ist zumindest für mich ein Schuss Emotionalität unerlässlich. Darüber hinaus möchte ich sowohl den Fans des WSV als auch allen Interessierten an einem solchen Amt ungeschminkte Einblicke ermöglichen. Inwieweit diese WSV spezifisch sind, kann ich nicht beurteilen; glaube ich aber nicht.
Meine Hoffnung ist auch, durch meine Schilderungen wieder einen Diskussionsprozess über Konzepte und Pläne sowie die Gründe, warum von diesen nichts umgesetzt worden ist, anstoßen zu können.
Mir ist allerdings bewusst, dass jede kritische Betrachtung und Beurteilung der Ereignisse in der Vergangenheit damit gekontert werden kann, dem Verein nicht schaden zu dürfen. Ich bin aber der Meinung, dass nur durch Reflektion und Diskussion wieder positive Impulse erzeugt werden können. Auch mir ist nicht entgangen, dass der Verein durch bestimmte Umstände, auf die ich noch eingehen werde, nun gezwungen ist, mit weniger Geld haushalten zu müssen. Ein durch Marvin Klotzkowsky erweiterter Vorstand hat leider das Pech, nun mit der Hypothek, die meines Erachtens vermeidbar war, arbeiten zu müssen. Dass ich dem Verein nicht schaden will, sondern eher das Gegenteil der Fall ist, wird sich hoffentlich nach der Lektüre meines Buches herausstellen.
Außerdem sind wir Wuppertaler schon genetisch bedingt rebellisch und legen gerne Finger in Wunden. Wenn man dies berücksichtigt, werden viele Schilderungen bestimmter Abläufe eher verständlich.
Ich bin Lokalpatriot und mache gerne darauf aufmerksam, dass ich stolz darauf bin, aus der Stadt zu kommen, die einst die „Barmer Erklärung“, das theologische Fundament der Bekennenden Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus, hervorgebracht hat und in der Ferdinand Lassalle seine berühmte „Ronsdorfer Erklärung“ verkündete, welche den Grundstein für den Deutschen Arbeiterverein als den Vorläufer der späteren SPD legte. Dass Friedrich Engels, den ich hoffentlich nicht erklären muss, auch aus Wuppertal stammt, möchte ich ebenfalls erwähnen. Wo einer der weltgrößten Chemiekonzerne, nämlich Bayer, seine Wurzeln hat, sollte auch nicht unterschlagen werden. Und der Thermomix wurde, na wo wohl, erfunden?
„Der“ Wuppertaler, den es eigentlich nicht gibt, sondern nur den Barmer, Elberfelder, Ronsdorfer, Cronenberger usw., ist ein besonderer Menschenschlag. Ich erwähne dies, weil Sie später in meiner Geschichte über den Verein sehen werden, dass angeblich die Unterstützung aus der Region gefehlt habe und daher der gewünschte Erfolg im Verein ausbleiben würde. Nur steht dem entgegen, dass „der Wuppertaler“ ein Meister des bürgerlichen Engagements und mit viel Erfindergeist ausgestattet ist. „Kreativität“ ist quasi der zweite Vorname jedes Wuppertalers, jeder Wuppertalerin.
Dann besitzen wir auch die meisten innerstädtischen Parks in Europa, die schon vor weit über hundert Jahren durch Gönner der Stadt privat finanziert wurden und heute noch, z. B. durch den Barmer Verschönerungsverein, unterhalten werden.
Die „Wuppertalbewegung“ hat eine ehemalige Bahnstrecke, die „Nordbahn-Trasse“, durch Bürgerinitiative und überwiegend durch Spenden zu einer der schönsten und wohl längsten innerstädtischen Radstrecken umgebaut. Aus dieser „Wuppertalbewegung“ ging dann später auch „Circular Valley“, eine Initiative mit dem Ziel, die erweiterte Metropolregion Rhein-Ruhr zum globalen Zentrum der Kreislaufwirtschaft aufzubauen, hervor. Wuppertal ist damit ganz weit vorne, wenn es um Zukunftsthemen geht.
Ich könnte noch weitere Beispiele nennen, um deutlich zu machen, wozu Wuppertaler in der Lage sind, wenn sie denn wollen. Man muss sie halt nur für eine Sache begeistern, und das ist dem Wuppertaler SV aus vielerlei Gründen bisher nicht so richtig gelungen.
Wenn ein Wuppertaler, wie z. B. der Gründer der Wuppertalbewegung, Carsten Gerhardt, eine Vision hat, dann kommen die Wuppertaler ins Rollen und sie stellen richtig was auf die Beine. Nur, wenn du keine Geschichten erzählen kannst, sie nicht mit auf „eine Reise“ nimmst, sondern immer nur die alte Leier wiederholst, dann bleiben die Wuppertaler zuhause.
Muss dieses Buch sein?
Es war ein Wochentag im Mai, der Hinweis „Wochentag“ ist wichtig, sind an solchen doch fast ausschließlich Rentner*innen in der Nähe eines Friedhofes sichtbar. So auch an jenem Tage, an dem ich nach langer Zeit mal wieder Peter M., einen Mitschüler aus der Schule, traf. Peter war in der Klasse unter mir gewesen, aber demnach auch schon drei Jahre als Rentner unterwegs. So ergab sich die Frage danach, wie er denn so seine Tage verbringe, außer schon einmal nach einem geeigneten Plätzchen auf dem Friedhof Ausschau zu halten, fast von selbst.
Peter erzählte sofort lebhaft davon, wie viel er mit dem Rad unterwegs sei und fotografieren würde – sehr zum Leidwesen seiner Frau, die immer beklage, er wäre zu selten zuhause. „Und, was machst du so?“, war die Gegenfrage, die mir immer aus einem bestimmten Grunde peinlich ist! Nun ja, ich arbeite noch als Dozent in der Erwachsenenbildung, bin Verwaltungsrat beim WSV, Prüfer bei der IHK und ab und an als Schöffe tätig. Ach so – bevor ich es vergesse: Ich habe noch ein Buch geschrieben. Das, in welchem Sie jetzt lesen, war da nicht gemeint. Peter schaute mich an und meinte trocken: „Norbert, ich muss sofort nach Hause und meiner Frau erzählen, was andere Rentner so machen. Die wird jetzt nie mehr behaupten, ich hätte zu viel zu tun“.
Ich wollte meine Tätigkeiten sofort relativieren und erklären, dass ich nur im Schnitt 2–3 Samstage im Monat und im April/Mai und September/Oktober jeweils noch fünfzehn Wochentage unterrichten würde, Prüfer wäre ich nur im Frühjahr und Herbst für wenige Tage, Schöffe auch nur wenige Male im Jahr. Und das Buch sei schon längst im Handel. Gut, mein Engagement als Verwaltungsrat beim WSV war schon etwas zeitintensiver und das konnte ich, Peter hatte das bestimmt schon aus der örtlichen Presse mal mitbekommen, nicht kleinreden. Peter interessierte das aber nicht, sondern allein die Aussicht, seiner Frau zu erzählen, wie man sein Rentnerdasein auch ausleben könne, verlieh ihm einen regelrechten Adrenalinschub. Dennoch wollte er wissen, wie ich denn an alle diese Jobs gekommen sei. Unwissentlich wurde Peter damit zu einem Initiator für mein zweites Buch, nämlich dieses, in welchem Sie gerade lesen!
Ein weiterer war mein Sohn, der mir von einer Kollegin erzählte, deren Mann seit kurzer Zeit auch Rentner sei. Sie befürchtete, er würde in absehbarer Zeit mit der Couch verwachsen, um letztlich mit dieser eins zu werden. Sein Dasein sei durch den ganztägigen Konsum diverser privatrechtlicher Fernsehprogramme gekennzeichnet und sein Bewegungsradius beschränke sich auf den Weg von der Couch zur Küche, mit gelegentlichem Abbiegen zum Klo, da zumindest sein Darm noch ein gewisses Maß an Aktivität beibehalten habe. Nachdem mein Sohn seiner Kollegin davon berichtete, wie sein Vater, sprich: ich, seinen Tag so ausfülle, war damit sicherlich ein Sprengsatz für das Ende einer langjährigen Ehe gelegt.
Keineswegs will ich allerdings den Eindruck aufkommen lassen, mir ginge es darum, hier genervten Ehefrauen ein Handbuch für die Aktivierung ihrer Ehemänner an die Hand zu geben, aber als „Wink mit dem Zaunpfahl“ kann es schon taugen. In diesen Kontext passt allerdings meine, nicht wissenschaftlich untermauerte These, dass Frauen ihr Dasein als Rentnerinnen doch erfüllter gestalten. Vielleicht liegt das schlichtweg daran, dass viele Frauen neben dem Berufsleben schon immer einen zweiten Arbeitsplatz – den Haushalt – hatten, der weiterhin Bestand hat. Grundsätzlich glaube ich allerdings auch, dass Frauen eher in der Lage sind, sich schneller auf neue Situationen einzustellen.
Sicherlich geht es mir auch darum, den Blick der jüngeren Generationen auf „Rentner*innen“ etwas differenzierter zu ermöglichen. Gerade habe ich im „Spiegel“ einen Artikel mit dem Titel „Eine graue Masse, die Jüngere fast mit Ekel erfüllt“ gelesen und war geschockt, wie undifferenziert Rentner*innen häufig wahrgenommen werden. Man wird mir hoffentlich verzeihen, dass ich mich dort in keiner Weise angesprochen fühle und schon aus dem Grunde einmal schildern will, wie ein Rentnerdasein auch aussehen kann. Vielleicht ist das ja ein Anstoß für manche „Kolleg*innen“, sich zumindest Gedanken über Aufgaben zu machen, die sie selbst erfüllen und vielleicht auch noch der Gesellschaft einen Nutzen bringen können.
Geschildert wird in dem genannten „Spiegel“-Artikel dann allerdings auch, dass vielerorts das gesellschaftliche Leben zusammenbrechen würde, gäbe es nicht die vielen Landärzt*innen, Handwerker*innen und Schulbusfahrer*innen, die über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten würden. Was würde alles nicht mehr funktionieren, wenn diese ganzen Heerscharen von ehrenamtlich tätigen Rentner*innen ihre Aktivitäten einstellen würden? Wer die Tafeln in Deutschland am Laufen hält und damit abertausenden Menschen zu kostenlosen Lebensmitteln verhilft, erwähne ich hier noch beispielhaft.
Für die allerdings, die für sich noch nicht die richtige Aufgabe gefunden haben, denen vielleicht die nötigen Einblicke fehlen, denen möchte ich hier mit diesem Buch die ein oder andere Anregung geben. Weniger in die Richtung, was man tun kann, sondern, wie einfach dies sein kann. Der jeweilige Schritt ist, wie ich hoffentlich überzeugend darstellen kann, kleiner als man meint. Wäre dem nicht so, wäre ich da sicherlich auch gescheitert.
Verwaltungsrat beim Wuppertaler SV
Mit Naivität, aber viel Euphorie ging es an die Aufgabe
Wenn ich hinter die Kulissen eines bekannten Fußball-Vereines schauen lassen möchte, dann muss dies ungeschminkt geschehen. Dabei bemühe ich mich, mich auf die Ereignisse zu konzentrieren, die ausschlaggebend für das Ergebnis sind. Im Rückblick betrachtet sehe ich mein über vier Jahre währendes Engagement beim WSV nicht als glorreich an. „Erfolglos“ war es nur in Bezug auf den eigenen Anspruch, Ideen umzusetzen und eine übertragene Aufgabe auch korrekt ausüben zu können. Nicht in Bezug darauf, im fortgeschrittenen Alter reichlich Erfahrungen gesammelt zu haben. Die Frage, warum der eigentliche Erfolg ausblieb, war man doch mit viel Engagement, viel Lebens- und Berufserfahrung, unzähligen Ideen und den allerbesten Absichten gestartet, versuche ich immer noch zu ergründen.
Ich hoffe, es ist mir gelungen deutlich zu machen, dass ich nicht mit meinem Verein hadere, sondern nur mit einem Organ desselben. Bei diesem „Organ“ handelt es sich um den Verwaltungsrat, dem ich selbst angehört habe und zu dem ich nun der Meinung bin, dass hier erheblicher Reformbedarf besteht. Warum, dass versuche ich Ihnen näherzubringen.
Wenn etwas nicht so läuft wie erhofft, muss man – wie im Leben – zurückschauen und sich fragen: Wo ist man falsch abgebogen, wo hätte man anders oder wo früher reagieren müssen? Welche Einflussfaktoren hat man nicht berücksichtigt oder auch nicht gekannt? Davon gab es beim Wuppertaler SV einige. Da fallen mir dann gleich einige Analogien zu meinem Leben ein. Da stelle ich mir heute noch die Frage, was entstanden wäre, hätte ich damals in bestimmten Situationen so oder so reagiert oder anders entschieden. Gab es da überhaupt eine Entscheidungsmöglichkeit? Das kennen Sie sicherlich auch. Ist allerdings nutzlos, weil Chancen selten wiederkommen. Beim Wuppertaler SV stellt sich auch die Frage, ob mein Engagement von vornherein zum Scheitern verurteilt war, weil „ein Verein anders tickt als ein Unternehmen“, um das Credo meines Kollegen Christian S. zu zitieren. Oder bin ich vielleicht mit völlig falschen Erwartungen und somit Vorstellungen in ein Amt „gestolpert“?
Dennoch ging meiner Entscheidung, umfangreich über mein Engagement als Verwaltungsrat beim Wuppertaler SV zu berichten, ein längerer Prozess des Abwägens voraus. Mir liegt dieser Verein weiterhin am Herzen und das Letzte, was ich will, ist, diesem Verein zu schaden. Nur ist ein Verein kein Geheimbund, sondern sollte das genaue Gegenteil davon sein: also offen, transparent, lebhaft und ein Paradebeispiel für demokratisch legitimierte Entscheidungsprozesse. Demnach nicht Hinterzimmer, sondern offene Bühne. Nur so schafft man Vertrauen und nimmt Mitglieder, Fans und Unterstützer mit auf die Reise. Und schreibt vielleicht auch Geschichte.
Auch geht es mir darum, den Vereinsmitgliedern nun noch nachträglich Einblicke zu verschaffen. Da war bisher leider eher „Hinterzimmer“ angesagt. Diese umfassende Aufklärung wurde mir – und damit allen Vereinsmitgliedern – leider auf der letzten Mitgliederversammlung nicht ermöglicht, wie diese angemessen gewesen wäre. Ich hoffe auch, dass dann in Kenntnis der aktuellen Rahmenbedingungen verständlicher wird, unter welchen Bedingungen nun die nähere Zukunft gestaltet werden muss, und ob dies noch verändert werden kann. Wie diese aktuellen Rahmenbedingungen entstanden sind und ob oder welchen Anteil der Verantwortung ich zu tragen habe, versuche ich zu analysieren.
Während ich hier an diesem Buch arbeite, rollt eine Protestwelle durch deutsche Fußballstadien. Tennisbälle und Schokotaler werden geworfen und ferngelenkte Modellautos über das Spielfeld gesteuert, mit der Folge ständiger Spielunterbrechungen. Hintergrund ist, dass die DFL, also die Deutsche Fußballliga, in einem wohl etwas intransparenten Verfahren Vermarktungsrechte an Investoren verkauft hat. Die Fans befürchten eine weitere, unkontrollierbare Kommerzialisierung des Fußballs mit z. B. Spielen abseits deutscher Stadien und deren Verteilung auf weitere Wochentage. Besonders für Empörung sorgte aber, dass wohl Martin Kind, der als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH für den Verein Hannover 96 abgestimmt hat, dies anders getan haben könnte, als dies von seinem Verein, der rechtlich die Mehrheit an der GmbH hält, vorgegeben gewesen sein soll. Da die Abstimmung zugunsten des Investoreneinstieges nur mit einer Stimme Mehrheit erfolgt war, die Abstimmung geheim durchgeführt wurde und Martin Kind auf Fragen bezüglich seiner Stimmabgabe nicht konkret antwortete, ebben die Proteste erst jetzt ab, da der Investoreneinstieg durch die DFL abgeblasen worden ist.
Entschlossen, über meine Tätigkeit als Verwaltungsrat zu berichten habe ich mich auch, weil einerseits Demokratie in den Vereinen beginnt und elementar ist, ich mir hier noch sehr viel Naivität bewahrt habe und ich andererseits ein bedingungsloser Anhänger der Schwarmintelligenz bin. Dass Demokratie in Vereinen nicht immer gelebt wird, musste ich leider feststellen. Ich sehe darin ein großes Problem ist: Wenn es keine organisierte Fanszene mehr gibt, können wir zumindest im Bereich des Fußballs unser Vereinswesen in der aktuellen Form beerdigen. Dann bleiben am Ende nur noch „Retorten-Vereine“ wie RB Leipzig über, und das ist nicht meine Vorstellung davon, was einen Verein, egal mit welcher Zielsetzung, ausmachen sollte.
Mir ist es auch wichtig darzulegen, wie schnell Anspruch und Wirklichkeit auseinanderdriften; warum ich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden bin oder nicht gerecht werden konnte. Bei meiner Kandidatur hatte ich den Mitglieder*innen das Versprechen abgegeben, auf „unseren Verein“ aufzupassen, damit dieser nie mehr in den Abgrund schauen müsste. Hier möchte ich aufzeigen wie einfach es ist, einen Verein wirtschaftlich unter seine Kontrolle zu bringen.
Dann auch, warum eine „Vision“, an die ich mich und einige weitere Kolleg*innen im Verwaltungsrat geklammert haben, derzeit als gescheitert angesehen werden muss und wie viel Zeit, Arbeit und Herzblut dort hinein investiert worden ist. Davon geblieben ist dennoch ein Fundus an Erfahrungen und neuen Erkenntnissen sowie interessantem Input durch hervorragende Experten. Aktuell hat der Verein nichts davon, aber ich habe zumindest dazugelernt. Mit diesem Buch versuche ich zumindest noch Wege aufzuzeigen, wie die Fehler noch „geheilt“ werden könnten, so dies die Mitglieder des Vereins denn wollen. Sollte dies passieren, müssten die, die diese „Vision“ zum Leben bringen wollen, nicht wieder bei null anfangen. Grundlagenarbeit wurde schon geleistet, die Idee ist da: Es fehlen nur noch Menschen, die den Faden wieder aufnehmen!
Wie begann es für mich beim Wuppertaler SV?
Es muss so um die Jahreswende 2018/2019 gewesen sein, als ich mich mit einem damaligen Arbeitskollegen auf ein Bier im „Moritz“ in Wuppertal traf. Beide sind wir Fans des Wuppertaler SV, kurz WSV, und machten uns große Sorgen um das Überleben „unseres“ Vereins. Für die, die sich im Fußball nicht so gut auskennen, hier eine kurze Schilderung über die bewegte Geschichte des Wuppertaler SV: Der Verein entstand 1954 aus der Fusion zweier Vereine aus Wuppertal und schaffte 1972 den Aufstieg in die höchste Spielklasse, die 1. Bundesliga. Bereits im ersten Jahr erreichte man den vierten Tabellenplatz und spielte im damaligen UEFA-Cup auf internationaler Ebene. Der Ausflug in die 1. Bundesliga dauerte leider nur drei Jahre. Günter Pröpper, der „Torjäger des WSV“, wurde 1972 mit 21 Treffern hinter dem legendären Gerd Müller und dem nicht minder bekannten Jupp Heynkes Dritter in der Torjägerliste.
Die Geschichte des Vereins begann nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga sowohl in sportlicher als auch finanzieller Hinsicht „bewegter“ zu werden. Letztlich ging es sogar bis in die Oberliga, also die 5. Liga, hinunter. Aktuell spielt der Verein in der Regionalliga West und versucht hier, um den Aufstieg in die 3. Liga mitzuspielen. Mit rund 1.500 Mitgliedern gehört unser WSV zu den großen Vereinen in unserer Stadt, aber auf jeden Fall ist er der mit der größten Medienpräsenz.
Wie komplex das „Fußball-Geschäft“ ist und warum mein Kollege zum Jahreswechsel 2018/2019 meinte, mich überreden zu müssen für den Verwaltungsrat zu kandidieren, werde ich so gut es geht und möglichst sachlich schildern. Wieviel „Emotionalität“ in diesem Geschäft – oder besser: in diesem Verein – steckt (was ich damals noch nicht überblickt habe), hängt beim Wuppertaler SV mit der Person von Friedhelm Runge zusammen, der 1991 zum Präsidenten gewählt, und 2013 von einer Initiative WSV 2.0 mehr oder weniger zum Rücktritt gezwungen worden ist.
Ende 2018 war diese Initiative WSV 2.0 mit ihrem Versuch, den WSV ohne das Geld und den Einfluss von Friedhelm Runge wieder zu altem Glanz zu führen, kläglich gescheitert. Bekanntlich „frisst die Revolution ihre Kinder“ und die Anfangseuphorie hatte nicht ausgereicht, um potente Geldgeber aus der Stadt bzw. dem Umland dazu zu bringen, nun spendabler gegenüber dem WSV zu sein.
Interne Machtkämpfe innerhalb der Initiative WSV 2.0 taten dann ein Übriges – und der Verein stand vor der zweiten Insolvenz. Die Vorstände aus dieser „Nach-Runge-Ära“ hatten sich schlichtweg verzockt, und das geht in diesem Geschäft schneller als man schauen kann.
Ein Fußballverein mit einem ausgeprägten Profibereich, und das ist bereits in der 4. Liga der Fall, ist nicht wie ein normales Unternehmen zu finanzieren, sondern hier gibt es Besonderheiten, die besser zum Poker passen als zu einem Wirtschaftsunternehmen.
Als Wirtschaftsunternehmen habe ich in der Regel so viele finanzielle Mittel oder zumindest Sicherheiten für Kredite, um mit meinem Produkt wettbewerbsfähig gegenüber der Konkurrenz zu sein. Bei einem Fußballverein, wenn man mal von Bayern München, Borussia Dortmund, Leverkusen und Wolfsburg etc. absieht, ist das völlig anders.
Habe ich nicht deren Rücklagen oder „Gönner“ im Hintergrund, muss ich trotzdem bereits im März damit beginnen einen Kader zusammenzustellen, Verträge zu schließen und somit Verbindlichkeiten aufzubauen, ohne zu wissen, wie dieser Kader dann performt, wie viele Zuschauer dadurch ins Stadion gelockt werden.
Ob diese Einnahmen reichen, um alle Verbindlichkeiten bedienen zu können, gehört dann in das Reich der Spekulation. Weiterhin weiß ich dann auch noch nicht, wie viele Sponsoren sich mit wieviel Geld engagieren werden. Bin ich Bayern München oder der BVB und spiele Champions League, dann kann ich schon einmal mit ein paar sicheren Milliönchen kalkulieren. Sollten die Einnahmen bei einem normalen Verein nicht so fließen wie notwendig, dann habe ich nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen die Möglichkeit, meine Personalkosten durch betriebsbedingte Kündigungen zu reduzieren, weil Fußballer Zeitverträge haben, bei denen eine solche Kündigungsbegründung nicht anwendbar ist.
Zu dem Zeitpunkt, an dem ich mit dem Kollegen im „Moritz“ in Barmen saß, war das eingetreten, was passiert, wenn man groß in den Kader investiert, ohne dass diese Ausgaben durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind.
Die Kampfansage des damaligen Vorstandes war, den WSV mal wieder in der „Sportschau“ sehen zu können. Tragisch wurde es, als man zur Abwendung einer Liquiditätslücke von 130.000 Euro ein Crowdfunding initiiert hatte und – nachdem die Fans die Summe zusammen hatten – erst feststellte, dass weit mehr fehlte als dieser sechsstellige Betrag. Der für dieses Fiasko verantwortliche Vorstand machte sich daraufhin aus dem Staub bzw. trat zurück, womit er den Verein in ein Chaos stürzte. Teile des Verwaltungsrates taten es ihm gleich. Nur dem Verantwortungsbewusstsein der verbliebenen Räte und derjenigen, die neu in das Gremium berufen wurden ist es zu verdanken, dass der WSV die Nase noch etwas über Wasser halten konnte.
Dieses Gremium, sprich: der Verwaltungsrat, nahm Kontakt zu Alexander Eichner, einem ehemaligen Vorstand aus der Initiative WSV 2.0, auf und dieser zeigte sich bereit, zusammen mit Melanie Drees den neuen Vorstand zu bilden. Somit war der Verein zumindest rechtlich wieder handlungsfähig. Dies war nun die Ausgangssituation zum Jahreswechsel 2018/2019 und der Anlass des Kollegen, mir nahezulegen, für den Verwaltungsrat, dessen Wahl für März 2019 anstand, zu kandidieren. Der Kollege wusste, wie ich mit mehreren Mitstreitern einen schweren Betrugsversuch in unserer Wohnungseigentümergemeinschaft verhindert und damit deren Bankrott mit abgewendet hatte.
Aus dieser Geschichte wurde dann später mein erstes Buch, und für den Kollegen stand fest, dass ich der richtige Mann für den WSV in dieser Notlage sei. Er meinte, ich sei jemand, der, wenn er von einer Sache überzeugt ist, sich von nichts oder niemand abhalten lässt. „Halb zog sie ihn, halb sank er hin“, um es mit den Worten eines Kollegen, nämlich Goethe, zu sagen, war das Ergebnis des Werbens für meine Kandidatur. Wie dieser „Arbeits-Kollege“ dies, der richtige Kandidat für den Verwaltungsrat zu sein, später sehen würde, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht einschätzen.
Die Aufgabe eines Verwaltungsrats lässt sich wie folgt auf den Punkt bringen: Der Verwaltungsrat ist das höchste Gremium des Vereins zwischen den Mitgliederversammlungen. Er vertritt also in den Zeiträumen zwischen den Mitgliederversammlungen die Mitglieder und schützt deren Interessen. Die Betonung auf „vertritt zwischen den Mitgliederversammlungen…“ ist wichtig, hatten das einige Kollegen doch nicht so auf dem Schirm!
Der Verwaltungsrat ernennt den Vorstand, der für das „Tagesgeschäft“ zuständig ist, überwacht dessen Tätigkeit und kann diesen jederzeit ohne Begründung auch wieder abberufen, ist somit der disziplinarische Vorgesetzte des Vorstandes. Genau das, was ein Aufsichtsrat in einer Aktiengesellschaft auch ist oder der Gesellschafter einer GmbH, der den Geschäftsführer ebenfalls feuern kann. Für meine Biografie ist es unbezahlbar, dass ich damit tatsächlich für einige Zeit einmal „formaljuristisch“ gesehen der Chef von Peter Neururer wurde!
Der Vorstand muss sich wesentliche Geschäfte, die in der Vereinssatzung eindeutig definiert sind, vom Verwaltungsrat genehmigen lassen. Dazu zählen z. B. die Aufnahme von Krediten, die Genehmigung eines Wirtschaftsplanes und die Genehmigung nicht-alltäglicher Geschäfte. Hier soll dem Vorstand „permanent auf die Finger geschaut werden“. Diese Aufgabe im Verwaltungsrat ist somit, wenn man zumindest etwas Ahnung von Bilanzierung hat, was fast jeder mit kaufmännischer Ausbildung, oder einem betriebswirtschaftlichem Studium haben müsste, kein Hexenwerk. Heute weiß ich, dass dies in einem Verein anders interpretiert und teilweise auch gelebt wird als in einem Wirtschaftsunternehmen. Sehr gut ist mir noch in Erinnerung, dass auf einer Mitgliederversammlung der damalige Belegprüfer des Verwaltungsrates den Mitgliedern versicherte, keine Unregelmäßigkeiten entdeckt zu haben. Zu dem Zeitpunkt war der Verein bereits mit 700.000 Euro überschuldet und das war nicht aufgefallen. Auf meine damalige Frage, warum die Verschuldung nicht bemerkt worden sei, wurde geantwortet, dass man durch die Menge der Unterlagen nicht mehr durchgeblickt habe. Dies zeigt das Problem: Wenn Rechnungswesen nicht zur Kernkompetenz gehört, dann hat ein Vorstand mehr oder weniger freie Hand.
Sollten Sie jemals eine Prüfung durchführen, sei es im Verein oder Kegelclub, lassen Sie sich zumindest die letzten Bankauszüge zeigen. Dort sieht man, wie es um den Verein tatsächlich steht, ob das Konto im negativen oder positiven Bereich geführt wird. Und sollte es ein separates Darlehnskonto geben, müssen ja irgendwo die Tilgungsraten abgebucht werden.
Hätte man den Mitgliedern damals bereits die tatsächliche Finanzsituation offenbart, wäre zumindest theoretisch noch ein Gegenlenken möglich gewesen. Insofern trägt der damalige Verwaltungsrat an der dann später erfolgten Insolvenz eine erhebliche Mitschuld. Ich erwähne dies, weil einige dieser Kollegen daraus nichts gelernt haben und wieder im aktuellen Verwaltungsrat sitzen.
Konkret weiß ich es nicht mehr, wie ich Kontakt zu Alexander Eichner bekommen habe. Das ist aber auch nicht so „kriegsentscheidend“. Jedenfalls telefonierten wir miteinander und ich muss eingestehen, dass ich von seiner Persönlichkeit, und dies bereits am Telefon, beeindruckt war. Weitere Kontakte im Vorfeld der Mitgliederversammlung und somit der Wahl zum Verwaltungsrat änderten nichts daran.
Anders verhielt sich das mit seinem „Sidekick“, den ich hier nur so nennen möchte. Der erste Kontakt zu diesem war nicht nur für mich speziell und einprägend. Wir Kandidaten hatten uns im Vorfeld, um unsere gegenseitigen Standpunkte abzugleichen und so etwas wie eine Strategie zu entwickeln, zu einem Treffen verabredet. Wir waren so um die zehn Personen und der „Sidekick“ hatte seinen Auftritt. Wie eine Diva betrat er – erst einmal mit angemessener Verspätung und dann grußlos – den Raum, ließ seinen Blick schweifen und musterte jeden, zumindest diejenigen, die ihm nicht bekannt waren.
Was bei seinem Auftritt fehlte, waren auf jeden Fall Schalmeien-Bläser. Diese hätten den Auftritt dann so richtig perfekt und rund gemacht. Eingangs habe ich darauf hingewiesen, dass ich stellenweise auf Ironie nicht verzichten konnte. Hier sehe ich diese als angebracht an, war dies doch nicht nur für mich der Augenblick, an dem ich begriffen hatte: Meine Vorstellung eines Verwaltungsrates war nicht kompatibel mit der von Sidekick. Das, was ich mir vorstellte, war zumindest für den Kollegen nicht interessant. Sidekick stammte auch aus der Initiative WSV 2.0 und kannte aus dieser Zeit Alexander Eichner. Dies allein ist kein Problem; nur wenn die Verehrung schon extreme Formen annimmt, dann schon.
Durch die nachfolgenden Schilderungen möchte ich deutlich machen, warum eigentlich dieser dann später gewählte Verwaltungsrat schon im Vorhinein zum Scheitern verurteilt war. Durch die intensive Verbindung der beiden wurde die Trennung zwischen dem Vorstand, der für das Tagesgeschäft zuständig ist, und dem Verwaltungsrat, der den Vorstand zu kontrollieren hat, ad absurdum geführt. Angehörige meiner Generation kennen sicherlich noch Herbert Wehner, den Fraktionschef der damaligen SPD zu Zeiten des Bundeskanzlers Willy Brandt. Da war das Verhältnis so, dass Herbert Wehner dem Kanzler, wenn er es für nötig hielt, auch mal Feuer gegeben hatte. Hier war das anders: Statt Feuer kam nur Balsam zum Einsatz.
Die beiden Freunde hatten eine Aufgabenteilung und eine Agenda, aber nicht die Absicht, uns einzuweihen und wenn, dann war klar, wer Regie führen würde. Nun ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Vorstand eine Agenda hat, im Gegenteil: Man sollte genau das erwarten. Nur darf diese nicht zur geheimen Kommandosache erklärt und dem Aufsichtsorgan vorenthalten werden.