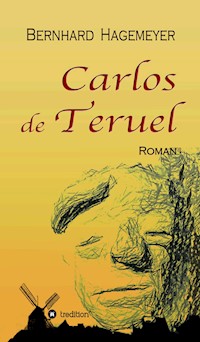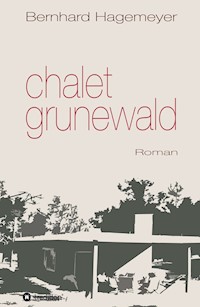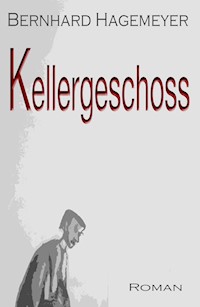
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kellergeschoss - keine bautechnische Anleitung, kein Immobilienangebot, vielmehr Ort des Vergessens, die verborgene, dunkle Kehrseite verbannter Erinnerungen an eine Zeit in einem geschundenen Land: Argentinien Mitte der 1970er Jahre. Bernhard Hagemeyer erzählt in seinem neuen Roman vom Schicksal des Politikberaters Felix Krauthner, der im Oktober 1975 im Auftrag der Bundesregierung von einem Bonner Institut nach Argentinien entsandt wird, um im Rahmen deutscher Entwicklungshilfepolitik einen Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie zu leisten. Er erwartet von seinem Auslandseinsatz nicht nur einen Karrieresprung. Voller Lebensfreude, gemeinsam mit seiner jungen Familie, will er sich einen Jugendtraum erfüllen. Ohne genau zu wissen, worin dieser bestehen könnte, begibt er sich auf die Reise nach Buenos Aires in der Hoffnung, der Weg entstehe im Gehen: Die Zukunft gehört jenen, die an ihre Träume glauben. Der argentinische Projektpartner, ein Institut zur Aus- und Weiterbildung von politischen Führungskräften, wurde ihm als kompetent und vertrauenswürdig beschrieben. Hier jedoch steht der persönliche Zugriff auf deutsche Entwicklungshilfegelder im Mittelpunkt des Interesses. Krauthner trifft eine folgenschwere Entscheidung. Im Land herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Konflikte steigern sich ins Unermessliche, als im März 1976 eine Militärjunta die Macht übernimmt. Bonner Direktiven drängen ihn an den Rand des politisch Vertretbaren und des ethisch-moralisch Verantwortbaren. Er sieht sich in seiner Mission verraten und hintergangen. Vergeblich unterstützt er einen demokratisch, sozial-liberal gesinnten Senator: "Wir stehen auf der Seite der Freiheit." Mehr und mehr entwickelt sich sein Traum zum Albtraum. Bedroht, von schweren Gewissenskonflikten geplagt, verlässt er mit seiner Familie fluchtartig, von guten Freunden gerettet, das Land. Zurück in Deutschland überwindet er die verbannten Erinnerungen, indem er sich einem befreundeten Journalisten offenbart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bernhard Hagemeyer
Kellergeschoss
Autor
Bernhard Hagemeyer
geboren 1939 in Bottrop
Dipl. rer. pol.
verheiratet, zwei Kinder
lebt in Bonn
www.book-art.eu
Bernhard Hagemeyer
Kellergeschoss
Roman
Impressum
Bernhard Hagemeyer, Kellergeschoss
© 2018 Bernhard Hagemeyer, Bonn
Umschlaggestaltung, Illustration: book-art.eu
Cover: Studie von Judith Oldekop, Zürich
Rückseite: Buenos Aires, Casa Rosada, Plaza de Mayo
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
E-Book: 978-3-7469-3295-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
MEINER FAMILIE
ZUM POLITISCHEN HINTERGRUND DER EREIGNISSE
In Argentinien herrschen zwischen 1973 und 1976 bürgerkriegsähnliche Zustände. Die demokratisch gewählte Regierung Perón gerät durch gewaltsame Auseinandersetzungen auf offener Straße, Mord und Totschlag, Entführung und Erpressung mehr und mehr in Bedrängnis. 1974 stirbt Staatspräsident Juan Domingo Perón. Seine Frau María Estela Martínez de Perón, bisher Vizepräsidentin, übernimmt die Regierungsgeschäfte. In Wirklichkeit bedient López Rega als graue Eminenz die Schalthebel der Politik. Die innerparteilichen Machtkämpfe zwischen den Erben des Peronismus, den Fraktionen in Partei und Gewerkschaft, der linksextremistischen Stadtguerilla, den Montoneros, auf der einen Seite und der regierungsnahen, ultrarechten paramilitärischen Triple A um López Rega auf der anderen, stürzen das Land ins Chaos. 1976, die Gesellschaft gespalten, übernimmt das Militär die Macht. 1983, am Ende der Diktatur, liegt Argentinien in politischen und wirtschaftlichen Trümmern.
INHALT
Vergangenes ist nicht vergessen
I Krauthners Zeitrechnung
II Gleis eins
III Zwielicht
IV Zug um Zug
V Tango Milonga
VI Avenida Corrientes
VII Spiel der Steckenpferde
VIII Ruf des Wendehalses
IX Margerite im Haar
X Sehr geehrter Herr Brigadegeneral!
XI Flieg, Gedanke
XII Am Ende des Weges
Epilog
Das riskante Manöver empfand Felix Krauthner als nicht erwähnenswert. Kein Wort verlor er darüber. Er stand an der Reling. Hatte er das nicht mitbekommen? Wo war er mit seinen Gedanken?
Ich hatte auf der anderen Rheinseite auf ihn gewartet. Die Hände über den Kopf geschlagen, musste ich mitansehen, wie die Fähre beinahe von einem hochstehenden Frachter gerammt worden wäre.
Nur noch bedingt manövrierfähig, auf dem Weg von Bonn-Plittersdorf nach Oberdollendorf, war die Christophorus II stromabwärts gedriftet. Wie ich später von Karlchen, dem Wirt im Schifferstübchen, erfuhr, hatte sich Treibgut in einer der Schiffsschrauben verfangen. Dem Kapitän sei es mit äußerstem Geschick sowie unter verstärktem Einsatz des noch intakten Ruders gelungen, das Schiff aus einem Müllstrudel zu befreien und an der Anlegestelle Fährstraße festzumachen.
Wir gehen einige Schritte. Auf der Terrasse des Schifferstübchens, romantisch am Oberkasseler Rheinufer gelegen, nehmen wir Platz. Unsere Sakkos hängen wir über Stuhllehnen, klönen und lassen es uns bei Kölsch und Himmel un Ääd gut gehen. Gern schwelge ich in Erinnerungen. Krauthner weniger. Ihn interessiert die Gegenwart. Es ist Christi Himmelfahrtstag, der 27. Mai 1976.
Wenngleich er mir nicht mit einem Kartengruß, geschweige denn einem Telefonat gratuliert hatte, habe ich ihn dennoch eingeladen, meinen vierzigsten Geburtstag aus dem vergangenen Dezember nachzufeiern. Zu der Zeit hatte er sich in Argentinien aufgehalten. Zugegeben, ein infantiler Vorwand. Aber ich muss ihn unbedingt sprechen. Er hat viel zu erzählen. Als ich mich erkundige: „Wie war es in Buenos Aires?“ winkt er mit einer laschen Handbewegung ab und zieht die Mundwinkel nach unten. Wie recht er tat. Wie banal die Frage, wie infam. Ich weiß doch, wie es ihm und seiner Familie ergangen war. Sein Gesicht ist schmal geworden.
Während ich fidelen Touristen zurückwinke, die auf einem Vergnügungsdampfer stromaufwärts fahren, schaut er einem Lastkahn nach. Am Bug steht in großen, weißen Lettern ISABELA. Mit einem Schlag ist seine frühere erfrischende Heiterkeit, seine fröhliche, ich kann sogar sagen sprühende Lebensfreude verflogen. Seine Gedanken scheinen abzuschweifen, sich zu verlieren und mit Bildern zurückzukommen. Die Stimme gesenkt -fast ist es ein Flüstern -beginnt er, den Blick nach unten geschlagen, von persönlich Erlebtem, Ereignissen und Geschehnissen in Buenos Aires zu erzählen. Es scheint, als bräche ein Damm des Schweigens. Aber kaum hat er einige Sätze gesagt, hält er inne, kramt aus der Umhängetasche eine Pfeife, raucht vor sich hin und sagt schließlich gedehnt langsam: „Warum soll ich mich ständig erinnern? Man muss einen Schlussstrich ziehen, um die Gegenwart nicht mit überkommenem Schuldgefühl zu belasten. Strich drunter, verstehst du?“
„Was ist mit dir?“, frage ich.
„Nein, ich will davon nichts mehr hören. Ich finde es beschämend, von tristen Geschichten, von der Vergangenheit nicht loslassen zu können. Es lässt sich nichts ändern.“
Aus früheren Gesprächen glaube ich zu wissen, was in ihm vorgeht, wenn er versucht, sein Empfinden zu verbergen. Dann weiß er nicht, wie er mit Ereignissen umgehen soll, die ihn kaum betreffen. Geschehnisse, mit denen er nichts zu tun hat, bringt er dennoch mit regelrechten Schuldfantasien in Verbindung. So wird es auch jetzt sein. Er hatte mal gesagt, er könne einen Grund dafür nicht finden, nicht umschreiben, geschweige denn erklären. Ob es ein unbewusstes, traumatisierendes Erlebnis ist, das ihn bedrückt? Ich weiß es nicht. Doch ahne ich nichts Gutes.
Jedes Wort bedeutungsvoll betonend, frage ich: „Von welchen Schuldgefühlen sprichst du?“
Er gibt keine Antwort, sitzt mit gesenktem Kopf, seine Pfeife immer wieder erneut ansteckend, nur kurz vor sich hin paffend und bleibt stumm.
„Weißt du noch? Erinnerst du dich?“ Ich lache, um ihn aufzuheitern. „Hast du vergessen, wie wir dich zu Studentenzeiten hier, bei Karlchen in dieser Kneipe, Pulle getauft haben? Du standst kurz vor deinem Examen in Geschichte und politischer Soziologie hier an der Bonner Universität, als du eine Wette gewonnen hattest. Ohne schlucken zu dürfen sonst hättest du eine Runde zahlen müssen, und knapp bei Kasse warst du schon immer -hattest du zwei Flaschen Bier in dich hineinlaufen lassen. Der Notarzt musste dir die Kohlensäure aus dem Magen pumpen und warf dir respice finem, beachte das Ende, an den Kopf. Er könne, wenn du des Lateinischen nicht mächtig genug seiest, ebenso Wilhelm Busch zitieren: Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe! Und ihr habt mich, den bereits Alten Herrn Aloisius Plakermann, Pfaffemötz getauft, weil ich Priester werden wollte. Du weißt es so gut wie ich: Nach einer turbulenten Weiberfastnacht mit Erika hatte ich den Pfaffenrock an den Nagel gehängt. Die Mütze, die rheinische Mötz war geblieben. Lang ist’s her!“
Ich sehe ihn gespannt an, aber er hebt nicht den Kopf, nickt nicht, sagt nichts. Denkt er darüber nach, warum ich ihm schon wieder mit dieser Geschichte komme?
Er fände es lächerlich, wiederholt er, in der Vergangenheit herumzustochern: „Ich will Buenos Aires vergessen. Und du weißt, warum. Wieso quälst du mich damit? Hast du deshalb zum Geburtstagsdrink eingeladen?“
Sofort gleicht sein Gesicht einer verschlossenen Kellertür. Fürchtet er, es könnten Dinge ans Tageslicht treten, die er gern unter Verschluss wüsste? Hat er Angst vor dem Schweigen?
■
Es ist dunkel geworden. Im farbenprächtigen Spiel der untergehenden Sonne hebt sich die schwarze Bonner Stadtkulisse ab vom gleißenden Licht des ruhig dahinfließenden Rheins. Irgendwo schlägt ein Hund an. Ein anderer kläfft wütend zurück. Vom Ufer kriecht nasse Kälte hoch.
Krauthner meint, ein Kölsch könnten wir noch vertragen. Wir ziehen unsere Sakkos wieder an und gehen ins Wirtshaus. Als habe man den Winter über nicht gelüftet, schlägt uns verbrauchte, stickige Kneipenluft entgegen. Karlchen, der Wirt, begrüßt uns, ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen, mit bierfeuchtem Handschlag. Wie gewohnt geht er gegen elf Uhr zu Bett. Die Gäste, die bleiben möchten, wird er bitten, die Zeche aufzuschreiben, anderntags zu bezahlen, beim Verlassen der Kneipe das Licht im Schankraum auszumachen und die Tür hinter sich zuzuziehen.
Unschlüssig, begleitet von einem gequälten Lächeln, kramt Krauthner in seiner Umhängetasche. Wortlos schiebt er mir erst jetzt eine rote Mappe über den Tisch. Als fühle er sich erleichtert, drückt er das Rückgrat durch und sagt mit fester Stimme: „Die kannst du behalten.“
Auf der Mappe steht mit dickem Filzstift geschrieben: Buenos Aires. Ich sehe ihn fragend an. Er antwortet mit einem erstickenden Lachen, das in heiseres Husten übergeht.
Während des oberflächlichen Blätterns in Vermerken und Zeitungsausschnitten, in einem Schreibheft -darauf von flüchtiger Hand notiert: Amsterdam-Kladde -, in Briefen auch mein Brief liegt darunter -fällt mir ein kleines Couvert auf den Fußboden. Ich finde darin einen Zettel: Zerknüllt, weggeworfen, wieder entfaltet.
Umständlich schiebe ich das Blatt zurück in den Umschlag. Mir schießt das Blut in den Kopf.
Die Drohung der Montoneros sei ihm, wenige Tage nach dem Militärputsch, unter die Haustür seiner Wohnung in Olivos geschoben worden, sagt er.
1. Warnung
Movimiento Peronista Montonero
Sección Che Guevara
Jetzt bin ich es, der sich nicht erinnern möchte und schüttle den hochroten Kopf. „Was soll ich damit? Warum zeigst du mir deinen Erinnerungskram? Du willst doch davon nichts mehr wissen!“ Wohl ist mir nicht.
Er blickt verdutzt. Im Aschenbecher klopft er die Pfeife aus, pustet den Rest in den Raum, reibt den Dreitagebart am Kinn und beugt sich zu mir: „Nicht ich, sondern du, Alois Plakermann, mein Freund Mötz, begnadeter Journalist von Beruf, du bist der Schmock, der in der Vergangenheit stochert, stöbert und sie in die Gegenwart holt. Meine Zeitrechnung ist eine andere.“ Er atmet tief durch und redet sich in Rage. „Deshalb gebe ich dir diese verdammte rote Mappe. Schreib, was du willst: Auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Überlieferungen eines Herrn Felix Krauthner und so weiter und so fort. Mein Copyright, Bonn 1976, hast du! Die ISBN gibt dir ein Verlag. Wenn du denn einen findest.“
Da lacht er sich schief. Es ist ein spöttisches, ein überbetont lautes Lachen.
Ich bitte Karlchen um zwei Kölsch. Er, immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen, malt zwei Striche auf den Bierdeckel und verabschiedet sich singend mit „Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit zu gehen …!“
Morgen zahle ich die Zeche.
Krauthner beginnt zu reden. Der Damm bricht endgültig. Nochmals vereinzelte Andeutungen, dann gibt es kein Halten mehr. Die Hände auf den Tisch gelegt, gefaltet, als wolle er beten, hebt und senkt er den Kopf, schaut mich an, wieder weg. Lässt den Blick durch den Kneipenraum schweifen. Gelegentlich unterbricht er seinen Redefluss, trinkt, raucht, macht kurze oder lange Pausen, lacht oder weint. Wenngleich ich viele Fragen hätte, unterbreche ich ihn nicht. Ich notiere Stichworte, gelegentlich ganze Sätze in mein dünnes Notizen-Büchlein, das ich immer bei mir trage, um Gedanken einzufangen, die mir durch den Kopf schießen. Schließlich sage ich nur: „Wir sind ein Stück des Weges gemeinsam gegangen -wenngleich du an einem anderen Ort: Buenos Aires.“
■
Erst am frühen Morgen werden wir das Wirtshaus verlassen, das Licht im Schankraum löschen und die Kneipentür hinter uns zuziehen.
IKrauthners Zeitrechnung
Seit dieser durchzechten Nacht lebe ich in einer merkwürdigen Stimmung. Einmal glaubte ich einen seltsamen Traum gehabt zu haben. Krauthner tat sich schwer, eine steile Treppe hinunterzugehen. Seine gebückte Haltung, den kahlen Kopf eingezogen -in Wirklichkeit trägt er kräftig gewachsenes, rotblondes Bürstenhaar -war weniger der niedrigen Decke, als seinem hohen Alter geschuldet -er ist zwei Jahre jünger als ich! Ich spürte, während ich ihn am Arm stützte, wie sich sein Zittern auf mich übertrug. Mit verschiedenen Schlüsseln öffnete er eine Kellertür. Sie knarzte in den Angeln. Stickiger, muffiger Modergeruch erinnerte an nasskalte Luftschutzkeller. Als er Licht machte, huschte eine Kakerlake über den nackten Fußboden und versteckte sich unter aus der Wand gefallenem Mörtel. Gezielt ging er auf ein Regal zu und schob die Brille auf die Stirn. -Krauthner trägt keine Brille! -Aktenordner und Bananenkisten trugen kein Datum, sondern Namen der Städte, in denen er mal gelebt hatte. Darauf angesprochen, wiederholte er flüsternd -offensichtlich wollte er Hannah und die Kinder nicht aufwecken: „Nicht die Zeit, der Ort bestimmt die Erinnerung. Erinnerung, befreit von Zeit, bestimmt der Ort Schuld und Angst.“ Als er das sagte, setzte er die Brille zurück auf die Nase, zwinkerte mit dem Auge und zeigte ein hohlwangiges, fratzenhaftes Gesicht. Er begann zu weinen, löschte das Licht, und ich sah, wie die Kakerlake zurückkam.
Schweißgebadet wache ich auf, bleiern liegt mein Körper in den Kissen. Auf dem Weg zum Kühlschrank sehe ich auf dem Küchentisch die rote Mappe. Merkwürdig, brumme ich und gehe ins Bad.
■
Von meinem Fenster aus lasse ich den Blick in den blaugrauen Horizont schweifen. Eine Amsel komponiert ein melodisches Guten-Abend-Lied. Es könnte eine beschauliche Ruhe über dem Ennertwald liegen: Stille, so weit das Auge reicht. Doch böse krächzend liefert eine Krähe einem Mäusebussard-Pärchen, das im Segelflug kreisend nach Nahrung sucht, einen beängstigenden Luftkampf. Ist es der Auftakt für diese Zeilen, da ich nunmehr vom Schicksal der jungen Familie Krauthner erzähle?
■
Montevideo, Beginn seiner, wie er es nennt, kleinen, persönlichen Zeitrechnung. Er heuerte 1967 an einem Bonner Institut für Internationale Kooperation, IIK, an, um im südamerikanischen Uruguay seine Sprachkenntnisse zu vervollständigen und Auslandserfahrungen zu sammeln. Nach seiner Rückkehr, so hatte man ihm versprochen, werde man ihm bei seiner beruflichen Planung mit Aussicht auf eine politische Karriere zur Seite stehen. Beruflich unerfahren, hatte er zu sehr vertraut. Nach Montevideo, zwei Jahre später, stand er jedoch vorübergehend ohne sinnvolle Beschäftigung auf der Straße -getreu den Bonner Gepflogenheiten: Die Unverbindlichkeit von Absprachen.
■
Einige Jahre später, am 30. März 1975, erreicht ihn von eben diesem Institut ein Anruf. Krauthner ist, wie sein Vater im westfälischen Platt zu sagen pflegte, von de Klötzkes: sprachlos, bass erstaunt. Geht noch einmal ein Wunsch in Erfüllung, den er lange nicht mehr gewagt hatte zu träumen? Er freut sich unbändig.
Am nächsten Tag verabreden wir uns nicht wie gewohnt bei Karlchen im Schifferstübchen, sondern in Bad Godesberg bei Ria, in einem von mir gern und häufig frequentierten Restaurant, nahe dem Kurpark und dem Bahnhof gelegen. Journalisten aller Schattierungen, Politiker jeglicher Couleur, ehrenwerte und windige Lobbyisten, auch intelligente Zeitgenossen, Intellektuelle und solche, die sich dafür halten und dazugehören möchten, gehen hier ein und aus.
Mir waren ungute Ahnungen gekommen, als er mir am Telefon sagte, welches Institut angerufen hatte. Doch mit einer wegwerfenden Handbewegung schob ich meine Bedenken beiseite. Obschon in Sorge um ihn und seine junge Familie, wollte ich meinem langjährigen Freund Felix keine Steine in den Weg legen und tat, als sei ich begeistert. Ich suchte aber auch meinen Vorteil: Ich recherchierte damals über seltsame Wirtschaftsbeziehungen dieses Bonner Instituts nach Südamerika. Über Korruption, Veruntreuung von deutschen Steuergeldern und Schwarzen Kassen. Dunkle Geschäfte waren ruchbar geworden. Bundestagsabgeordnete schienen verwickelt.
■
Krauthner schnippt mit den Fingern. Ob er nicht ins IIK zurückkommen wolle, habe man ihn gefragt, beginnt er zu erzählen, ehe er Platz genommen hat. Angedacht sei ein Projekt zur Stärkung der Demokratie in Argentinien. Man möchte auf seine überaus wertvollen Kenntnisse, schöpferische Kreativität und umfangreichen Erfahrungen einschließlich seiner hervorragenden Spanischkenntnisse zurückgreifen, die für ein derart anspruchsvolles Vorhaben unerlässlich seien. Er sei, wenngleich noch jung, ein beschlagener Fahrensmann und als Projektleiter prädestiniert.
„Hat er das so formuliert?“, frage ich.
Bedenklich schüttelt er den Kopf. „Na, nicht wörtlich, aber doch fast. Dabei habe ich einen übertriebenen, auch ironischen, vielleicht falschen Unterton herausgehört. Ich weiß nicht.“
„Ein Gesülze, was der Mann am Telefon abgesondert hat. Schmeicheleien -immer ein zwielichtiges Unterfangen!“, gebe auch ich zu bedenken.
Er hält inne, zündet umständlich eine Pfeife an und inhaliert tief.
„Deine Zweifel scheinen berechtigt“, sage ich.
„Auf der anderen Seite -wann bekomme ich nochmals so eine Gelegenheit? Wenn ich ehrlich bin -ich bin begeistert! Hannah wird es weniger sein, fürchte ich.“
■
Ob ich noch ein Kölsch möchte, fragt er nach einem Moment des Schweigens und lacht übers ganze Gesicht: „Journalisten lassen sich doch gern die Hucke volllaufen.“
Ich lehne dankend ab. Wirtin Ria kommt an den Tisch, erkundigt sich nach unserem Wohlergehen, fragt, ob wir etwas zu essen wünschten, die Küche schließe bald.
Wenngleich nicht darum gebeten, stellt sie uns zwei frische Pils auf den Tisch. Wir prosten uns zu, und ich erkläre feierlich mit weit ausladender Geste: „Felix, der Glückliche, überlagert jedes Bedenken. Ein von Glück erfülltes Leben entspricht deinem Vornamen. Das Herz auf der Zunge, immer einen Scherz auf den Lippen, kannst du dich und andere für Dinge begeistern, von denen du glaubst, sie seien Voraussetzung für ein unbeschwertes Leben.“
Ich spüre, wie die alkoholgeschwollenen Worte schwer rüberkommen, doch meine ich feststellen zu müssen: „Das Ansinnen steigert dein ramponiertes Selbstwertgefühl, und es tut dir gut.“
Er lacht mich aus: „Alter Schwede Süßholzraspler!“
Mein Ton klingt spöttisch, vielleicht mitleidsvoll. So bemühe ich mich, freundlich zu gucken. Es sollte ein Lächeln werden. Ich fühle es -es gerät mir zu einem merkwürdigen Grinsen.
Wir hätten uns spätestens jetzt verabschieden sollen. Er hat nicht verstanden, dass ich ihn diskret an seine kleine Zeitrechnung, die Zeit nach Montevideo, erinnern wollte: Bonner Gepflogenheiten. Ramponiertes Selbstwertgefühl.
Er qualmt aus seiner Pfeife vor sich hin wie eine dampfende Lokomotive, allerdings bereit zur Abfahrt.
■
„Pulle, ich habe Verständnis für deine abwägende Haltung. Doch nach allem, was ich weiß, kann ich dich beruhigen. Im IIK ist der übelriechende, moorbraune Sumpf trockengelegt“, sage ich wider besseres Wissen. Dennoch rümpfe ich die Nase und lache etwas zu laut, sodass sich die Nachbarn zu mir umdrehen.
„Das hatte der Mann am Telefon auch gemeint, nur mühsam ein Kichern unterdrückt und süffisant hinzugefügt, im IIK quakten die Frösche derzeit anders.“
Ich bestätige mit einem Kopfnicken und sage: „Es ist nicht leichtfertig, wenn du zusagst. Jetzt hast du ein konkretes Ziel als Projektleiter, Politikberater und Dozent vor Augen, obendrein finanziell gut ausgestattet. Mit einem großen Erfahrungsschatz wirst du heimkehren und der Aussicht auf eine steile berufliche Karriere belohnt werden. Außerdem stellst du dich in den Dienst einer guten Sache: Demokratie. Im Übrigen spukt im Hinterkopf dein Jugendtraum. Was wäre, was ginge dir, was deinen Kindern verloren?“
„Wenn du das sagst! Hannah meint, Zukunft könne man nicht wissen. Nicht einmal erahnen. Und Erfahrungen nur sammeln, hatte sie ironisch hinzugefügt, wie Pilze, Giftpilze aber gemeint. Und du siehst zu sehr die materiellen Ziele. Doch wem sage ich das?“
Was ihn erwarte, sage ich nun wieder etwas skeptischer, das wüsste ich auch nicht: „Du bist ein positiv denkender Mensch, kannst dich gelegentlich um Kopf und Kragen reden - allerdings: Es wird ein Sprung ins kalte Wasser. Bist du wasserscheu?“
„Und wenn im Schwimmbecken kein Wasser ist?“, lacht er zurück, streicht über sein blondes Bürstenhaar und stopft erneut seine Pfeife. Schließlich fügt er nachdenklich hinzu: „Nett gesagt: Moorbraun der stinkende Sumpf. Anders quakende Frösche. Prost Mötz! Auf Buenos Aires -dem neuen Ort in meiner kleinen Zeitrechnung!“
„Auf uns, Pulle!“, sage ich, „möglicherweise wirst du den Amigo treffen.“
Ich wollte das Thema nicht anschneiden. Es war mir herausgerutscht. Ich denke zu sehr an meine Story. Der Chefredakteur in Hamburg drängt. Mit dem Handrücken wische ich den Bierschaum von den Lippen.
„Du meinst den, der mal einen argentinischen Politiker angeschleppt hatte? Der in Buenos Aires eine Zeitung EL CAUDILLO herausgeben und gleich eine ganze Druckerei kaufen wollte?“, fragt er und nickt bedächtig, als wolle er selbst seine Gedanken bestätigen. So unrecht hat er nicht.
Es ist eigentlich nicht Krauthners Art, Fragen zu stellen. Seiner Meinung nach laufen die meisten Antworten ins Leere, hatte er mal geäußert. Und ich hatte geantwortet, er stelle falsche Fragen, weil er die Vergangenheit verdränge. Typisch für ihn war auch jetzt seine Reaktion: „Ach, lass mich mit dem Erinnerungskram in Ruhe“, schimpft er.
■
Ich hatte vorhin recht, als er so dasaß und kräftig an seiner Pfeife paffte: Er will nicht erinnert werden. Und ich hätte es nicht tun dürfen. Beschämt schaue ich zu Boden. Ich möchte nicht, dass er meine Gedanken im Gesicht liest. Mehr genuschelt als gesprochen, meine ich schließlich: „Der Amigo ist untergetaucht, vermutlich in Südamerika, wahrscheinlich sogar in Argentinien.“
Er hat die Antwort nicht richtig mitbekommen, denn just in dem Moment rumpelt auf der Bahnstrecke Koblenz-Bonn ein schier unendlich langer Güterzug vorbei und reißt jedes Wort mit sich.
Krauthner hakt nicht nach, und ich bin mir sicher: Ihn hat die Antwort nicht wirklich interessiert.
IIGleis 1
In dieser Nacht, in Bonn-Muffendorf, angezogen, nur Schlips und Schuhe abgelegt, kriecht Krauthner zu seiner Hannah ins Bett. Er nuschelt mit schwerer Zunge von einer Stunde Null, faselt von reichhaltigen Fertigkeiten, kreativer Schöpfung und warzenschwieligen Fröschen -wenn sie verstehe, was er meine. Ob sie ihn immer noch so wie früher liebe, labert er, bevor ihm die Augen bierselig zufallen.
Sie ist um diese Uhrzeit zu keinem klaren Gedanken fähig. „Morgen scheint die Sonne wieder!“, murmelt sie und dreht sich auf die andere Seite. „Frösche! Ekelhaft!“, ruft sie aus dem Kopfkissen: „Schleimige, die Backen dick aufblasende schwarze Kröten, Fliegenfänger, die in versumpften Mooren quaken. Sie fressen Insekten …“ -sie wirft sich auf ihn - „springen mit ihren schlanken Beinen nach Beute und setzen ihre schmierige Zunge ein, die sie weit ausfahren. Selbst Totenfliegen bleiben daran kleben.“
Krauthner ruht längst in Morpheus’ Armen.
■
Am nächsten Tag, gegen Abend bei einer Flasche Rotwein, greift Hannah den nachtdunklen Faden wieder auf. Ob er sein seltsames Froschgeschwafel etwas erläutern könne, spottet sie und tippt ihm belustigt auf die Nasenspitze.
„Eigentlich möchte ich nicht mit dem IIK“, sagt er, kneift die Augenbrauen zusammen, druckst herum und weiß nicht, sichtlich nervös, wohin mit seinen sperrigen Gedanken. „Aber Mötz meint, wenn …“
„Nebbich, Mötz meint … Warum sprichst du zuerst mit ihm, erst danach mit mir?“
Ob sie nicht einverstanden sei, fragt er zurück, gibt ihr einen Kuss und geht ans Fenster.
„Natürlich, selbstverständlich, komm, lauf nicht weg! Setz dich!“
Hannah steckt mit dem glühenden Stummel einer Zigarette eine neue an, inhaliert tief und gibt zu bedenken, man müsse Erreichtes nicht aufs Spiel setzen. Auch wenn sie schon fünf Jahre hier lebe, ihrem Gefühl nach sei sie erst jetzt angekommen. Er habe eine gesicherte berufliche Position an der Uni, wenngleich schlecht bezahlt. Das gebe man nicht einfach auf. Freundschaften seien aufgefrischt, Freunde hinzugewonnen. Lea gedeihe prächtig und beginne zu laufen. Florian fühle sich wohl im Kindergarten. Bald gehe er zur Schule. Sie verstehe zwar sein Engagement. Ebenso, dass er überzeugt sei von der Idee der Hilfe zur Selbsthilfe, wie er das formuliere, um die Demokratie in Argentinien zu festigen. Von dort aber kämen üble Nachrichten. „Machst du dir keine Sorgen?“
„Die Zukunft gehört jenen, die an ihre Träume glauben“, sagt er, leicht mit den Augen zwinkernd. Es ist kein verächtliches Grienen, sondern eine leichte, sprungbereite, stillvergnügte Fröhlichkeit, die ihre Wirkung nicht verfehlte.
Daraufhin willigt sie ein. Sie wolle ihm nicht im Weg stehen. Niemandes Glück nehmen. In guten wie in schlechten Zeiten. So frei fühle sie sich. Sie sei einverstanden und ulkt, nicht wasserscheu zu sein, auch wenn es ein Sprung ins kalte Wasser wird.
Hätte sie geahnt, was auf sie zukommt – der Scherz wäre ihr im Hals steckengeblieben.
■
Die Monate vor seiner Ausreise lösen in Krauthner ein Gefühl aus, das er in dieser Heftigkeit nicht kannte: Eine seltsame Mischung aus Reiselust und fiebriger Ungeduld, wenn nicht unterschwelliger Gereiztheit. Alles kommt ihm unwirklich vor. Unversehens war er mit Hannah in Streit geraten. Es ging um die Frage, ob sie die Wohnung beibehalten sollten oder nicht, und wenn ja, für wie lange. Er sprach sich für eine Aufgabe aus, sie plädierte dagegen für den Behalt mit Nachmieter. Man wisse ja nie, hatte sie gemeint. Als er ihr eine verbohrte, engstirnige Haltung vorwarf, schlug sie vor, er solle vorausfliegen. Sie bliebe mit den Kindern hier. Sobald er in Buenos Aires ein Dach überm Kopf und halbwegs Boden unter den Füßen gefunden hätte, käme sie mit den beiden Kleinen nach. „Wann willst du fliegen?“, fragt sie mit bitterem Unterton.
Einmal mehr erfährt er, wie sie sich schlagartig in ihr nüchternes, kühles Schneckenhaus zurückzieht. Niemandem gewährt sie Zutritt. Und er weiß nicht, woran er mit ihr ist.
■
Am Morgen des 24. Oktober 1975 herrscht eine eigenartige Stimmung, geprägt von banger Sorge und hoffnungsfrohem Aufbruch. Als Hannah während des Frühstücks mit einer falschen Handbewegung den O-Saft umkippt, Florian sich vor lauter Gegacker nicht einkriegt, mit dem Besteck auf den Tisch zu trommeln beginnt und noch eins draufsetzt, indem er absichtlich seinen Becher Milch umschüttet, beginnen sie lauthals zu lachen. Die Anspannung löst sich dennoch nicht.
Die Zeit bis zur Abfahrt zum Bonner Hauptbahnhof überbrücken sie bei einer weiteren Tasse Kaffee, Pfeife oder Zigarette rauchend, schweigend oder Zeitung lesend. Schließlich setzt er sich ans Klavier und singt eine Abschiedsmelodie: Sag beim Abschied leise „Servus“.
Hannah macht sich in der Küche zu schaffen und ruft von dort, sie würde ihre Freundin Elsbet bitten, für einige Tage zu kommen.
Florian schiebt „Tschu-tschu-tschu“ seine Holz-Eisenbahn an den Fugen des Steinfußbodens entlang, und Lea malt Köpfe mit langen Beinen.
■
Über Gleis 1 liegt dicker, weißgrauer Qualm. Aus den Ventilen der stampfenden Lokomotive kommt ein regelmäßig sich wiederholendes Zischen, mehr ein Fauchen, Schnaufen und Stöhnen. Ein scharfer, durchdringender Geruch aus heißem Öl, kochendem Wasser und glühendem Eisen durchzieht den Bahnhof. Plötzlich ertönt ein ohrenbetäubend langgezogener Pfeifton. Türen werden geschlagen, und der Schaffner mahnt zur Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Auf seiner Zunge spürt Krauthner einen bitteren, metallisch beißenden Geschmack. Zwischen ihnen die verschmutzte Fensterscheibe eines Eisenbahnwaggons. Gequält lächelnd ringt er um Fassung, sieht Hannahs von Schminke und Tränen verschmiertes Gesicht. Von Florian, beleidigt, keine Hand, kein Kuss. Leas geschürzter, süßer Schmollmund. Wiederholte Kusshändchen. Ihre Körper verschwimmen im nebligen Grau.
■
Offensichtlich könne er Spanisch, vermutet die Verkäuferin im Kiosk am Amsterdamer Flughafen. Sie gibt Krauthner das Wechselgeld mit der Bemerkung zurück, die Zeitung sei drei Tage alt, vom 21. Oktober 1975. Wenn er La Nación kaufe, dann flöge er möglicherweise nach Buenos Aires. Sie käme aus dem Norden Argentiniens, aus Tucumán, sagt sie, sei Lehrerin und geflohen vor den paramilitärischen Schergen der Triple A.
„Hoffentlich passiert Ihnen nichts! ¡Suerte! Viel Glück!“, wünscht sie und fragt im vorwurfsvollen Ton -eigentlich ginge sie das ja keinen Deut an -, ob er sich das gut überlegt habe. Überraschend schenkt sie ihm ein Notizbuch. Kein Tagebuch als Privatsekretär für den Moment, für eine Zeit, an einem Ort, mit ungewissem Ausgang, möge er führen, bedeutet sie mit erhobenem Zeigefinger und lächelt gequält.
Krauthner wundert sich über ihre gehobene Art, sich auszudrücken.
„Nein, nur trockene, sachdienliche Anmerkungen für seinen Auftraggeber“, antwortet er leicht ironisch. Vor ihren Augen schreibt er auf die erste Seite: Hilfe zur Selbsthilfe -dargestellt am Beispiel der Demokratieförderung in Argentinien 1975-1979.
Sie kann darüber nur den Kopf schütteln.
„Wird schon werden!“, grüßt er zum Abschied sich um die eigene Achse schwungvoll drehend und fröhlich mit Zeitung und Kladde wedelnd zurück. Beinahe wäre er über einen herumstehenden Kofferkuli gestolpert.
■
Als er in die voll besetzte Maschine einsteigt und seinen Fensterplatz sucht, schauen ihn einige Passagiere vorwurfsvoll an. Die beiden Nachbarn lösen mürrisch ihre angelegten Sicherheitsgurte. Hat er den verspäteten Abflug verschuldet?
Missmutig, ja ärgerlich kramt er in der Jackentasche nach seiner Pfeife. Er müsste wissen, dass während des Fluges nur das Rauchen von Zigaretten gestattet ist. Stattdessen findet er meinen Brief, den ihm Hannah zugesteckt hat.
ALOISIUS PLAKERMANN
Bad Iburg, im Oktober 1975
Lieber Pulle,
meinen Brief, den ich Dir nach Madrid schicken wollte, konnte ich leider nicht beenden. Ich will Dir den Inhalt aber nicht vorenthalten. Leider haben wir uns nicht mit einem kräftigen, herzlichen Abrazo verabschieden können. Nun schreibe ich Dir aus dem beschaulichen Bad Iburg im Teutoburger Wald, wo ich mich am Großen Freeden langsam vom Hörsturz, jedoch nur schwer vom allzu plötzlichen Tod meiner lieben Erika erhole. Ich vermisse sie leidvoll; doch muss ich den Schmerz tapfer ertragen und zu überwinden versuchen. Vielleicht finde ich in der Erinnerung an eine glückliche Zeit eine tröstende Erkenntnis auf die Frage: Warum? Nun schreitest Du zuversichtlich über die Schwelle. Verlässt Deutschland für eine hoffentlich erfolgreiche Mission, gehst raus aus der miefigen, hinein in eine unbekannte Welt! Südamerika -Dein Jugendtraum! Einmal sagtest Du sogar: Erst wenn ich meinen Traum bis auf den letzten Tag zu leben wage, bin ich ein Mann! Nun, denn -wage es und lasse Deinen Gedanken freien Lauf!
Gleichzeitig stellst Du Dich in den Dienst einer guten Sache: Entwicklungshilfe und Demokratiestärkung. Lass Dich nicht unterkriegen!
Aber ich begreife es nicht: Wieso ausgerechnet dieses Institut, das Dich schon einmal ins Messer hat laufen lassen? Erinnerst Du Dich nicht an die Unverbindlichkeit von Absprachen? Ist es nicht doch der alte Tümpel? Vielleicht quaken die Frösche mit nur dicker aufgeblasenen Backen, höher oder tiefer, kürzer oder langatmiger? Ich hätte Dir abraten, Dich entschiedener, als wir bei Ria im Restaurant saßen, auf Gauner und Lakaien, Wegelagerer und selbsternannte Edelleute hinweisen müssen, die Dich nicht nur in Buenos Aires -die gibt es überall, also auch von Bonn aus begleiten werden. Jetzt ist es zu spät. Noch heute jagt mir ein kalter Schauder über den Rücken. Ich habe es versäumt und bekomme nun die Quittung -ein schlechtes Gewissen. Mit dem, was ich zuvor wusste, Dir aber verschwiegen habe, weil ich Dir keine Steine in den Weg legen wollte und dem, was ich inzwischen zusätzlich in Erfahrung bringen konnte, hätte ich Dir niemals zuraten dürfen. Ich begreife mich selbst nicht. Zu sehr habe ich an meine Story gedacht. Doch das muss ich zur eigenen Rechtfertigung anmerken: Du willst Dich nicht erinnern. Verschließt die Augen das Organ der Erinnerung.
Nun, Pulle, behalte trotz leidvoller Rückschläge -sie werden Dir auch in Zukunft nicht erspart bleiben -Deine unbeschwerte Begeisterungsfähigkeit. Pflege Dein blondes, stoppeliges Bürstenhaar, ertüchtige, sofern möglich, Dein Klavierspiel und schmauche Dein Pfeifchen. Auf ein frisch gezapftes Kölsch, wie wir es gern und ausgiebig bei Karlchen im Schifferstübchen getrunken haben, wirst Du jedoch verzichten müssen. Bewahre vor allem Deinen sympathischsten Zug: Du findest immer alles interessant! Pulle, ich bewundere Deinen Schneid! Lass von Dir hören oder lesen.
Dein Mötz
Krauthner legt den Brief zu Seite. Er schaut durch das schmale Fenster in den weiten Horizont. Die untergehende Sonne blendet. Sie bietet dennoch ein grandioses Farbenspiel.
Mötz scheint es nicht gut zu gehen. Was hat Erika, was haben die beiden in kurzer, hoffnungsloser Zeit durchmachen müssen! Es ging furchtbar schnell nach dem schrecklichen Unfall mit einem vollgedröhnten Geisterfahrer! Sie war eine warmherzige, liebenswerte, auch schöne Frau. Es tut ihm unendlich leid.
Krauthner fühlt sich noch jetzt unwohl bei dem Gedanken, nicht zu ihrer Beerdigung gegangen zu sein. Er hatte sich zur Sprachaufbesserung in Madrid aufgehalten. Da es sich bei Erikas Tod nicht um eine Verwandte handelte, hatte ihm das IIK die Reise nicht bewilligt. Auch dann nicht, wenn er das Flugticket bezahlt hätte. Und Hannah hatte mit hohem Fieber zu Bett gelegen. Er hätte trotzdem reisen sollen. Ärgerlich über sich selbst, schüttelt er den Kopf.
■