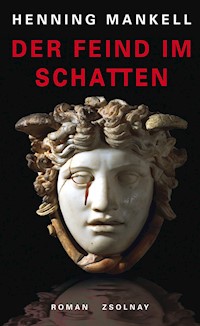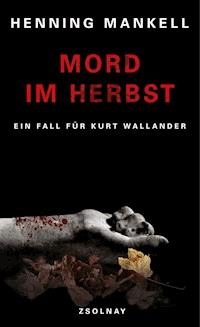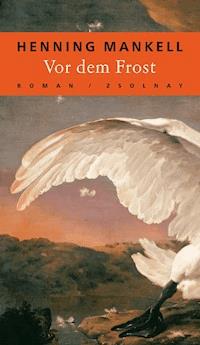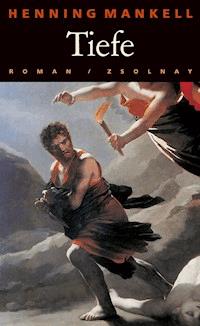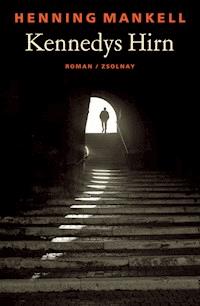
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die Archäologin Louise Cantor von ihrer Ausgrabung in Griechenland zu einem Vortrag nach Schweden reist, will sie auch ihren 25-jährigen Sohn wiedersehen. Doch als sie die Wohnung in Stockholm betritt, liegt Henrik tot im Bett. Louise glaubt nicht an einen Selbstmord. In Henriks Kleiderschrank findet sie eine Menge Material zu der Frage, warum Kennedys Hirn nach der Obduktion spurlos verschwand. War dieser junge Idealist einem kriminellen Geheimnis auf der Spur? In Louise Cantors spannender Recherche, die sie von Australien über Barcelona nach Maputo in Mosambik zu den Ärmsten der Aids-Kranken führt, finden die Hauptthemen in Henning Mankells Schreiben zusammen: die Aufdeckung aktueller Verbrechen in unserer Gesellschaft und die sozialen Probleme auf dem schwarzen Kontinent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zsolnay E-Book
Henning Mankell
Kennedys Hirn
ROMAN
Aus dem Schwedischenvon Wolfgang Butt
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2005
unter dem Titel Kennedys hjärna
im Leopard förlag in Stockholm.
ISBN: 978-3-552-05760-9
© Henning Mankell 2005
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2006/2015
Schutzumschlaggestaltung: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung eines Fotos © George Fetting / Millennium Images
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Ellen und Ingmar
Teil 1
»CHRISTUS-SACKGASSE«
»Die Niederlage soll ans Licht, nicht vergraben werden,
denn an der Niederlage wird man zum Menschen.
Wer seine Niederlagen nie versteht,
trägt nichts mit sich in die Zukunft.«
Aksel Sandemose
1
Die Katastrophe kam im Herbst und brach ohne Vorwarnung über sie herein. Sie warf keine Schatten, sie bewegte sich vollkommen lautlos. Zu keinem Zeitpunkt hatte sie eine Vorstellung davon, was geschah.
Es war, als wäre sie in einer dunklen Gasse in einen Hinterhalt geraten. Doch die Wahrheit war, daß sie gezwungen wurde, sich von den Ruinen abzuwenden, einer Wirklichkeit zu, um die sie sich eigentlich nie gekümmert hatte. Gewaltsam wurde sie in eine Welt hinausgeschleudert, in der sich niemand besonders für das Ausgraben bronzezeitlicher griechischer Grabanlagen interessierte.
Sie hatte tief in ihren staubigen Tongruben gelebt, hatte sich über zerbrochene Vasen gebeugt, die sie zusammenzusetzen versuchte. Sie hatte ihre Ruinen geliebt und nicht gesehen, daß die Welt um sie her im Begriff war einzustürzen. Sie war die Archäologin, die aus der Vergangenheit an ein Grab trat, von dem sie sich nie hatte vorstellen können, sie würde an ihm stehen.
Es gab keine Vorzeichen. Der Tragödie war die Zunge herausgeschnitten worden. Sie hatte ihr keine Warnung zurufen können.
Am Abend bevor Louise Cantor nach Schweden reiste, um an einem Seminar über die laufenden Ausgrabungen bronzezeitlicher Gräber teilzunehmen, trat sie im Badezimmer mit dem linken Fuß in eine Keramikscherbe. Der Schnitt war tief und blutete stark. Die Keramikscherbe war aus dem fünften Jahrhundert vor Christus, und das Blut auf dem Fußboden bereitete ihr Übelkeit.
Sie befand sich in der Argolis auf der Peloponnes, es war September, und die Grabungskampagne des Jahres ging ihrem Ende zu. Sie ahnte schon schwache Windstöße, die Vorboten der kommenden Winterkälte mit sich trugen. Die trockene Wärme mit ihrem Duft von Rosmarin und Thymian verlor sich bereits.
Sie stillte den Blutfluß und schnitt ein Pflaster zurecht. Eine Erinnerung schoß ihr durch den Kopf.
Ein rostiger Nagel, der ihr direkt in den Fuß gedrungen war, nicht den, an dem sie sich eben geschnitten hatte, sondern den anderen, den rechten. Sie war fünf oder sechs Jahre alt gewesen, der braune Nagel war ihr direkt in die Ferse gedrungen, hatte die Haut und das Fleisch durchstoßen, als wäre sie aufgespießt von einem Pfahl. Sie hatte vor Entsetzen hemmungslos geschrien und gedacht, daß sie jetzt die gleichen Qualen erlebte wie der Mann am Kreuz da vorn in der Kirche, in der sie manchmal ihre einsamen Gruselspiele spielte.
Wir werden von diesen angespitzten Pfählen durchbohrt, dachte sie, während sie das Blut von den gesprungenen Fliesen aufwischte. Eine Frau lebt immer in der Nähe all dieser Spitzen, die dem, was sie zu schützen versucht, schaden wollen.
Sie humpelte in den Teil des Hauses, der ihr Arbeitsplatz und ihr Schlafzimmer war. In einer Ecke hatte sie einen knarrenden Schaukelstuhl und einen Plattenspieler. Den Schaukelstuhl hatte der alte Leandros ihr geschenkt, der Nachtwächter. Leandros war schon in den dreißiger Jahren als armes, aber neugieriges Kind dabeigewesen, als die schwedischen Ausgrabungen in der Argolis begannen. Jetzt schlief er sich als Nachtwache auf dem Mastoshügel schwer durch die Nächte. Aber alle, die an der Arbeit beteiligt waren, verteidigten ihn. Leandros war ein Maskottchen. Ohne ihn wären alle zukünftigen Mittel für weitere Ausgrabungen gefährdet. Mit dem Fortschreiten des Alters war Leandros in der letzten Zeit ein zahnloser und meistens auch ziemlich schmutziger Schutzengel geworden.
Louise Cantor setzte sich in den Schaukelstuhl und betrachtete ihren verletzten Fuß. Sie mußte lächeln beim Gedanken an Leandros. Die meisten schwedischen Archäologen, die sie kannte, waren auf eine aufrührerische Weise gottlos und weigerten sich, in den verschiedenen Behörden etwas anderes zu sehen als Hindernisse für die Weiterführung der Grabungen. Götter, die seit langem jede Bedeutung verloren hatten, konnten kaum irgendeinen Einfluß auf das Geschehen in den entfernten schwedischen Behörden haben, wo die unterschiedlichen archäologischen Grabungsetats abgelehnt oder bewilligt wurden. Die Bürokratie war ein Tunnelsystem mit Eingängen und Ausgängen, doch nichts dazwischen, und die Beschlüsse, die schließlich in den heißen griechischen Grabungsstätten eintrafen, waren häufig äußerst schwer verständlich.
Ein Archäologe gräbt immer aus einer zweifachen Gnade, dachte sie. Wir wissen nie, ob wir finden, was wir suchen, oder ob wir suchen, was wir finden wollen. Wenn wir das Richtige finden, ist die Gnade groß gewesen. Doch wir wissen nie, ob wir die Erlaubnis und das Geld bekommen, weiter in die wunderbaren Ruinenwelten einzudringen, oder ob das Euter plötzlich zu versiegen beschließt.
Es war ihr persönlicher Beitrag zum Archäologenjargon, die bewilligenden Behörden als Kühe mit launischem Euter zu betrachten.
Sie sah auf die Uhr. Es war in Griechenland kurz nach acht, eine Stunde früher als in Schweden. Sie streckte sich nach dem Telefon und wählte die Nummer ihres Sohns in Stockholm.
Es klingelte, doch niemand nahm ab. Als der Anrufbeantworter ansprang, lauschte sie seiner Stimme mit geschlossenen Augen.
Es war eine Stimme, die sie ruhig machte. »Dies ist ein Anrufbeantworter, und du weißt, was du tun mußt. Ich wiederhole auf englisch. This is an answering machine and you know what to do. Henrik.«
Sie sprach ihre Nachricht: »Vergiß nicht, daß ich nach Hause komme. Ich bin zwei Tage in Visby, Bronzezeit, du weißt schon. Danach komme ich nach Stockholm. Ich liebe dich. Wir sehen uns bald. Vielleicht rufe ich nachher noch einmal an. Wenn nicht, melde ich mich aus Visby.«
Sie holte die Keramikscherbe, an der sie sich den Fuß aufgeschnitten hatte. Eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen, eine eifrige Studentin aus Lund, hatte sie gefunden. Es war eine Keramikscherbe wie Millionen anderer Scherben, ein Stück attischer Keramik, und sie vermutete, daß der Krug, zu dem sie gehörte, kurz vor dem Aufkommen der später dominierenden roten Farbe hergestellt worden war, sie dachte an das frühe fünfte Jahrhundert.
Sie liebte das Puzzlespiel mit Keramikscherben, liebte es, sich ganze Gefäße vorzustellen, die sie vielleicht niemals würde rekonstruieren können. Sie würde Henrik die Scherbe als Geschenk mitnehmen. Sie legte sie auf ihren fertig gepackten Koffer, dessen Schloß darauf wartete, geschlossen zu werden.
Wie immer vor einer Abreise fühlte sie sich rastlos. Es fiel ihr schwer, sich gegen die wachsende Ungeduld zu wehren, und sie beschloß, ihre Pläne für den Abend zu ändern. Bis sie sich an der Scherbe geschnitten hatte, war sie darauf eingestellt gewesen, ein paar Abendstunden dem Aufsatz über die attische Keramik zu widmen, an dem sie arbeitete. Doch jetzt löschte sie die Lampe auf ihrem Arbeitstisch, stellte den Plattenspieler an und ließ sich in den Schaukelstuhl fallen.
Wie meistens, wenn sie Musik hörte, begannen draußen in der Dunkelheit die Hunde zu bellen. Sie gehörten ihrem nächsten Nachbarn Mitsos, einem Junggesellen und Mitbesitzer an einem Bagger. Ihm gehörte auch das kleine Haus, das sie mietete. Die meisten ihrer Mitarbeiter wohnten in Argos, aber sie hatte es vorgezogen, in der Nähe der Ausgrabung zu bleiben.
Sie war beinah eingeschlafen, als sie zusammenschrak. Plötzlich fühlte sie, daß sie die Nacht nicht allein verbringen wollte. Sie stellte den Ton leiser und rief Vassilis an. Er hatte versprochen, sie am nächsten Tag nach Athen zu bringen. Da die Lufthansa-Maschine nach Frankfurt sehr früh abging, würden sie schon um halb vier Uhr losfahren müssen. Sie wollte in einer Nacht, in der sie sowieso nur unruhigen Schlaf finden würde, nicht allein sein.
Sie blickte zur Uhr und dachte, daß Vassilis noch in seinem Büro wäre. Eine ihrer seltenen Streitereien hatte seinem Beruf gegolten. Vermutlich war ihre Äußerung, Rechnungsprüfer müsse der brennbarste Beruf sein, den es gebe, nicht besonders feinfühlig gewesen.
Sie erinnerte sich noch an die genaue Formulierung, die sie benutzt hatte, eine unbeabsichtigte Bosheit.
»Der brennbarste Beruf, den es gibt. So knochentrocken und leblos, daß er sich jeden Augenblick von selbst entzünden kann.«
Er war erstaunt gewesen, vielleicht traurig, vor allem aber wütend. In dem Moment hatte sie begriffen, daß er sich tatsächlich nicht allein ihres Sexuallebens annahm. Er war ein Mann, mit dem sie ihre Freizeit teilen konnte, obwohl oder vielleicht weil er überhaupt nicht an Archäologie interessiert war. Sie hatte befürchtet, er könne so verletzt sein, daß er die Beziehung beendete. Aber sie hatte ihn überzeugen können, daß sie nur einen Scherz gemacht hatte.
»Die Welt wird von Rechnungsbüchern beherrscht«, hatte sie gesagt. »Rechnungsbücher sind die Liturgie unserer Zeit, Rechnungsprüfer sind unsere Hohenpriester.«
Sie wählte die Nummer. Besetzt. Sie schaukelte langsam im Stuhl. Vassilis war sie durch einen Zufall begegnet. Aber waren nicht alle wichtigen Begegnungen im Leben Zufälle?
Ihre erste Liebe, der rothaarige Mann, der Bären jagte, Häuser baute und zwischendurch für lange Perioden in Melancholie versinken konnte, hatte sie eines Tages mitgenommen, als sie nach dem Besuch einer Freundin in Hede den Schienenbus verpaßt hatte und per Anhalter nach Sveg zurückgefahren war. Emil war in einem alten Laster gekommen, sie war sechzehn Jahre alt und hatte es noch nicht geschafft, den Schritt ins Leben zu tun. Er fuhr sie nach Hause. Es war im Spätherbst 1967, sie blieben ein halbes Jahr zusammen, bis sie sich aus seiner riesenhaften Umarmung zu befreien vermochte. Danach zog sie von Sveg nach Östersund, fing auf dem Gymnasium an und beschloß, Archäologin zu werden. In Uppsala gab es andere Männer, und über alle war sie zufällig gestolpert. Aron, den sie heiratete, der Henriks Vater wurde und sie dazu brachte, ihren Namen von Lindblom in Cantor zu ändern, hatte in einem Flugzeug zwischen London und Edinburgh auf dem Platz neben ihr gesessen. Sie hatte ein Stipendium der Universität bekommen, um an einem Seminar über klassische Archäologie teilzunehmen. Aron war unterwegs nach Schottland, um zu angeln, und dort oben am Himmel, hoch über den Wolken, hatten sie angefangen, sich zu unterhalten.
Sie schob die Gedanken an Aron von sich, um nicht wütend zu werden, und wählte die Nummer noch einmal. Immer noch besetzt.
Sie verglich stets die Männer, die sie nach der Scheidung getroffen hatte, mit Aron, es geschah unbewußt, doch sie benutzte eine innere Meßlatte, auf der Aron eingekerbt war, und alle, die sie betrachtete, waren zu kurz oder zu lang, zu langweilig, zu unbegabt; kurz gesagt, Aron trug immer den Sieg davon. Sie hatte noch keinen gefunden, der als Herausforderer gegen die Erinnerung an Aron antreten konnte. Es machte sie verzweifelt und wütend zugleich, es war, als bestimmte er noch immer ihr Leben, obwohl er längst nichts mehr zu sagen haben sollte. Er hatte sie betrogen, er hatte sie getäuscht, und als alles ans Licht zu kommen drohte, war er einfach verschwunden, wie ein Spion, der sich zu seinem geheimen Auftraggeber absetzt, wenn die Gefahr besteht, daß er entlarvt wird. Es war für sie ein furchtbarer Schock gewesen, sie hatte nicht geahnt, daß er andere Frauen neben ihr hatte. Eine davon gehörte sogar zu ihren besten Freundinnen, auch sie Archäologin, die ihr Leben der Ausgrabung eines Dionysostempels auf Thasos gewidmet hatte. Henrik war noch sehr klein, sie hatte eine Vertretung als Universitätsdozentin gehabt, während sie versuchte, über das Geschehene hinwegzukommen und ihr zerbrechendes Leben zusammenzuflicken.
Aron hatte sie zerschmettert, wie ein plötzlicher Vulkanausbruch eine Ortschaft, einen Menschen oder eine Vase zerschmettern konnte. Oft dachte sie an sich selbst, wenn sie mit ihren Keramikscherben dasaß und sich ein Ganzes vorzustellen versuchte, das sie nie würde rekonstruieren können. Aron hatte sie nicht nur in Stücke geschlagen, er hatte auch einen Teil der Scherben versteckt, um es ihr schwerer zu machen, ihre Identität als Mensch, als Frau und als Archäologin wiederzufinden.
Aron hatte sie ohne Vorwarnung verlassen, er hatte nur einen Brief von wenigen, nachlässig geschriebenen Zeilen zurückgelassen, in denen er ihr mitteilte, daß ihre Ehe beendet sei, er könne nicht mehr, er entschuldige sich und hoffe, sie werde ihren gemeinsamen Sohn nicht gegen ihn aufbringen.
Danach hörte sie sieben Monate nichts von ihm. Schließlich kam ein Brief aus Venedig. Sie erkannte an der Handschrift, daß er betrunken gewesen war, als er ihn schrieb, einer dieser großartigen Aronräusche, in die er sich zuweilen stürzte, ein konstanter Rausch, der mit Höhepunkten und Tiefen über eine Woche dauern konnte. Jetzt schrieb er ihr und war weinerlich und voller Selbstmitleid und wollte wissen, ob sie sich vorstellen könne, ihn zurückzunehmen. Erst da, als sie mit dem weinfleckigen Brief in der Hand dasaß, erkannte sie, daß es wirklich vorbei war. Sie wollte beides, ihn zurückhaben und ihn nicht zurückhaben, doch das erste wagte sie nicht, weil sie wußte, daß er ihr Leben von neuem zerstören konnte. Ein Mensch kann einmal im Leben zu Boden gehen und sich wieder aufrichten, hatte sie gedacht. Aber nicht zweimal, das war zuviel. Also antwortete sie ihm, daß ihre Ehe beendet sei. Henrik war da, es sei ihnen beiden selbst überlassen, herauszufinden, welche Art von Gemeinschaft sie im Leben haben wollten, sie werde sich nicht zwischen ihn und das Kind stellen.
Es verging nahezu ein Jahr, bis er wieder von sich hören ließ. Da kam er durch eine rauschende Telefonleitung aus Neufundland zu ihr, wohin er sich mit einigen gleichgesinnten Computerexperten zurückgezogen hatte, die ein sektenähnliches Netzwerk gebildet hatten. In dunklen Reden hatte er ihr zu erklären versucht, daß sie daran arbeiteten, zukünftige Archivierungsmethoden zu erforschen, wenn alle menschliche Erfahrung in Nullen und Einsen verwandelt war. Der Mikrofilm und die Felskammern waren für die gesammelte menschliche Erfahrung nicht mehr von Bedeutung. Jetzt war es der Computer, der garantieren sollte, daß der Mensch in einem bestimmten Zeitalter keine Leere zurückließ. Aber konnte man garantieren, daß die Computer in der magischen Halbwelt, in der er lebte, nicht anfingen, eigene Erfahrungen zu erschaffen und zu speichern? Die Telefonleitung rauschte, sie verstand nicht viel von dem, was er sagte, aber er war auf jeden Fall nicht betrunken und voller Selbstmitleid.
Er bat sie um die Lithographie eines Habichts, der eine Taube schlug, ein Bild, das sie am Anfang ihrer Ehe zufällig in einer Galerie gekauft hatten. Ein paar Wochen später schickte sie das Bild. Ungefähr gleichzeitig hatte sie bemerkt, daß er wieder Kontakt zu seinem Sohn aufgenommen hatte, auch wenn dies im geheimen geschah.
Aron stand weiterhin im Weg. Sie zweifelte manchmal daran, daß es ihr je gelingen würde, sein Gesicht auszuwischen und die Meßlatte loszuwerden, mit der sie andere Männer maß und die der Grund dafür war, daß alle früher oder später für zu klein befunden und fallengelassen wurden.
Sie wählte Henriks Nummer. Jedesmal, wenn die alten Wunden aus der Beziehung mit Aron wieder aufbrachen, mußte sie Henriks Stimme hören, um nicht in Bitterkeit zu verfallen. Aber wieder meldete sich nur der Anrufbeantworter, und sie sagte, sie werde jetzt nicht mehr anrufen, bis sie in Visby angekommen sei.
Es gab immer einen Moment kindlicher Angst, wenn er sich nicht meldete. Einige Sekunden lang stellte sie sich Unglücke vor, Brände, Krankheiten. Dann wurde sie wieder ruhig. Henrik war vorsichtig, ging nie unnötige Risiken ein, auch wenn er viel reiste, oft das Unbekannte aufsuchte.
Sie trat hinaus auf den Hof und rauchte eine Zigarette. Von Mitsos’ Haus hörte sie einen Mann lachen. Es war Panayiotis, sein älterer Bruder. Panayiotis, der zum Verdruß der Familie Geld beim Pferderennen gewonnen und damit eine unverschämte finanzielle Voraussetzung für sein leichtfertiges Leben geschaffen hatte. Sie mußte lachen, als sie daran dachte, zog den Rauch tief in die Lungen und sagte sich abwesend, daß sie am Tag ihres sechzigsten Geburtstags aufhören würde zu rauchen.
Sie war allein in der Dunkelheit, der Sternenhimmel war klar, der Abend mild, ohne die kühlen Windstöße. Hierhin bin ich gekommen, dachte sie. Von Sveg und dem melancholischen Härjedalen nach Griechenland und zu den bronzezeitlichen Gräbern. Aus dem Schnee und der Kälte in die warmen und trockenen Olivenhaine.
Sie drückte die Zigarette aus und ging zurück ins Haus. Ihr Fuß schmerzte. Sie hielt inne, unschlüssig, was sie tun sollte. Dann rief sie noch einmal bei Vassilis an. Es war nicht mehr besetzt, aber es nahm auch niemand ab.
Vassilis’ Gesicht verschwamm in ihrer Vorstellung sogleich mit dem von Aron. Vassilis täuschte sie, er betrachtete sie als einen Bestandteil seines Lebens, auf den er verzichten konnte.
Eifersüchtig wählte sie die Nummer des Handys, das er in der Tasche hatte. Keine Antwort. Nur eine griechische Frauenstimme, die sie bat, eine Nachricht zu hinterlassen. Sie biß die Zähne zusammen und sagte nichts.
Dann klappte sie ihre Tasche zu und beschloß im selben Moment, ihre Beziehung mit Vassilis zu beenden. Sie würde das Rechnungsbuch abschließen, es beenden, genauso wie sie ihre Tasche zugeklappt hatte.
Sie streckte sich auf dem Bett aus und betrachtete den stummen Deckenventilator. Wie hatte sie überhaupt ein Verhältnis mit Vassilis haben können? Auf einmal war es ihr unbegreiflich, sie war angewidert, aber nicht von ihm, sondern von sich selbst.
Der Ventilator an der Decke war stumm, die Eifersucht war verflogen, und die Hunde draußen im Dunkeln schwiegen. Wie sie es immer tat, wenn sie vor einer wichtigen Entscheidung stand, redete sie sich in Gedanken mit ihrem Namen an.
Dies ist Louise Cantor im Herbst 2004, hier hat sie ihr Leben, schwarz auf weiß, oder eher rot auf schwarz, was die übliche Farbkombination auf den Urnenfragmenten ist, die wir aus der griechischen Erde graben. Louise Cantor ist vierundfünfzig Jahre alt, sie erschrickt nicht, wenn sie ihr Gesicht oder ihren Körper im Spiegel sieht. Sie ist immer noch ansprechend, noch nicht alt, Männer sehen sie, auch wenn sie sich nicht nach ihr umschauen. Und sie? Nach wem schaut sie sich um? Oder richtet sie ihren Blick nur auf die Erde, da es sie weiterhin reizt, nach Absichten und Abdrücken der Vergangenheit zu suchen? Louise Cantor hat ein Buch geschlossen, das Vassilis heißt, es wird nie mehr geöffnet. Es wird ihm nicht einmal mehr erlaubt sein, Louise Cantor morgen zum Flugplatz von Athen zu fahren.
Sie stand auf und suchte die Nummer eines örtlichen Taxiunternehmens. Sie bekam eine schwerhörige Frau an den Apparat und mußte ihre Bestellung schreien. Nun konnte sie nur hoffen, daß der Wagen auch wirklich kam. Weil Vassilis zugesagt hatte, um halb vier bei ihr zu sein, bestellte sie das Taxi für drei Uhr.
Sie setzte sich an ihren Arbeitstisch und schrieb einen Brief an Vassilis. »Es ist Schluß, es ist vorbei. Alles hat ein Ende. Ich spüre, daß ich mich auf etwas Neues zubewege. Es tut mir leid, daß du umsonst gekommen bist, um mich abzuholen. Ich habe versucht, dich anzurufen. Louise.«
Sie las den Brief noch einmal durch. Bereute sie es? Es kam vor, daß sie das tat, sie hatte in ihrem Leben viele Abschiedsbriefe geschrieben, die nie abgesandt wurden. Doch diesmal nicht. Sie steckte den Brief in einen Umschlag, klebte ihn zu und ging in der Dunkelheit hinaus zum Briefkasten, wo sie ihn mit einer Wäscheklammer befestigte.
Sie schlummerte ein paar Stunden auf dem Bett, trank ein Glas Wein und starrte auf eine Dose mit Schlaftabletten, ohne sich entscheiden zu können.
Das Taxi kam drei Minuten vor drei, es war noch dunkel. Sie wartete draußen am Tor. Mitsos’ Hunde bellten nicht. Sie sank auf den Rücksitz und schloß die Augen. Erst jetzt, da die Reise begonnen hatte, konnte sie einschlafen.
Im Morgengrauen erreichte sie den Flughafen. Ohne daß sie es ahnte, näherte sie sich der großen Katastrophe.
2
Als sie ihren Koffer bei einer der morgenmüden Lufthansaangestellten eingecheckt hatte und auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle war, geschah etwas, was einen tiefen Eindruck bei ihr hinterließ.
Später sollte sie denken, daß sie es als Omen hätte auffassen müssen, als Warnung. Doch sie tat es nicht, sie entdeckte nur eine einsame Frau, die mit ihren Bündeln und altmodischen, mit Schnüren zugebundenen Kleidertaschen auf dem Steinfußboden saß. Die Frau weinte. Sie war vollkommen reglos, ihr Gesicht nach innen gekehrt, sie war alt, ihre eingesunkenen Wangen erzählten von vielen fehlenden Zähnen. Vielleicht war sie aus Albanien, dachte Louise Cantor. Viele albanische Frauen suchen Arbeit hier in Griechenland, sie nehmen jede Arbeit an, weil wenig besser ist als nichts und weil Albanien ein erbarmungslos armes Land ist. Sie trug einen Schal um den Kopf, den Schal der ehrbaren älteren Frau, sie war keine Moslime, und sie saß auf dem Boden und weinte. Die Frau war allein, es war, als wäre sie hier auf dem Flughafen an Land getrieben, umgeben von ihren Bündeln, ihr Leben war zerschlagen, ein Haufen wertloses Strandgut war alles, was übrig war.
Louise Cantor blieb stehen, eilige Menschen stießen sie an, doch sie blieb stehen, als stemmte sie sich gegen einen starken Wind. Das Gesicht der Frau zwischen den Bündeln auf dem Boden war braun und zerfurcht, ihre Haut war wie eine erstarrte Lavalandschaft. Es gab eine besondere Art von Schönheit in den Gesichtern alter Frauen, wo alles bis auf eine dünne Haut über den Knochen abgeschliffen ist, wo alle Geschehnisse des Lebens eingeschrieben sind. Zwei eingekerbte, ausgetrocknete Furchen zogen sich von den Augen die Wangen hinab, jetzt füllten sie sich mit den Tränen der Frau.
Sie begießt einen mir unbekannten Schmerz, dachte Louise Cantor. Aber etwas von ihr habe ich auch in mir.
Die Frau hob plötzlich den Kopf, ihre Blicke begegneten sich für einen kurzen Augenblick, und sie schüttelte langsam den Kopf. Louise Cantor nahm dies als ein Zeichen, daß ihre Hilfe, worin sie auch hätte bestehen können, nicht benötigt wurde. Sie hastete weiter zur Sicherheitskontrolle, drängte sich durch die schubsenden Menschen, jagte durch Duftwolken von Knoblauch und Oliven. Als sie sich umwandte, war es, als wäre ein Vorhang von Menschen zwischen sie gezogen worden, die Frau war nicht mehr zu sehen.
Louise Cantor hatte ein Tagebuch, in dem sie seit ihrer frühen Jugend Ereignisse aufschrieb, von denen sie meinte, sie würde sie nie vergessen. Dies war ein solcher Moment. In Gedanken formulierte sie schon, was sie schreiben würde, während sie ihre Handtasche auf das Rollband der Sicherheitskontrolle und ihr Telefon in eine kleine blaue Plastikbox legte und anschließend durch die magische Sperre schritt, die böse Menschen von guten trennte.
Sie kaufte eine Flasche Tullamore Dew für sich und zwei Flaschen Retsina für Henrik. Dann setzte sie sich in die Nähe des Ausgangs und entdeckte zu ihrem Ärger, daß sie ihr Tagebuch in der Argolis vergessen hatte. Sie sah es vor sich, es lag am Tischende neben der grünen Lampe. Sie holte das Seminarprogramm und notierte auf der Rückseite:
»Weinende alte Frau auf dem Flugplatz von Athen. Ein Gesicht, als wäre sie eigentlich eine menschliche Ruine, nach Jahrtausenden von einem neugierigen und aufdringlichen Archäologen ausgegraben. Warum weinte sie? Diese universelle Frage. Warum weint ein Mensch?«
Sie schloß die Augen und versuchte sich vorzustellen, was sich in den Bündeln und kaputten Taschen befunden haben konnte.
Leere, dachte sie. Taschen, gefüllt mit Leere oder mit der Asche vergangener niedergebrannter Feuer.
Als ihr Flug aufgerufen wurde, wachte sie mit einem Ruck auf. Sie saß auf einem Gangplatz, der Mann neben ihr schien Flugangst zu haben. Sie beschloß, bis Frankfurt zu schlafen, erst auf der Strecke nach Stockholm würde sie frühstücken.
Als sie in Arlanda gelandet war und ihren Koffer gefunden hatte, war sie immer noch müde. Sie liebte es, eine Reise vor sich zu haben, nicht aber, sie zu unternehmen. Sie ahnte, daß sie eines Tages auf einer Reise von Panik befallen werden würde. Deshalb hatte sie seit vielen Jahren immer eine Schachtel mit Beruhigungstabletten bei sich, für den Fall, daß der Angstanfall kam.
Sie suchte den Weg zum Terminal für Inlandflüge, gab ihren Koffer bei einer etwas weniger müden Frau ab als der, bei der sie in Athen eingecheckt hatte, setzte sich und wartete. Durch eine Tür, die aufgestoßen wurde, traf sie ein Windstoß aus dem schwedischen Herbst. Sie fröstelte und dachte, daß sie die Gelegenheit wahrnehmen mußte, einen Pullover aus Gotlandwolle zu kaufen, wenn sie schon in Visby war. Gotland und Griechenland hatten die Schafe gemeinsam, dachte sie. Wenn Gotland Olivenhaine hätte, wäre der Unterschied gering.
Sie überlegte, ob sie Henrik anrufen sollte. Aber er schlief vielleicht, er machte die Nacht oft zum Tag, er arbeitete lieber bei Sternenlicht als bei Sonnenschein. Statt dessen wählte sie die Nummer ihres Vaters in Ulvkälla in der Nähe von Sveg, auf der Südseite des Ljusnan. Er schlief nie, ihn konnte sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Noch nie war es ihr gelungen, ihn dabei zu erwischen, daß er schlief, wenn sie anrief. Daran erinnerte sie sich auch aus ihrer Kindheit. Sie hatte einen Vater, der den Schlaftroll überlistet hatte, einen riesigen Mann mit stets geöffneten Augen, stets wachend, bereit, sie zu verteidigen.
Sie wählte die Nummer, brach aber nach dem ersten Klingeln ab. Gerade im Augenblick hatte sie ihm nichts zu sagen. Sie steckte das Telefon ein und dachte an Vassilis. Er hatte sie nicht auf ihrem Handy angerufen und eine Nachricht auf ihrer Mailbox hinterlassen. Aber warum sollte er? Sie spürte einen Anflug von Enttäuschung, verwarf die Empfindung aber sogleich, es gab keinen Grund, zu bereuen. Louise Cantor stammte aus einer Familie, in der man einmal gefaßte Entschlüsse nicht bereute, selbst wenn sie völlig verfehlt waren. Man machte gute Miene auch zum bösesten Spiel.
Es wehte stark vom Meer her, als die Maschine hart auf dem Flugplatz bei Visby aufsetzte. Der Wind erfaßte ihren Mantel, als sie geduckt ins Flughafengebäude eilte. Ein Mann mit einem Schild nahm sie in Empfang. Auf der Fahrt in die Stadt sah sie an den Bäumen, wie stark der Wind war, er würde die meisten Blätter abreißen. Es findet eine Feldschlacht zwischen den Jahreszeiten statt, dachte sie, eine Feldschlacht, deren Ausgang von vornherein feststeht.
Das Hotel hieß Strand und lag am Hang, der vom Hafen anstieg. Sie hatte ein Zimmer ohne Fenster zum Marktplatz bekommen und bat die Frau an der Rezeption enttäuscht, das Zimmer zu tauschen. Sie bekam ein anderes Zimmer, das zwar kleiner war, aber zur richtigen Seite wies, und sie stand vollkommen still, als sie ins Zimmer trat und durchs Fenster hinaussah. Was sehe ich? dachte sie. Was hoffe ich? Was soll da draußen geschehen?
Sie hatte eine wiederkehrende Beschwörungsformel. Ich bin vierundfünfzig Jahre alt. Bis hierher bin ich gekommen, wohin führt mein Weg jetzt, wenn der Weg endet?
Sie sah eine alte Dame, die sich auf der windigen Steigung mit ihrem Hund abmühte. Sie fühlte sich mehr wie der Hund als wie die Frau in dem grellroten Mantel.
Kurz vor vier am Nachmittag ging sie zur Hochschule, die am Wasser lag. Es war ein kurzer Weg, und sie hatte noch Zeit, um eine Runde durch den verlassenen Hafen zu gehen. Das Wasser peitschte gegen die steinerne Pier. Es hatte eine andere Farbe als das Meer um das griechische Festland und die Inseln herum. Es ist wilder hier, dachte sie. Rauher, ein junges Meer, das hitzig das Messer gegen das erstbeste Schiff oder die erstbeste Hafenmauer zieht.
Der Wind war noch immer stark, vielleicht böiger jetzt. Eine Fähre war auf dem Weg hinaus durch die Hafeneinfahrt. Sie war ein pünktlicher Mensch. Es war ebenso wichtig, nicht zu früh zu kommen, wie nicht zu spät zu kommen. Ein freundlicher Mann mit einer operierten Hasenscharte empfing sie am Eingang. Er gehörte zu den Veranstaltern, stellte sich vor und sagte, sie seien sich schon einmal begegnet, vor vielen Jahren, aber sie konnte sich nicht an ihn erinnern. Sie wußte, daß es zu den am schwersten zu erlernenden menschlichen Fähigkeiten zählte, jemanden wiederzuerkennen. Gesichter verändern sich, oft bis zur Unkenntlichkeit. Aber sie lächelte ihn an und sagte, sie erinnere sich, sehr gut sogar.
Sie versammelten sich in einem unpersönlichen Seminarraum, sie waren zweiundzwanzig Personen, steckten sich ihre Namensschildchen an, tranken Kaffee und Tee und lauschten anschließend den Ausführungen eines lettischen Dr. Stefanis, der das Seminar in holprigem Englisch mit einem Bericht über kürzlich gemachte Funde minoischer Keramik eröffnete, die bemerkenswert schwer zu bestimmen war. Sie begriff nicht, was daran so schwer zu bestimmen war, minoisch war minoisch, und damit basta.
Sie merkte bald, daß sie nicht zuhörte. Sie war noch immer unten in der Argolis, umgeben vom Duft von Thymian und Rosmarin. Sie betrachtete die Menschen, die an dem großen ovalen Tisch saßen. Wer von ihnen hörte zu, wer war wie sie, teilweise sich selbst entrückt, in eine andere Wirklichkeit? Sie kannte niemanden am Tisch, abgesehen von dem Mann, der behauptet hatte, ihr in der Vergangenheit schon einmal begegnet zu sein. Es waren Teilnehmer aus den skandinavischen und baltischen Ländern, dazu ein paar Feldarchäologen wie sie selbst.
Dr. Stefanis schloß abrupt, als könnte er sein eigenes schlechtes Englisch nicht mehr ertragen. Nach dem Applaus kam es zu einer kürzeren und äußerst friedlichen Diskussion. Nach einigen praktischen Erklärungen für den kommenden Tag war der Einleitungsabend des Seminars beendet. Als sie das Gebäude verlassen wollte, wurde sie von einem Unbekannten gebeten, noch zu bleiben, weil der Fotograf einer Lokalzeitung einige zufällig zusammengetriebene Archäologen fotografieren wollte. Er notierte ihren Namen, dann konnte sie fliehen, hinaus in den starken Wind.
In ihrem Zimmer schlief sie auf dem Bett ein und wußte zunächst nicht, wo sie war, als sie die Augen wieder aufschlug. Sie müßte Henrik anrufen, beschloß aber, damit bis nach dem Essen zu warten. Draußen auf dem Marktplatz ging sie in eine willkürlich gewählte Richtung und landete in einem Kellerrestaurant, in dem wenige Gäste saßen. Aber das Essen war gut. Sie trank einige Gläser Wein, spürte erneut Unbehagen bei dem Gedanken daran, daß sie ihr Verhältnis mit Vassilis beendet hatte, und versuchte, sich auf den Vortrag zu konzentrieren, den sie am nächsten Tag halten sollte. Sie trank noch ein Glas Wein und ging in Gedanken noch einmal durch, was sie sagen wollte. Sie hatte ein Manuskript, aber da es ein alter Vortrag war, konnte sie ihn fast auswendig.
Ich werde über die schwarze Farbe im Ton sprechen. Das rote Eisenoxyd wird während des Brennens durch den Sauerstoffmangel schwarz. Aber das ist die letzte Phase des Brennvorgangs, in der ersten Phase bildet sich das rote Eisenoxyd, die Urne wird rot. Das Rote und das Schwarze haben ihren Ursprung ineinander.
Der Wein begann zu wirken, ihr Körper wurde warm, ihr Kopf füllte sich mit Wellen, die vor und zurück rollten. Sie zahlte, ging hinaus in den böigen Wind und dachte, daß sie sich schon nach dem kommenden Tag sehnte.
Sie wählte die Nummer der Wohnung in Stockholm. Immer noch war dort nur der Anrufbeantworter. Wenn es wichtig war, kam es vor, daß Henrik eine bestimmte Nachricht aufs Band sprach, eine Nachricht, die sie mit der ganzen Welt teilte. Sie sagte, daß sie in Visby sei, daß sie auf dem Weg sei. Dann wählte sie die Nummer seines Mobiltelefons. Auch dort keine Antwort.
Eine vage Besorgnis durchfuhr sie, ein Hauch, so flüchtig, daß sie ihn fast nicht wahrnahm.
In der Nacht schlief sie bei angelehntem Fenster. Gegen Mitternacht wurde sie davon wach, daß ein paar betrunkene Jungen etwas von einem lockeren Mädchen schrien, das ihnen unerreichbar vorkam.
Um zehn Uhr am nächsten Tag hielt sie ihren Vortrag über den attischen Ton und seine Konsistenz. Sie sprach von dem reichen Eisenvorkommen und verglich die rote Farbe des Eisenoxyds mit dem kalkreichen Ton von Korinth und der weißen oder sogar grünen Keramik. Nach einer zögernden Einleitung – mehrere Teilnehmer hatten offenbar noch spät zu Abend gegessen und reichlich Wein dazu getrunken – gelang es ihr, das Interesse der Zuhörer zu wecken. Sie sprach genau fünfundvierzig Minuten, wie geplant, und erntete kräftigen Applaus. Während der anschließenden Diskussion wurden ihr keine heiklen Fragen gestellt, und als die Kaffeepause kam, hatte sie das Gefühl, mit ihrem Beitrag den Zweck der Reise erfüllt zu haben.
Der Wind war schwächer geworden. Sie nahm ihre Kaffeetasse mit in den Hof und balancierte sie auf ihrem Knie, als sie sich auf eine Bank gesetzt hatte. Ihr Telefon summte. Sie war sicher, daß es Henrik sein mußte, aber sie sah, daß der Anruf aus Griechenland kam, es war Vassilis. Sie zögerte, antwortete dann aber nicht. Sie wollte nicht riskieren, in einen nervenaufreibenden Streit zu geraten, dazu war es zu früh am Tag. Vassilis konnte unerträglich sein, wenn er es darauf anlegte. Sie würde schon bald in die Argolis zurückkehren und ihn dann aufsuchen.
Sie steckte das Telefon in die Tasche, trank ihren Kaffee und beschloß plötzlich, daß es jetzt reichte. Die weiteren Referenten des Tages hatten sicher viel Interessantes zu sagen. Aber sie wollte nicht mehr bleiben. Als ihr Beschluß gefaßt war, nahm sie ihre Tasse und suchte den Mann mit der Narbe auf der Oberlippe. Sie erklärte ihm, ein Freund sei plötzlich erkrankt, es sei nicht lebensbedrohlich, aber doch so ernst, daß sie ihre weitere Teilnahme absagen müsse.
Später sollte sie diese Worte verfluchen. Sie sollten sie verfolgen, sie hatte nach dem Wolf gerufen, und der Wolf war gekommen.
Doch gerade jetzt schien die Herbstsonne über Visby. Sie kehrte zum Hotel zurück, die Rezeptionistin half ihr, den Flug umzubuchen, und sie bekam einen Platz in einer Maschine um drei Uhr. Die Zeit reichte noch für einen Spaziergang entlang der Stadtmauer und für den Besuch in zwei Läden, in denen sie handgestrickte Pullover anprobierte, ohne jedoch einen passenden zu finden. Sie aß in einem chinesischen Restaurant zu Mittag und beschloß, Henrik nicht mehr anzurufen, sondern ihn zu überraschen. Sie besaß einen eigenen Schlüssel, und Henrik hatte ihr gesagt, daß sie jederzeit in seine Wohnung gehen könne, er habe keine Geheimnisse, die er vor ihr verbergen müsse.
Sie war sehr früh am Flugplatz, in einer Lokalzeitung betrachtete sie das Bild, das der Fotograf am Tag zuvor gemacht hatte. Sie riß die Seite heraus und steckte sie ein. Dann kam eine Durchsage, daß die Maschine, mit der sie fliegen sollte, einen technischen Defekt habe. Sie mußte auf eine Ersatzmaschine warten, die bereits auf dem Weg von Stockholm war.
Sie ärgerte sich nicht, spürte aber, wie ihre Ungeduld wuchs. Weil es keine andere Maschine gab, auf die sie umbuchen konnte, ging sie nach draußen, setzte sich vor dem Flughafengebäude auf eine Bank und rauchte eine Zigarette. Jetzt bereute sie es, daß sie nicht mit Vassilis gesprochen hatte, sie hätte ebensogut den Zornausbruch eines Mannes über sich ergehen lassen können, der in seiner Eitelkeit gekränkt war und ein Nein nicht akzeptieren konnte als das, was es war.
Doch sie rief nicht an. Mit fast zweistündiger Verspätung hob die Maschine ab, und es war schon nach fünf Uhr, als sie wieder in Stockholm landete. Sie nahm ein Taxi direkt zu Henriks Wohnung auf Söder. Sie gerieten in den Stau nach einem Verkehrsunfall, es waren viele unsichtbare Kräfte am Werk, die sie zurückhalten, sie verschonen wollten. Doch natürlich wußte sie davon nichts, sie fühlte nur, wie ihre Ungeduld wuchs, und dachte, daß Schweden in vielerlei Hinsicht Griechenland zu gleichen begann, verkeilte Autoschlangen und ständige Verspätungen.
Henrik wohnte in der Tavastgata, einer ruhigen Straße ein wenig abseits der Hauptverkehrswege auf Söder. Sie probierte aus, ob der Türkode der gleiche war wie beim letzten Mal, 1066, die Schlacht bei Hastings. Die Tür ging auf. Henrik wohnte ganz oben mit Aussicht auf Blechdächer und Kirchtürme. Er hatte auch erzählt, zu ihrem großen Entsetzen, daß er das Wasser des Strömmen erkennen konnte, wenn er auf dem schmalen Gitter vor einem seiner Fenster balancierte.
Sie drückte zweimal auf die Klingel. Dann schloß sie auf. Sie bemerkte den dumpfen Geruch einer ungelüfteten Wohnung.
Im selben Augenblick bekam sie Angst. Etwas stimmte nicht. Sie hielt den Atem an und lauschte. Vom Flur konnte sie in die Küche sehen. Es ist niemand hier, dachte sie. Sie rief, daß sie es sei. Aber keiner antwortete. Ihre Angst verging. Sie hängte ihren Mantel auf und trat die Schuhe von den Füßen. Auf dem Boden unter dem Briefeinwurfschlitz lag keine Post und keine Reklame. Henrik war also nicht verreist. Sie ging in die Küche. Kein schmutziges Geschirr im Spülbecken. Das Wohnzimmer war ungewöhnlich gut aufgeräumt, der Schreibtisch leer. Sie schob die Tür zum Schlafzimmer auf.
Henrik lag unter der Decke. Sein Kopf ruhte schwer auf dem Kissen. Er lag auf dem Rücken, eine Hand hing hinab auf den Fußboden, die andere lag offen auf seiner Brust.
Sie wußte sofort, daß er tot war. In einem aberwitzigen Versuch, sich von dieser Einsicht zu befreien, schrie sie los. Aber er bewegte sich nicht, er lag in seinem Bett und war nicht mehr da.
Es war Freitag, der 17. September. Louise Cantor stürzte in einen Abgrund, der in ihr selbst war und zugleich außerhalb ihres Körpers.
Dann lief sie aus der Wohnung, immer noch schreiend. Die sie gehört hatten, sagten später, es habe geklungen wie der Notschrei eines Tiers.
3
Aus dem Chaos löste sich ein einzelner greifbarer Gedanke. Aron. Wo war er? Gab es ihn überhaupt? Warum stand er nicht neben ihr? Henrik war ihr gemeinsames Geschöpf, und dem konnte er sich nicht entziehen. Aber Aron kam natürlich nicht, er war fort, wie er immer fort gewesen war, er war wie ein dünner Dunstschleier, den sie nicht greifen, an den sie sich nicht anlehnen konnte.
Sie hatte hinterher keine direkte Erinnerung an die nächsten Stunden, wußte nur, was andere ihr erzählt hatten. Ein Nachbar hatte die Tür aufgemacht und sie entdeckt, sie war auf der Treppe gestolpert und liegengeblieben. Danach war ein Gewimmel von Menschen um sie gewesen, Polizisten und die Männer vom Krankenwagen. Man hatte sie in die Wohnung gebracht, obwohl sie sich dagegen gesträubt hatte. Sie wollte nicht dahin zurück, sie hatte nicht gesehen, was sie gesehen hatte, Henrik war nur ausgegangen, er würde bald nach Hause kommen. Eine Polizistin mit kindlichem Gesicht hatte ihr den Arm gestreichelt, sie war wie eine freundliche alte Tante gewesen, die ein kleines Mädchen tröstete, das hingefallen war und sich das Knie aufgeschrammt hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!