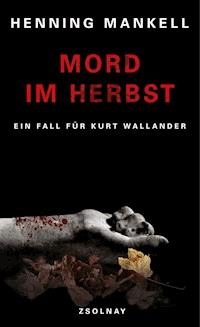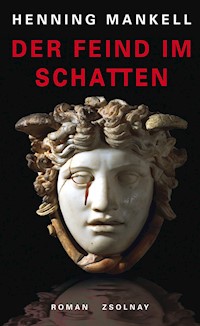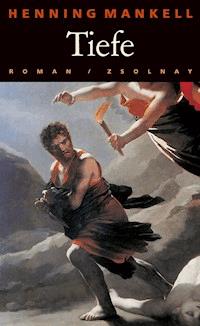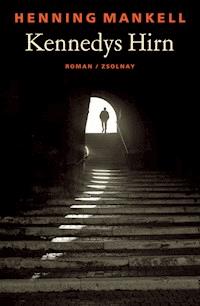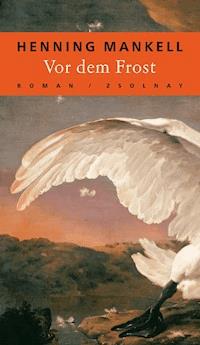
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kalb wird bei lebendigem Leib verbrannt, und sechs brennende Schwäne fliegen über den Marebo-See. Frauen verschwinden, eine Amerikanerin wird in der Kirche erdrosselt, und ein Lastwagen voller Dynamit lässt den Dom von Lund in Flammen aufgehen. In seinem neuen Kriminalroman spannt Henning Mankell den Bogen von dem furchtbaren Massaker in Jonestown, Guyana 1978, wo ein religiöser Fanatiker seinen Anhängern befahl, Selbstmord zu begehen, bis zum 11. September 2001. Mankell ist ein atemberaubender Roman gelungen: diesmal mit Linda Wallander in der Hauptrolle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zsolnay E-Book
Henning Mankell
Vor dem Frost
ROMAN
Aus dem Schwedischenvon Wolfgang Butt
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2002
unter dem Titel Innan frosten im Leopard förlag
in Stockholm.
Vorbemerkung des Übersetzers
Der mit schwedischen Verhältnissen vertraute Leser wird in der vorliegenden Übersetzung das in Schweden durchgängig gebrauchte Du als Anredeform vermissen. Es wurde, soweit es sich nicht um ein kollegiales oder freundschaftliches Du handelt, durch das den deutschen Gepflogenheiten entsprechende Sie ersetzt, auch wenn damit ein Stück schwedischer Authentizität des Textes verlorengeht.
ISBN 978-3-552-05763-0
© Henning Mankell 2002
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2003/2015
Schutzumschlaggestaltung: Peter-Andreas Hassiepen, München unter Verwendung eines Ausschnitts aus dem Gemälde »De bedreigde zwaan« von Jan Asselijn (1610–1652), Rijksmuseum, Amsterdam
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Prolog
JONESTOWN,NOVEMBER 1978
Die Gedanken in seinem Hirn waren wie ein Funkenregen von glühenden Nadeln. Der Schmerz war fast unerträglich. Verzweifelt versuchte er, klar zu denken und die Ruhe zu bewahren. Was quälte ihn am meisten? Er brauchte nicht nach der Antwort zu suchen: Es war die Angst. Daß Jim seine Hunde losließ und sie hinter ihm herhetzte, als wäre er ein aufgeschrecktes Wild auf der Flucht, was er eigentlich auch war. Es waren Jims Hunde, die ihm die meiste Angst machten. Die ganze lange Nacht zwischen dem 18. und dem 19. November, als er nicht mehr laufen konnte und sich zwischen den morschen Resten eines umgewehten Baums versteckte, meinte er zu hören, wie sich die Hunde näherten.
Jim läßt nie jemanden davonkommen, dachte er. Der Mann, dem ich einst zu folgen beschloß, weil er von einer grenzenlosen und göttlichen Liebe erfüllt zu sein schien, erweist sich jetzt als ein ganz anderer. Unmerklich hat er mit seinem eigenen Schatten oder mit dem Teufel, gegen den er immer gepredigt und vor dem er uns immer gewarnt hat, die Gestalt gewechselt. Dem Dämon der Ichbesessenheit, der uns daran hindert, Gott in Unterwürfigkeit und Gehorsam zu dienen. Was ich für Liebe hielt, hat sich jetzt in Haß verwandelt. Ich hätte es früher einsehen müssen. Jim hat es ja selbst klargemacht, ein um das andere Mal. Er hat uns die Wahrheit gegeben, doch nicht die ganze Wahrheit auf einmal, sondern in Form einer schleichenden Offenbarung. Aber weder ich noch einer von den anderen hat hören wollen, was wir hörten, was zwischen den Worten verborgen war. Es ist mein eigener Fehler, weil ich nicht verstehen wollte. Wenn er uns zu seinen Predigten versammelte oder uns seine Mitteilungen schickte, hat er nicht nur von der geistigen Vorbereitung gesprochen, der sich jeder einzelne unterziehen müsse, bevor der Tag des Gerichts anbreche. Er hat auch gesagt, daß wir in jedem Augenblick bereit sein müßten zu sterben.
Er unterbrach den Gedanken und horchte ins Dunkel hinaus. Hörte er nicht das entfernte Bellen der Hunde? Aber sie waren immer noch nur in ihm, eingeschlossen in seine eigene Angst. In seinem verwirrten, verschreckten Hirn kehrte er wieder zurück zu dem, was in Jonestown geschehen war. Er mußte verstehen. Jim war ihr Führer gewesen, ihr Hirte, ihr Pastor. Sie hatten sich ihm beim Auszug aus Kalifornien angeschlossen, als sie die Verfolgung, der sie von seiten der Behörden und der Massenmedien ausgesetzt waren, nicht mehr ertrugen. In Guyana wollten sie ihren Traum von einem freien Leben in Gott verwirklichen, in Eintracht miteinander und mit der Natur. Am Anfang war auch alles so gewesen, wie Jim gesagt hatte. Sie hatten davon gesprochen, daß sie ihr Paradies gefunden hatten. Aber irgend etwas war passiert. Vielleicht würden sie ihren großen Traum hier in Guyana nicht verwirklichen können? Vielleicht waren sie hier ebenso bedroht wie in Kalifornien? Vielleicht müßten sie nicht nur ein Land hinter sich lassen, sondern auch das Leben, um in Gemeinschaft mit Gott das Dasein zu schaffen, das sie einander versprochen hatten. »Ich habe meine eigenen Gedanken geprüft«, sagte Jim. »Ich habe weiter gesehen, als ich früher gesehen habe. Der Tag des Gerichts steht nahe bevor. Wenn wir nicht mit in den furchtbaren Mahlstrom gezogen werden wollen, müssen wir vielleicht sterben. Nur indem wir sterben, werden wir überleben.«
Sie sollten Selbstmord begehen. Als Jim das erstemal da auf dem Betplatz stand und darüber sprach, hatten seine Worte nichts Erschreckendes gehabt. Zuerst sollten die Eltern ihren Kindern von dem verdünnten Zyanid geben, das Jim in großen Plastikbehältern in einem verschlossenen Raum auf der Rückseite seines Hauses aufbewahrte. Dann würden sie selbst das Gift nehmen, und denjenigen, die zögerten und im letzten Augenblick ihren Glauben verrieten, würden Jim und seine engsten Mitarbeiter Hilfestellung leisten. Falls das Gift ausging, gab es Waffen. Jim persönlich würde dafür sorgen, daß alle tot waren, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete.
Er lag unter dem Baum und keuchte in der tropischen Hitze. Die ganze Zeit horchte er nach Jims Hunden. Den großen, rotäugigen Monstern, vor denen alle Angst hatten. Jim hatte gesagt, daß diejenigen, die sich entschieden hatten, in seiner Gemeinde zu leben, und die den großen Auszug aus Kalifornien hierher in die Wildnis von Guyana mitgemacht hatten, keinen anderen Weg gehen konnten als den von Gott bestimmten. Der Weg, den Jim Warren Jones bestimmt hatte, war der richtige.
Es klang so beruhigend, dachte er. Keiner konnte wie Jim Wörtern wie Tod, Selbstmord, Zyanid und Schußwaffen das Bedrohliche und Erschreckende nehmen und ihnen statt dessen den Klang von etwas Schönem und Erstrebenswertem verleihen.
Ein Schaudern durchfuhr ihn. Jim ist herumgegangen und hat alle Toten gesehen, dachte er. Er sieht, daß ich nicht dabei bin, und er wird die Hunde auf mich ansetzen. Der Gedanke traf ihn mit Wucht. Alle Toten. Ihm kamen die Tränen. Erst jetzt begriff er voll und ganz, was geschehen war. Sie waren alle tot, auch Maria und das Mädchen. Doch er wollte es nicht glauben. Maria und er hatten des Nachts flüsternd darüber gesprochen. Jim war im Begriff, wahnsinnig zu werden. Er war nicht mehr der Mann, der sie einst zu sich gelockt, ihnen Erlösung und einen Sinn des Lebens versprochen hatte, wenn sie sich der Volkstempelkirche anschlössen, die Jim gegründet hatte. Einst hatten sie es als Gnade empfunden, Jims Worte, das einzige Glück liege in der Hoffnung auf Gott, auf Christus, auf den Glauben an all das, was jenseits des irdischen Lebens wartete, das bald vorüber wäre. Maria hatte es am deutlichsten ausgesprochen: »Jims Augen haben begonnen zu flackern. Jim sieht uns nicht mehr an. Er sieht an uns vorbei, und seine Augen sind kalt, als meinte er es nicht mehr gut mit uns.«
Vielleicht sollten wir fortgehen, flüsterten sie des Nachts. Aber jeden Morgen sagten sie sich, daß sie das einmal gewählte Leben nicht aufgeben konnten. Jim würde bald wieder wie früher sein. Er machte eine Krise durch, seine Schwäche würde bald überwunden sein. Jim war der Stärkste von ihnen allen. Ohne ihn würden sie nicht in Verhältnissen leben, die trotz allem wie ein Bild des Paradieses waren.
Er wischte ein Insekt weg, das über sein verschwitztes Gesicht kroch. Der Dschungel war heiß, dampfend. Die Insekten kamen kriechend und krabbelnd von allen Seiten. Ein Ast drückte gegen sein Bein. Er fuhr hoch und glaubte, es sei eine Schlange. In Guyana gab es viele Giftschlangen. Allein in den letzten drei Monaten waren zwei Mitglieder der Kolonie von Schlangen gebissen worden, ihre Beine waren stark angeschwollen und hatten eine blauschwarze Färbung angenommen, bevor sie in übelriechenden Eiterbeulen aufplatzten. Eines der beiden, eine Frau aus Arkansas, war gestorben. Sie hatten sie auf dem kleinen Friedhof der Kolonie begraben, und Jim hatte eine seiner großen Predigten gehalten, genau wie früher, als er mit seiner Kirche, der Volkstempelkirche, nach San Francisco gekommen und rasch zu einem bekannten Erweckungsprediger geworden war.
Eine Erinnerung war deutlicher als alles andere in seinem Leben. Wie er von Alkohol und Drogen und von schlechtem Gewissen wegen des kleinen Mädchens, das er verlassen hatte, so elend und kaputt gewesen war, daß er nicht mehr wollte. Damals wollte er sterben, sich einfach vor einen Lastwagen oder einen Zug werfen, und dann wäre alles vorbei, niemand würde ihn vermissen, er selbst sich am wenigsten. Auf einer seiner letzten Wanderungen durch die Stadt, als er herumging, wie um sich von den Menschen zu verabschieden, denen es sowieso egal war, ob er lebte oder starb, kam er zufällig an dem Haus der Volkstempelkirche vorbei. »Es war die Vorsehung Gottes«, sagte Jim später, »es war Gott, der dich sah und beschloß, daß du einer der Auserwählten sein solltest, einer, dem die Gnade zuteil werden sollte, durch ihn zu leben.« Was ihn dazu getrieben hatte, in dieses Haus zu gehen, das keiner Kirche glich, wußte er noch immer nicht. Nicht einmal jetzt, da alles vorbei war und er unter einem Baum lag und darauf wartete, daß Jims Hunde kämen und ihn in Stücke rissen.
Er dachte, daß er weitermußte, seine Flucht fortsetzen mußte. Doch er konnte sein Versteck nicht verlassen. Außerdem konnte er Maria und das Mädchen nicht allein lassen. Er hatte schon einmal in seinem Leben ein Kind verlassen. Es durfte nicht wieder passieren.
Was war eigentlich geschehen? Am Morgen waren alle wie gewöhnlich früh aufgestanden. Sie hatten sich auf dem Betplatz vor Jims Haus versammelt und gewartet. Doch die Tür war geschlossen geblieben, wie so oft in der letzten Zeit. Sie hatten ihre Gebete allein gesprochen, alle neunhundertzwölf Erwachsenen und die dreihundertzwanzig Kinder, die in der Kolonie lebten. Dann waren sie an ihre Arbeit gegangen. Er hätte nicht überlebt, wenn er nicht an diesem Tag mit zwei anderen die Kolonie verlassen hätte, um zwei verschwundene Kühe zu suchen. Als er sich von Maria und ihrer Tochter verabschiedete, hatte er keinerlei Vorahnung einer drohenden Gefahr. Erst als sie auf die gegenüberliegende Seite der Schlucht gekommen waren, die die äußere Grenze zwischen der Kolonie und dem umgebenden Urwald darstellte, hatte er begriffen, daß etwas passierte.
Sie waren stehengeblieben, als sie aus der Kolonie Schüsse hörten, vielleicht hatten sie auch durch das laute Vogelgezwitscher, das sie umgab, Schreie von Menschen wahrgenommen. Sie hatten sich angesehen und waren in die Schlucht zurückgelaufen. Er hatte die beiden anderen aus den Augen verloren, er war nicht einmal sicher, ob sie nicht plötzlich beschlossen hatten zu fliehen. Als er aus dem Schatten der Bäume trat und über den Zaun zu dem Teil der Volkstempelkolonie kletterte, der von der großen Fruchtplantage eingenommen wurde, war es still. Viel zu still. Niemand pflückte irgendwelche Früchte. Es waren überhaupt keine Menschen zu sehen. Er lief zu den Häusern und begriff, daß etwas Furchtbares geschehen war. Jim war wieder herausgekommen. Er hatte die geschlossene Tür aufgestoßen. Aber er war nicht mit Liebe gekommen, sondern mit dem Haß, der immer öfter in seinen Augen zu sehen gewesen war.
Er merkte, daß er einen Krampf bekam, und drehte vorsichtig den Körper. Die ganze Zeit horchte er nach den Hunden. Aber er hörte nur das Knirschen der Heuschrecken und das Schwirren von Nachtvögeln, die über seinem Kopf dahinstrichen. Was hatte er vorgefunden? Als er durch die verlassene Fruchtplantage gelaufen war, hatte er versucht, das zu tun, was Jim immer als die einzige Möglichkeit des Menschen bezeichnet hatte, die große Gnade zu finden. Sein Leben in Gottes Hand zu legen. Jetzt hatte er sein Leben und sein Gebet in Gottes Hand gelegt: Was auch geschehen ist, laß Maria und das Mädchen unverletzt sein. Aber Gott hatte ihn nicht gehört. Er erinnerte sich, in seiner Verzweiflung gedacht zu haben, daß vielleicht Gott und Jim Jones die Schüsse aufeinander abgegeben hatten, die sie jenseits der Schlucht gehört hatten.
Es war, als stürmte er geradewegs auf die staubige Straße in Jonestown, wo Gott und Pastor Jim Warren Jones sich gegenüberstanden, um die letzten Schüsse aufeinander abzufeuern. Aber Gott hatte er nicht gesehen. Jim Jones war dagewesen, die Hunde hatten wie wahnsinnig in ihren Zwingern gebellt, und überall auf der Erde hatten Menschen gelegen, und er hatte sogleich gesehen, daß sie tot waren. Als seien sie von einer vom Himmel herabkommenden wütenden Faust niedergestreckt worden. Jim Jones und seine engsten Mitarbeiter, die sechs Brüder, die ihn immer begleiteten, seine Diener und Leibwächter, waren herumgegangen und hatten Kinder erschossen, die versuchten, von ihren toten Eltern fortzukriechen. Er war zwischen all diesen toten Körpern herumgelaufen und hatte nach Maria und dem Mädchen gesucht, ohne sie zu finden.
Als er Marias Namen brüllte, hatte Jim Jones nach ihm gerufen. Er hatte sich umgedreht und gesehen, daß sein Pastor eine Pistole auf ihn gerichtet hielt. Sie standen zwanzig Meter voneinander entfernt, zwischen ihnen auf der versengten Erde lagen die Toten, seine Freunde, zusammengekrümmt und wie verkrampft in ihren letzten Atemzügen. Jim hatte mit beiden Händen den Pistolenkolben gehalten, gezielt und abgedrückt. Der Schuß hatte ihn verfehlt. Bevor Jim zum zweitenmal schießen konnte, war er losgerannt. Mehrere Schüsse waren noch auf ihn abgegeben worden, und er hatte gehört, wie Jim vor Wut brüllte. Aber er war nicht getroffen worden, war über all die Toten hinweggestolpert und erst stehengeblieben, als es schon dunkel geworden war. Da war er unter den Baum gekrochen und hatte sich versteckt. Er wußte nicht, ob er der einzige Überlebende war. Wo waren Maria und das Mädchen? Warum sollte er allein verschont werden? Konnte ein einzelner Mensch den Jüngsten Tag überleben? Er begriff nicht. Doch er wußte, daß es kein Traum war.
Der Morgen dämmerte. Die Hitze stieg dampfend von den Bäumen auf. Da wußte er, daß Jim seine Hunde nicht loslassen würde. Er zog sich vorsichtig unter dem Baum hervor, schüttelte seine eingeschlafenen Beine und kam hoch. Dann ging er in die Richtung der Kolonie. Er war sehr erschöpft und wankte, starker Durst quälte ihn. Immer noch war alles still. Die Hunde sind tot, dachte er. Jim hatte gesagt, daß keiner entkommen sollte, auch die Hunde nicht. Er kletterte über den Zaun und begann zu laufen. Vor ihm auf dem Boden lagen die ersten Toten. Die, die versucht hatten, zu entkommen. Sie waren in den Rücken geschossen worden.
Dann blieb er stehen. Ein Mann lag vor ihm auf dem Boden, das Gesicht nach unten. Vorsichtig bückte er sich auf unsicheren Beinen und drehte den Körper um. Jim schaute ihm direkt in die Augen. Sein Blick hat aufgehört zu flackern, dachte er. Jim sieht mir wieder gerade in die Augen. Er zwinkert nicht einmal. Ein sinnloser Gedanke fuhr ihm durch den Kopf: Die Toten zwinkern nicht. Er spürte den Impuls, Jim zu schlagen, ihm ins Gesicht zu treten. Doch er tat es nicht. Er richtete sich auf, er war der einzige Lebende unter all den Toten, und er suchte weiter, bis er Maria und das Mädchen fand.
Maria hatte versucht zu fliehen. Sie war in den Rücken getroffen worden und vornübergefallen, und sie hatte das Mädchen in den Armen gehalten. Er hockte sich nieder und weinte. Jetzt gibt es nichts mehr, dachte er. Jim hat unser Paradies in eine Hölle verwandelt.
Er blieb bei Maria und dem Mädchen, bis ein Hubschrauber über der Kolonie zu kreisen begann. Da erhob er sich und ging davon. Er dachte an etwas, was Jim gesagt hatte, in der guten Zeit, kurz nach der Ankunft in Guyana. »Die Wahrheit über einen Menschen kann man ebenso mit der Nase erkennen wie mit den Augen oder dem Gehör. Der Teufel verbirgt sich im Menschen, und der Teufel riecht nach Schwefel. Wenn du den Schwefelgeruch spürst, sollst du das Kreuz hochhalten.«
Was ihn erwartete, wußte er nicht. Er fürchtete das, was kommen würde. Er fragte sich, wie er die große Leere würde füllen können, die Gott und Jim Jones zurückgelassen hatten.
Teil 1
AALDUNKEL
1
Kurz nach neun am Abend des 21. August 2001 kam Wind auf. Wellen kräuselten sich auf dem Marebosjö, der in einer Talsenke an der Südseite von Rommeleåsen lag. Der Mann, der in der Dunkelheit am Strand wartete, hielt eine Hand in die Luft, um zu prüfen, woher der Wind kam. Fast genau aus Süden, dachte er zufrieden. Also hatte er die richtige Stelle ausgesucht, um das Brot auszulegen und die Tiere anzulocken, die er bald opfern würde.
Er setzte sich auf den Stein, auf dem er einen Pullover ausgebreitet hatte, um nicht kalt zu werden. Es war abnehmender Mond. Die Wolkendecke am Himmel ließ kein Licht durch. Aaldunkel, dachte er. So nannte es mein schwedischer Spielkamerad in meiner Kindheit. Im Augustdunkel beginnt der Aal zu wandern. Dann stößt er gegen die Leitnetze und wandert ins Innere der Reuse. Er ist gefangen.
Er horchte ins Dunkel hinaus. Seine scharfen Ohren vernahmen das Geräusch eines Autos, das in einiger Entfernung vorbeifuhr. Sonst war alles still. Er holte seine Taschenlampe heraus und ließ den Strahl über den Strand und das Wasser gleiten. Sie kamen jetzt, er konnte sie sehen. Er machte zwei weiße Flecken gegen das dunkle Wasser aus, weiße Flecken, die zahlreicher und größer werden würden.
Er knipste die Lampe aus und suchte in seinem Hirn, das er zu einem treuen und untertänigen Mitarbeiter gezähmt und getrimmt hatte, nach einer Information darüber, wie spät es war. Drei Minuten nach neun, dachte er. Dann hob er den Arm. Die Uhrzeiger leuchteten im Dunkeln. Drei Minuten nach neun. Er hatte recht gehabt. Natürlich hatte er recht gehabt. In einer halben Stunde würde alles klar sein, und er würde nicht länger warten müssen. Er hatte gelernt, daß nicht nur Menschen von dem Bedürfnis getrieben wurden, pünktlich zu sein. Er hatte drei Monate gebraucht, um das, was an ebendiesem Abend geschehen sollte, vorzubereiten. Langsam und methodisch hatte er die Tiere, die er opfern wollte, an seine Anwesenheit gewöhnt. Er hatte sich zu ihrem Freund gemacht.
Das war seine wichtigste Fähigkeit im Leben. Er konnte mit allen Freund werden. Nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren. Er machte sich zum Freund, und niemand wußte, was er meinte und dachte. Er knipste die Taschenlampe wieder an. Die weißen Flecken waren mehr geworden, und sie waren gewachsen. Sie näherten sich dem Strand. Bald würde er nicht länger warten müssen. Er leuchtete mit der Lampe über den Strand. Dort lagen die beiden mit Benzin gefüllten Sprayflaschen und die Brotstücke, die er am Strand ausgestreut hatte. Er löschte die Lampe und wartete.
Als die Zeit gekommen war, handelte er so ruhig und methodisch, wie er es geplant hatte. Die Schwäne waren ans Ufer gekommen. Sie schnappten nach seinen Brotstücken und schienen nicht zu merken, daß ein Mensch in der Nähe war. Oder sie machten sich nichts daraus, weil sie sich daran gewöhnt hatten, daß er keine Gefahr darstellte. Er benutzte die Taschenlampe jetzt nicht mehr, sondern hatte eine Nachtsichtbrille aufgesetzt. Sechs Schwäne waren auf dem Strand, drei Paare. Zwei hatten sich hingelegt, während die anderen ihr Gefieder putzten oder weiter mit den Schnäbeln nach Brotstücken suchten.
Der Augenblick war da. Er stand auf, griff mit jeder Hand eine Sprayflasche und besprühte jeden einzelnen Vogel mit Benzin, und bevor sie fortflattern konnten, hatte er eine der Flaschen fallen gelassen und die andere angezündet. Das brennende Benzin setzte sofort die Flügel der Schwäne in Brand. Flatternden Feuerbällen gleich versuchten sie, ihrer Qual zu entkommen, indem sie auf den See hinausflogen. Er nahm das Bild und die Geräusche dessen, was er sah, in sich auf, die brennenden, schreienden Vögel, die über den See davonflatterten, bevor sie ins Wasser stürzten und mit zischenden und rauchenden Flügeln starben. Wie geborstene Trompeten, dachte er. So werde ich ihre letzten Schreie in Erinnerung behalten.
Es war sehr schnell gegangen. In weniger als einer Minute hatte er die Schwäne angezündet und sie davonflattern sehen, bis sie ins Wasser gestürzt waren und alles wieder dunkel war. Er war zufrieden. Alles war gutgegangen. Der Abend war so verlaufen, wie es beabsichtigt war, ein tastender Anfang.
Er warf die beiden Sprayflaschen in den See. Den Pullover, auf dem er gesessen hatte, steckte er in den Rucksack und leuchtete anschließend um sich herum den Strand ab, um sich zu vergewissern, daß er nichts vergessen hatte. Als er sicher war, keine Spuren hinterlassen zu haben, zog er ein Handy aus der Jackentasche. Er hatte es vor einigen Tagen in Kopenhagen gekauft. Es würde nicht zu ihm verfolgt werden können. Er tippte die Nummer ein und wartete.
Als er Antwort bekam, bat er darum, mit der Polizei verbunden zu werden. Das Gespräch war kurz. Dann schleuderte er das Handy in den See, warf sich den Rucksack über und verschwand in der Dunkelheit.
Der Wind hatte inzwischen auf West gedreht und wurde immer böiger.
2
Linda Caroline Wallander fragte sich an diesem Tag Ende August, ob es Ähnlichkeiten gab zwischen ihr und ihrem Vater, die sie noch nicht entdeckt hatte, obwohl sie jetzt bald dreißig Jahre alt war und eigentlich wissen müßte, wer sie war. Sie hatte ihn gefragt, manchmal sogar versucht, ihm eine Antwort abzupressen, doch er reagierte verständnislos und antwortete ausweichend, sie gliche wohl am meisten seinem Vater. Die »Ähnlichkeitsgespräche«, wie sie sie nannte, gingen manchmal in Meinungsverschiedenheiten über, die in heftigem Streit endeten. Sie flammten heiß auf, legten sich jedoch schnell wieder. Die meisten dieser Streitereien vergaß sie auch wieder, und sie nahm an, daß auch ihr Vater diese Gespräche, die aus dem Ruder gelaufen waren, nicht lange wiederkäute.
Aber von all den Streitgesprächen dieses Sommers konnte sie eins nicht vergessen. Es ging um eine Bagatelle. Dennoch hatte sie das Gefühl, daß sie hinter der eigentlichen Erinnerung Bruchstücke ihrer Kindheit und Jugend wiederentdeckte, die sie völlig verdrängt hatte. Am gleichen Tag, an dem sie von Stockholm nach Ystad gekommen war, Anfang Juli, hatten sie angefangen, sich über Erinnerungen zu streiten. Sie hatten einmal, als sie klein war, zusammen eine Reise nach Bornholm gemacht. Sie waren zu dritt gewesen, ihr Vater, ihre Mutter Mona und sie selbst, sechs oder vielleicht sieben Jahre alt. Der Anlaß des idiotischen Streits jetzt war die Frage gewesen, ob es damals windig war oder nicht. Sie hatten im lauen Wind auf dem engen Balkon zu Abend gegessen, als das Gespräch plötzlich auf die Reise nach Bornholm kam. Ihr Vater behauptete, Linda sei seekrank gewesen und habe seine Jacke vollgespuckt. Linda dagegen meinte, vollkommen klar ein spiegelglattes blaues Meer vor sich liegen zu sehen. Sie hatten nur diese eine Reise nach Bornholm gemacht, eine Verwechslung war also ausgeschlossen. Ihre Mutter war nicht gern übers Meer gefahren, und Lindas Vater erinnerte sich, wie verwundert er gewesen war, als sie der Bornholmfahrt zugestimmt hatte.
An jenem Abend, nachdem der eigentümliche Streit sich wie in nichts aufgelöst hatte, konnte Linda lange nicht einschlafen. In zwei Monaten würde sie als Polizeianwärterin im Polizeipräsidium von Ystad anfangen. Sie hatte die Ausbildung in Stockholm abgeschlossen und hätte am liebsten sofort angefangen zu arbeiten. Jetzt war sie den Sommer über untätig, und ihr Vater konnte ihr keine Gesellschaft leisten, weil er den größten Teil seines Urlaubs schon im Mai genommen hatte. Er glaubte, er hätte ein Haus gekauft, und wollte seinen Urlaub benutzen, um im Mai umzuziehen. Er hatte auch ein Haus gekauft, in Svarte, südlich der Landstraße, direkt am Meer. Aber im letzten Augenblick, als die Anzahlung schon geleistet war, war die Besitzerin, eine ältere, alleinstehende pensionierte Lehrerin, plötzlich in Panik geraten bei dem Gedanken, ihre Rosenbüsche und ihren Rhododendron einem Mann zu überlassen, der sich überhaupt nicht dafür zu interessieren schien, einem Mann, der ausschließlich davon redete, wo er die Hundehütte bauen würde, in der der Hund, den er vielleicht kaufen wollte, eines Tages leben sollte. Sie machte einen Rückzieher, der Makler schlug ihrem Vater vor, auf der Erfüllung des Kaufvertrags zu bestehen oder zumindest Schadenersatz zu verlangen, doch in Gedanken hatte Wallander das Haus, in das er nie eingezogen war, bereits abgeschrieben.
Den Rest seines Urlaubsmonats, in dem es kalt und windig war, verbrachte er mit der Suche nach einem anderen Haus. Aber entweder waren sie zu teuer, oder es war nicht das, wovon er all die Jahre in der Mariagata in Ystad geträumt hatte. Deshalb behielt er seine Wohnung und begann sich ernsthaft zu fragen, ob er jemals von dort wegkommen würde. Linda stand kurz vor dem Abschluß ihres letzten Semesters an der Polizeihochschule, und er fuhr an einem Wochenende hinauf und packte seinen Wagen voll mit einem Teil der Sachen, die sie mit nach Hause nehmen wollte. Im September sollte sie eine Wohnung bekommen, bis dahin würde sie in ihrem alten Zimmer wohnen.
Sie gingen sich sofort auf die Nerven. Linda war ungeduldig und meinte, daß ihr Vater an ein paar Fäden ziehen sollte, damit sie ihren Dienst früher antreten könnte. Er redete auch bei einer Gelegenheit mit seiner Chefin Lisa Holgersson, doch sie konnte nichts machen. Die neuen Polizeianwärter wurden zwar gebraucht, weil das Präsidium stark unterbesetzt war, aber es fehlte das Geld für die Gehälter. Linda konnte ihren Dienst nicht vor dem 10. September antreten, so dringend sie auch gebraucht wurde.
Im Laufe des Sommers frischte Linda zwei alte Freundschaften wieder auf, die seit ihren Teenagerjahren geschlummert hatten. Zufällig traf sie eines Tages auf dem Marktplatz Zeba, oder »Zebra«, wie alle sie nannten. Linda erkannte sie zuerst nicht. Sie hatte ihr schwarzes Haar rot gefärbt und kurz geschnitten. Zeba stammte aus dem Iran und war bis zur Neunten, als ihre Wege sich trennten, in Lindas Klasse gegangen. An diesem Julitag, als sie sich über den Weg liefen, schob Zebra einen Kinderwagen, und sie gingen in eine Konditorei und tranken Kaffee.
Zebra hatte sich zur Barkeeperin ausbilden lassen, hatte aber dann mit Marcus, den Linda auch kannte, ein Kind bekommen, Marcus, der exotische Früchte liebte und schon mit neunzehn Jahren an der östlichen Ausfahrt von Ystad seine eigene Pflanzenschule aufgemacht hatte. Ihr Verhältnis war auseinandergegangen, aber der Junge war da. Sie unterhielten sich lange, bis der Junge anfing, so schrill und nachdrücklich zu schreien, daß sie auf die Straße flohen. Aber nach diesem zufälligen Treffen blieben sie in Kontakt, und Linda bemerkte, daß ihre Ungeduld abnahm, wenn es ihr gelang, Brücken zurück in die Zeit zu schlagen, als sie noch nichts anderes von der Welt wußte als das, was der Horizont von Ystad ihr erlaubte.
Auf dem Heimweg in die Mariagata nach dem Treffen mit Zebra fing es plötzlich an zu regnen. Sie suchte Schutz in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone, und während sie darauf wartete, daß der Regen aufhörte, schlug sie im Telefonbuch Anna Westins Nummer nach. Ihr Herz machte einen Satz, als sie sie fand. Anna und sie hatten fast zehn Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Die intensive Freundschaft, die sie während ihres Aufwachsens verbunden hatte, war plötzlich und brutal zu Ende gegangen, als sie sich mit siebzehn in denselben Jungen verliebten. Als dann die Verliebtheit bei beiden vorüber und vergessen war, hatten sie versucht, ihre frühere Freundschaft wiederzubeleben. Doch etwas war dazwischengekommen, und schließlich hatten sie es aufgegeben. In den letzten Jahren hatte Linda nur selten an Anna gedacht. Aber die Begegnung mit Zebra hatte die Erinnerungen wachgerufen, und sie freute sich, als sie sah, daß Anna tatsächlich noch in Ystad wohnte, in einer der Straßen hinter der Mariagata, gleich bei der Ausfahrt in Richtung Österlen.
Am gleichen Abend rief Linda an, und sie verabredeten sich für einen der folgenden Tage. Danach trafen sie sich mehrmals in der Woche, manchmal alle drei, doch meistens nur Anna und Linda. Anna wohnte allein und lebte von Studiengeld, mit dem sie mühsam ihr Medizinstudium finanzierte.
Linda hatte den Eindruck, Anna sei womöglich noch scheuer geworden als damals in den Jahren ihres gemeinsamen Heranwachsens. Ihr Vater hatte sie und ihre Mutter verlassen, als sie fünf oder sechs Jahre alt war. Er hatte nie mehr etwas von sich hören lassen. Annas Mutter lebte draußen auf dem Land, nicht weit von Löderup, wo Lindas Großvater viele Jahre lang gelebt und seine ewig gleichen Bilder gemalt hatte. Anna schien froh darüber zu sein, daß Linda den Kontakt zu ihr gesucht hatte und fortan wieder in Ystad leben würde. Doch Linda spürte, daß sie mit der Freundin äußerst behutsam umgehen mußte. Sie hatte etwas Zerbrechliches, etwas Scheues. Linda durfte ihr nicht zu nahe kommen. Aber in dieser Gemeinschaft, mit Zebra, ihrem Sohn und Anna, ertrug Linda immerhin den sich dahinschleppenden Sommer, während sie darauf wartete, zum Polizeipräsidium hinaufzugehen, mit der dicken Frau Lundberg zu sprechen, die der Kleiderkammer vorstand, und ihre Uniform und die übrige Ausstattung in Empfang zu nehmen und zu quittieren.
Den Sommer über arbeitete ihr Vater fast ausschließlich, aber erfolglos, an der Aufklärung einer Serie schwerer Raubüberfälle auf Banken und Postämter in Ystad und Umgebung. Dann und wann hörte Linda ihn auch von einigen großen Dynamitdiebstählen sprechen, die offenbar in einer sorgfältig geplanten Aktion durchgeführt worden waren. Wenn er abends eingeschlafen war, ging Linda seine Notizen und die Ermittlungsmappen durch, die er häufig mit nach Hause brachte. Aber wenn sie versuchte, ihn danach zu fragen, woran er gerade arbeitete, antwortete er ausweichend. Noch war sie keine Polizistin. Sie mußte mit ihren Fragen bis zum September warten.
Der Sommer verging. Eines Tages im August kam ihr Vater am frühen Nachmittag nach Hause und sagte, ein Makler habe angerufen und berichtet, er hätte jetzt ein Haus gefunden und sei überzeugt, daß es Wallander gefallen würde. Es lag nicht weit von Mossby Strand an einem Hang, der zum Meer hin abfiel. Er fragte Linda, ob sie Lust habe, mitzufahren und das Haus anzusehen. Sie rief Zebra an, mit der sie verabredet war, und verschob ihr Treffen auf den nächsten Tag.
Dann setzten sie sich in Wallanders Peugeot und verließen die Stadt in westlicher Richtung. Das Meer an diesem Tag war grau und kündete vom Herbst, der vor der Tür stand.
3
Das Haus war leer und verbarrikadiert. Dachziegel waren weggeweht, eins der Fallrohre war halb abgerissen. Das Haus lag auf einem Hügel mit unbehinderter Sicht aufs Meer. Aber es strahlte etwas Unbarmherziges und Einsames aus, dachte Linda. Dies ist kein Haus, in dem mein Vater seine Ruhe finden kann. Hier wird er nur von seinen Dämonen gejagt werden. Aber was für Dämonen sind es eigentlich? Was quälte ihn am meisten? In Gedanken versuchte sie, seine dunkleren Seiten in eine Rangordnung zu bringen; als erstes kam seine Einsamkeit, dann das steigende Übergewicht und die Steifheit seiner Gelenke. Doch danach? Sie ließ den Gedanken an die Liste fallen und beobachtete heimlich ihren Vater, wie er auf dem Grundstück umherging und das Haus inspizierte. Der Wind zog langsam, beinah grüblerisch durch ein paar hohe Buchen. Tief unter ihnen lag das Meer. Linda kniff die Augen zusammen und sah ein Schiff am Horizont.
Kurt Wallander betrachtete seine Tochter. »Du ähnelst mir, wenn du die Augen zusammenkneifst.«
»Nur dann?«
Sie gingen weiter. Auf der Rückseite des Hauses lag ein vergammeltes Ledersofa. Eine Feldmaus schreckte zwischen den Federn auf und huschte davon. Der Vater blickte sich um und schüttelte den Kopf. »Warum will ich eigentlich aufs Land?«
»Willst du, daß ich dich das frage? Dann tu ich es. Warum willst du aufs Land?«
»Es war immer mein Traum, morgens aus dem Bett zu steigen und direkt hinaus ins Freie treten und pinkeln zu können.«
Sie sah ihn belustigt an. »Nur deshalb?«
»Was könnte ein besseres Motiv sein? Fahren wir?«
»Wir machen noch eine Runde.«
Diesmal betrachtete sie das Haus mit größerer Aufmerksamkeit, als sei sie selbst eine kauflustige Spekulantin und ihr Vater der Makler. Sie schnüffelte herum wie ein Tier, das Witterung aufnahm. »Was kostet dieses Haus?«
»Vierhunderttausend.«
Sie schüttelte ungläubig den Kopf.
»Wirklich«, sagte er.
»Hast du so viel Geld?«
»Nein. Aber die Bank hat versprochen, mir ihre Pforten zu öffnen. Ich bin vertrauenswürdig. Ein Polizeibeamter, der sein Leben lang seine Finanzen ordentlich geführt hat. Eigentlich macht es mich ein bißchen traurig, daß mir dieses Haus nicht richtig gefällt. Ein leeres Haus ist genauso bedrückend wie ein verlassener Mensch.«
Sie fuhren weiter. Linda las einen Wegweiser, an dem sie vorüberkamen: »Mossby Strand«.
Er warf ihr einen Blick zu. »Willst du hinfahren?«
»Ja. Wenn du Zeit hast.«
Ein einsamer Wohnwagen stand auf dem Parkplatz am Strand. Der Kiosk war geschlossen. Ein Mann und eine Frau, die deutsch miteinander sprachen, saßen auf kaputten Plastikstühlen vor dem Wohnwagen. Zwischen ihnen stand ein Tisch. Sie spielten Karten und waren hoch konzentriert. Linda und Kurt Wallander gingen zum Strand hinunter.
Genau an diesem Strand hatte sie ihm vor einigen Jahren ihren Entschluß mitgeteilt. Sie wollte nicht mehr Möbelpolsterin werden, und auch in den vagen Traum, vielleicht Schauspielerin zu werden, hatte sie kein rechtes Vertrauen mehr. Sie hatte aufgehört, rastlos in der Welt umherzureisen. Es war lange her, daß sie mit einem Jungen aus Kenia zusammengewesen war, der in Lund Medizin studierte und ihre größte Liebe war, auch wenn die Erinnerung daran in den letzten Jahren verblaßt war. Jetzt war er in seine Heimat zurückgefahren, und sie war ihm nicht gefolgt. Linda hatte versucht, die Leitlinien für ihr Leben zu finden, indem sie das Leben ihrer Mutter Mona betrachtete. Doch sie hatte nur eine Frau gesehen, die immer alles halb machte und dann liegenließ. Mona hatte zwei Kinder haben wollen, aber nur eins bekommen, und sie hatte geglaubt, daß Kurt Wallander die einzige und große Liebe ihres Lebens sei. Aber sie ließ sich scheiden und lebte jetzt in zweiter Ehe mit einem golfspielenden, aus Gesundheitsgründen vorzeitig pensionierten Prokuristen in Malmö.
Linda hatte daraufhin mit neuerwachter Neugier angefangen, ihren Vater zu betrachten, den Kriminalbeamten, der immer vergaß, sie am Flugplatz abzuholen, wenn sie zu Besuch kam. Sie hatte ihm insgeheim sogar einen Namen gegeben: der Mann, der immer vergißt, daß es mich gibt. Aber sie spürte, daß er derjenige war, jetzt, da ihr Großvater nicht mehr lebte, der ihr am nächsten stand. Es war, als ob sie das Fernglas umdrehte, ihn an einen Ort versetzte, wo es ihn weiterhin gab, er aber nicht zu nahe war. Eines Morgens, als sie nach dem Aufwachen noch ein wenig liegen blieb, wurde ihr auf einmal klar, was sie mit ihrem Leben machen wollte: Sie wollte wie er sein, zur Polizei gehen. Ein Jahr lang hatte sie den Gedanken für sich behalten und nur mit ihrem damaligen Freund darüber gesprochen, aber nachdem sie selbst überzeugt war, hatte sie als erstes mit ihrem Freund Schluß gemacht und war anschließend nach Schonen hinuntergefahren, hatte ihren Vater mit an diesen Strand genommen und es ihm gesagt. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie erstaunt er gewesen war. Er hatte darum gebeten, eine Minute überlegen zu dürfen, was er von ihrem Entschluß hielt. Da war sie auf einmal unsicher geworden. Vorher hatte sie gedacht, er würde sich über ihre Entscheidung freuen. In dieser kurzen Minute, als er ihr seinen breiten Rücken zuwandte und der Wind sein schütteres Haar hochwehte wie eine Tüte, hatte sie sich darauf vorbereitet, daß sie streiten würden. Aber als er sich umwandte und lächelte, wußte sie Bescheid.
Sie gingen bis ans Wasser. Linda zog mit dem Fuß die Spur eines Pferdehufs nach. Kurt Wallander beobachtete eine Möwe, die unbeweglich in der Luft über seinem Kopf stand.
»Was denkst du?« fragte sie.
»Worüber? Über das Haus?«
»Darüber, daß ich bald in Uniform vor dir auftreten werde.«
»Es fällt mir schwer, mir das richtig vorzustellen. Einzusehen, daß ich wohl aufgeregt sein werde.«
»Warum aufgeregt?«
»Vielleicht weil ich weiß, wie du dich fühlen wirst. In eine Uniform zu steigen ist nicht schwer. Aber sich dann öffentlich darin zu zeigen, das ist schwer. Du merkst, daß alle dich sehen. Du bist die Polizistin, die mitten auf der Straße steht und bereit sein muß, einzugreifen und wütende Menschen auseinanderzureißen. Ich weiß, was dir bevorsteht.«
»Ich habe keine Angst.«
»Ich rede nicht von Angst. Ich rede davon, daß die Uniform von dem Tag an, an dem du sie anziehst, immer da ist.«
Sie ahnte, daß er recht hatte. »Was glaubst du, wie es geht?«
»An der Schule ging es gut. Hier geht es gut. Du selbst bestimmst, ob es gutgeht oder nicht.«
Sie wanderten am Strand entlang. Sie erzählte, daß sie in ein paar Tagen nach Stockholm fahren würde. Ihr Jahrgang wollte sich zu einem Abschiedsball treffen, bevor sie endgültig in die verschiedenen Polizeibezirke im ganzen Land verstreut wurden.
»Wir hatten keinen Ball«, sagte er. »Ich hatte so gut wie keine Ausbildung, als ich damals anfing. Ich frage mich noch immer, wie diejenigen, die damals zur Polizei wollten, auf ihre Eignung getestet wurden. Die rohe Kraft, glaube ich. Und allzu dumm durfte man nicht sein. Aber ich weiß noch, daß ich ein Bier trank, als ich meine Uniform bekommen hatte. Nicht auf der Straße natürlich, sondern bei einem Kameraden in der Södra Förstadsgata in Malmö.«
Er schüttelte den Kopf. Linda konnte nicht sagen, ob die Erinnerung ihn amüsierte oder quälte.
»Ich wohnte noch zu Hause. Ich glaubte, mein Vater würde verrückt, als ich mit der Uniform nach Hause kam.«
»Warum fand er es so schrecklich, daß du Polizist wurdest?«
»Er hat mich zum Narren gehalten. Ich habe das erst begriffen, als er tot war.«
Linda blieb wie angewurzelt stehen. »Dich zum Narren gehalten?«
Er sah sie an und lächelte. »Eigentlich fand er es ganz gut, daß ich Polizist wurde. Aber statt das zuzugeben, machte er sich einen Jux daraus, mich im ungewissen darüber zu lassen. Und das schaffte er ja auch, wie du weißt.«
»Ist das wirklich wahr?«
»Niemand kannte meinen Vater besser als ich. Ich weiß, daß ich recht habe. Der Alte war ein Schurke. Ein wunderbar schurkiger Vater. Der einzige, den ich hatte.«
Sie gingen zum Wagen zurück. Die Wolkendecke war aufgerissen. Als die Sonne durchbrach, wurde es sofort wärmer. Die beiden kartenspielenden Deutschen schauten nicht auf, als sie vorbeigingen.
Als sie zum Wagen kamen, sah er auf die Uhr. »Hast du es eilig, nach Hause zu kommen?« fragte er.
»Ich kann es nicht erwarten, endlich mit der Arbeit anzufangen. Das ist alles. Warum fragst du, ob ich es eilig habe? Ich bin ungeduldig.«
»Ich muß noch einer Sache nachgehen. Ich erzähle dir im Wagen davon.«
Sie nahmen die Straße nach Trelleborg und bogen bei der Abfahrt zum Schloß Charlottenlund ab.
»Eigentlich ist es keine richtige Ermittlung«, sagte er. »Aber da ich schon mal in der Nähe bin, kann ich ja vorbeifahren.«
»Wo vorbeifahren?«
»Am Schloß Marebo. Oder genauer gesagt am See bei Schloß Marebo.«
Die Straße war schmal und kurvenreich. Er erzählte genauso langsam und ruckhaft, wie er fuhr. Linda fragte sich, ob seine geschriebenen Berichte ähnlich schlecht waren wie die mündliche Darstellung, die er ihr gerade gab.
Das Ganze war trotzdem sehr einfach. Vorgestern abend war bei der Polizei in Ystad ein Anruf eingegangen. Ein Mann, der weder seinen Namen nennen noch sagen wollte, von wo er anrief, und der mit einem undeutlichen Dialekt sprach, sagte, daß über dem Marebosee brennende Schwäne zu sehen gewesen seien. Eine ausführlichere Aussage hatte er nicht machen können oder nicht machen wollen. Als der Wachhabende ihm Fragen stellen wollte, hatte er aufgelegt. Er hatte sich nicht wieder gemeldet. Der Anruf wurde zu Protokoll genommen, ohne daß eine Maßnahme veranlaßt wurde, weil gerade dieser Abend ungewöhnlich turbulent war mit einer schweren Körperverletzung in Svarte und zwei Einbrüchen in Geschäfte im Zentrum von Ystad. Man kam zu der Einschätzung, daß es sich um eine optische Täuschung handelte oder daß der Anruf nichts weiter war als grober Unfug. Nur er selbst, als Martinsson ihm von dem Ganzen erzählte, dachte sogleich, daß es unwahrscheinlich genug klang, um wirklich wahr zu sein.
»Brennende Schwäne? Wer tut denn so was?«
»Ein Sadist. Ein Tierquäler.«
»Glaubst du denn, daß es stimmt?«
Er hatte an der Hauptstraße angehalten. Erst nachdem er sie überquert hatte und nach Marebo abgebogen war, antwortete er. »Hast du das nicht auf der Schule gelernt? Daß Polizisten nicht soviel glauben. Sie wollen wissen. Gleichzeitig sind sie darauf gefaßt, daß wirklich alles geschehen kann. Unter anderem, daß jemand anruft und eine Meldung über brennende Schwäne macht. Und daß die Information sich als zutreffend erweist.«
Linda stellte keine weiteren Fragen. Sie bogen auf einen Parkplatz ein und gingen den Hügel hinab bis zum See. Linda ging unmittelbar hinter ihrem Vater und dachte, daß sie bereits eine Uniform trug, auch wenn sie noch unsichtbar war.
Sie gingen um den See herum, ohne eine Spur von toten Schwänen zu finden. Keiner von beiden bemerkte, daß jemand sie durch die Linse eines Fernglases auf ihrem Spaziergang verfolgte.
4
Ein paar Tage später, an einem klaren und ruhigen Morgen, flog Linda nach Stockholm. Zebra hatte ihr geholfen, ein Ballkleid zu nähen. Es war hellblau und vorn und am Rücken tief ausgeschnitten. Ihr Jahrgang hatte einen alten Festsaal an der Hornsgata gemietet. Alle waren gekommen, sogar der verlorene Sohn des Jahrgangs. Von den achtundsechzig Schülern, die mit Linda zusammen angefangen hatten, mußte einer die Ausbildung abbrechen, nachdem sich gezeigt hatte, daß er ein gravierendes Alkoholproblem hatte, das er weder verheimlichen noch in den Griff bekommen konnte. Niemand wußte, wer bei der Schulleitung gepetzt hatte. Wie in einer stillschweigenden Übereinkunft hatten sie entschieden, daß sie alle gleichermaßen verantwortlich waren. Linda stellte ihn sich als ihr Gespenst vor. Er würde immer da draußen im Herbstdunkel sein, mit einer bohrenden Sehnsucht danach, in Gnaden wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden.
An diesem Abend, als sie zum letztenmal mit ihren Lehrern zusammenkamen, trank Linda viel zuviel Wein. Es kam zuweilen vor, daß sie beschwipst war, doch sie meinte immer, zu wissen, wann sie genug hatte. An diesem Abend trank sie jedoch zuviel. Vielleicht weil ihre Ungeduld ihr stärker zu schaffen machte, als sie so viele ehemalige Mitschüler traf, die bereits angefangen hatten zu arbeiten. Ihr bester Freund aus der Hochschulzeit, Mattias Olsson, hatte sich entschieden, nicht nach Sundsvall zurückzugehen, wo er herkam, und arbeitete jetzt bei der Ordnungspolizei in Norrköping. Er hatte sich schon ausgezeichnet, als er einen unter dem Einfluß anaboler Steroide amoklaufenden Bodybuilder niedergerungen hatte. Linda gehörte zu den wenigen, die noch warteten.
Sie tanzten, Zebras Ballkleid erhielt viel Lob, einige hielten Reden, andere sangen ein in Maßen spöttisches Lied auf das Lehrerkollegium, und es wäre alles in allem ein gelungener Abend gewesen, wenn nicht einer der Köche einen Fernseher in der Küche gehabt hätte.
Die Spätnachrichten brachten als Hauptthema die niederschmetternde Neuigkeit, daß ein Polizist in der Nähe von Enköping auf offener Straße niedergeschossen worden war. Die Nachricht sprach sich im Nu unter den tanzenden und trinkenden Polizeiaspiranten und ihren Lehrern herum. Die Musik wurde abgestellt, der Fernseher aus der Küche hereingetragen, und es war, dachte Linda nachher, als hätten sie alle einen Tritt in den Bauch bekommen. Plötzlich war das Fest geplatzt, das Licht wurde fahl, sie saßen da in ihren Ballkleidern und Anzügen und sahen die Bilder eines Polizisten, der niedergemäht worden war wie bei einer kaltblütigen Hinrichtung, als er zusammen mit einem Kollegen versuchte, einen gestohlenen Wagen anzuhalten. Zwei Männer waren herausgesprungen und hatten aus Maschinenpistolen gefeuert. Es waren keine Warnschüsse abgegeben worden, sie hatten in eindeutiger Tötungsabsicht gehandelt. Das Fest war vorbei, die Wirklichkeit hämmerte hart an die Tür.
Spät in der Nacht, als sie auseinandergegangen waren und Linda auf dem Weg zu ihrer Tante Kristina war, bei der sie übernachtete, blieb sie am Mariatorg stehen und rief ihren Vater an. Es war drei Uhr, und sie hörte seine verschlafene Stimme. Dennoch wurde sie ärgerlich. Er sollte nicht schlafen, wenn ein paar Stunden zuvor ein Kollege ermordet worden war. Das sagte sie auch.
»Nichts wird besser davon, daß ich nicht schlafe. Wo bist du?«
»Auf dem Weg zu Kristina.«
»Habt ihr bis jetzt gefeiert? Wie spät ist es eigentlich?«
»Drei. Es war zu Ende, als wir hörten, was passiert war.«
Er atmete schwer, als habe er sich immer noch nicht entschieden, wach zu werden.
»Was sind das für Geräusche im Hintergrund?«
»Nachtverkehr. Ich warte auf ein Taxi.«
»Wer ist bei dir?«
»Niemand.«
»Du kannst doch nicht mitten in der Nacht allein durch Stockholm laufen!«
»Ich komm schon klar. Ich bin kein Kind mehr. Entschuldige, daß ich dich geweckt habe.«
Wütend drückte sie auf die Aus-Taste ihres Handys. Es passiert zu oft, dachte sie. Es macht mich rasend. Und er merkt nicht, daß er mir auf den Geist geht.
Sie winkte ein Taxi heran und fuhr hinaus nach Gärdet, wo Kristina mit ihrem Mann und ihrem achtzehnjährigen Sohn lebte, der noch zu Hause wohnte. Kristina hatte ihr im Wohnzimmer das Sofa zurechtgemacht. Das Licht einer Straßenlaterne fiel ins Zimmer. Auf einem Bücherregal stand ein Foto von ihrem Vater, ihrer Mutter und ihr selbst. Es war vor vielen Jahren aufgenommen worden. Sie war damals vierzehn, und sie erinnerte sich noch gut daran. Es war im Frühjahr gewesen, vielleicht an einem Sonntag. Sie waren nach Löderup hinausgefahren. Ihr Vater hatte den Fotoapparat bei einem Wettbewerb im Polizeipräsidium gewonnen, und als sie das Bild machen wollten, hatte ihr Großvater sich plötzlich geweigert und sich bei seinen Gemälden im Nebengebäude eingeschlossen. Ihr Vater war wütend geworden, Mona war eingeschnappt und hatte sich zurückgezogen. Linda war zu ihrem Großvater hineingegangen und hatte versucht, ihn zu überreden, herauszukommen und sich mit ihnen fotografieren zu lassen.
»Ich will nicht auf Bildern sein, auf denen Menschen, die bald auseinandergehen, dastehen und grinsen«, hatte er geantwortet.
Sie erinnerte sich noch, wie weh es getan hatte. Auch wenn sie hätte wissen müssen, wie unsensibel ihr Großvater sein konnte, hatten seine Worte sie getroffen wie eine Ohrfeige. Dann war es ihr gelungen, sich zu fassen und ihn zu fragen, ob es stimmte, ob er etwas wüßte, was ihr nicht bekannt sei.
»Nichts wird davon besser, daß du die Augen verschließt«, hatte er gesagt. »Geh jetzt raus. Du sollst mit auf das Bild. Vielleicht täusche ich mich.«
Sie saß auf dem zum Schlafen zurechtgemachten Sofa und dachte, daß ihr Großvater fast nie recht gehabt hatte. Aber diesmal hatte er gewußt, wovon er redete. Er hatte sich geweigert, mit auf dem Foto zu sein, das mit Selbstauslöser gemacht wurde. Während des folgenden Jahres, des letzten gemeinsamen Jahres ihrer Eltern, hatten die Spannungen zugenommen.
In dieser Zeit hatte sie zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Das erstemal, als sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte, war es der Vater gewesen, der sie gefunden hatte. Sie konnte noch immer das Bild seiner Angst vor sich sehen. Aber die Ärzte mußten ihm gesagt haben, daß zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefahr bestanden hatte. Die Eltern hatten ihr kaum Vorwürfe gemacht, und die wenigen erreichten sie nicht in Worten, sondern in Blicken und in Schweigen. Dagegen wurde bei ihren Eltern die letzte gewaltsame Eruption von Streit ausgelöst, die dazu führte, daß Mona eines Tages ihre Koffer packte und auszog.
Linda dachte später, wie seltsam es war, daß sie nicht die Verantwortung für die Scheidung ihrer Eltern auf sich genommen hatte. Aber eigentlich hatte sie ihnen einen Dienst erwiesen, sagte sie sich trotzig; sie hatte dazu beigetragen, eine Ehe zu beenden, die seit langem abgeschlossen und vorüber war. Sie hatte sich oft in Erinnerung gerufen, daß sie trotz ihres leichten Schlafs und der Hellhörigkeit der Wohnung nie von nächtlichen Geräuschen aus dem Schlafzimmer wach geworden war, die darauf schließen ließen, daß die Eltern sich liebten. Sie hatte einen Keil in die Ehe ihrer Eltern getrieben, der sie endgültig voneinander befreit hatte.
Von dem zweiten Selbstmordversuch wußte ihr Vater nichts. Das war ihr größtes Geheimnis vor ihm. Manchmal glaubte sie, er hätte doch erfahren, was geschehen war. Aber ebenso häufig war sie davon überzeugt, daß er nichts ahnte. Diesmal war es ihr ernst gewesen. Sie sah alles noch ganz klar vor sich.
Sie war sechzehn und zu ihrer Mutter nach Malmö gefahren. Es war eine Zeit großer Niederlagen, so großer Niederlagen, wie man sie nur als Teenager erlebt. Sie mochte sich selbst nicht leiden, schrak vor ihrem Spiegelbild zurück, das sie gleichzeitig liebte, nichts an ihrem Körper war, wie es sein sollte. Die Depression kam schleichend, wie eine Krankheit, deren Symptome zunächst vage und nicht der Beachtung wert waren. Aber auf einmal war es zu spät, und sie wurde von einer unbezwingbaren Depression befallen, als ihre Mutter für all ihre Qualen nur Unverständnis aufbrachte. Was sie am meisten erschütterte, war Monas Nein, als sie sie gebeten hatte, nach Malmö ziehen zu dürfen. Sie konnte sich über das Zusammenleben mit ihrem Vater nicht beklagen, es war die Kleinstadt, aus der sie fortwollte. Aber Mona blieb hart.
Im Zorn hatte Linda die Wohnung verlassen. Es war im zeitigen Frühjahr, noch Schnee auf den Beeten und an den Straßenrändern, ein beißender Wind kam vom Sund herüber, und sie war durch die Straßen gelaufen, die endlose Regementsgata entlang zur Ausfahrt Richtung Ystad. Irgendwo hatte sie sich verlaufen. Sie hatte die gleiche Angewohnheit wie ihr Vater, beim Gehen auf den Boden zu starren. Wie er war sie bei verschiedenen Gelegenheiten gegen Laternenpfähle oder parkende Autos gelaufen. Sie war zu einer Brücke über eine Autobahn gekommen. Ohne wirklich zu wissen, warum, war sie auf das Brückengeländer geklettert, wo sie anfing, im Wind zu schwanken. Sie schaute hinab auf die heranrasenden Autos und die gleißenden Lichter, die das Dunkel zerschnitten. Wie lange sie so stand, wußte sie nicht. Es war wie eine letzte große Vorbereitung, sie hatte nicht einmal Angst oder Selbstmitleid verspürt. Sie hatte nur darauf gewartet, daß die schwere Müdigkeit oder die Kälte sie dazu brachten, den Schritt hinaus in die Leere zu tun.
Plötzlich hatte jemand hinter ihr gestanden, oder vielleicht neben ihr, und behutsam zu ihr gesprochen. Es war eine Frau, eine junge Frau mit kindlichem Aussehen, vielleicht nicht viel älter als sie selbst. Aber sie trug eine Uniform, sie war Polizistin. Weiter hinten auf der Brücke standen zwei Polizeiwagen mit kreisendem Blaulicht. Aber nur diese Polizistin mit dem kindlichen Gesicht hatte sich genähert. Im Hintergrund hatte Linda die Schatten anderer Menschen wahrgenommen, die warteten, die die Verantwortung dafür, diese Idiotin von dem Brückengeländer herunterzuholen, einer jungen Frau übertragen hatten, die nur wenig älter war als sie selbst. Sie hatte mit ihr gesprochen, hatte gesagt, daß sie Annika heiße und nur wolle, daß Linda da herunterkäme, ein Sprung ins Leere sei keine Lösung, egal, welches Problem sie habe. Linda hatte widersprochen, sie hatte das Gefühl, das, was sie tat, verteidigen zu müssen. Wie konnte Annika wissen, wovon sie sich befreien wollte? Aber Annika gab nicht nach, sie wirkte vollkommen ruhig, als sei sie mit einer unerschöpflichen Geduld ausgestattet. Als Linda schließlich vom Geländer herunterkletterte und zu weinen anfing, aus einer Enttäuschung heraus, die natürlich zum Teil Erleichterung war, hatte auch Annika geweint. Sie hatten dagestanden und sich umarmt. Linda bat darum, daß ihr Vater, der auch Polizist sei, nichts erführe. Und ihre Mutter auch nicht, aber vor allem nicht ihr Vater. Annika versprach es ihr, und das Versprechen hatte sie gehalten. Viele Male hatte Linda sich vorgenommen, sie anzurufen. Sie hatte die Hand am Telefon gehabt, um im Polizeipräsidium in Malmö anzurufen. Aber jedesmal hatte sie die Hand wieder zurückgezogen.
Sie stellte das Foto zurück aufs Bücherregal, dachte an den Polizisten, der ermordet worden war, und legte sich hin, um zu schlafen. Von der Straße waren ein paar lärmende Personen zu hören, die sich stritten. Sie dachte, daß sie bald mitten zwischen ihnen stehen würde und zu schlichten versuchen müßte. Aber war es wirklich das, was sie wollte? Die Wirklichkeit in Gestalt des ermordeten Polizisten auf einer Straße in Enköping gab ihr zu denken.
In dieser Nacht fand sie keine Ruhe. Am Morgen wurde sie von Kristina geweckt, die jedoch in Eile war, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Kristina war in jeder Hinsicht das Gegenteil ihres Bruders. Sie war groß und schlank, hatte ein spitzes Gesicht und sprach mit einer piepsigen, schrillen Stimme, über die Lindas Vater sich bei seiner Tochter oft lustig gemacht hatte. Aber Linda mochte ihre Tante. Sie hatte etwas Einfaches, nichts brauchte kompliziert zu sein. Auch darin war sie das Gegenteil ihres Bruders, der überall Probleme sah, unlösbare Probleme, was das Privatleben anging, Probleme, auf die er sich wie ein wütender Bär stürzte, was die Arbeit betraf.
Um kurz vor neun fuhr Linda nach Arlanda hinaus, um zu versuchen, eine Maschine nach Malmö zu bekommen. Die Zeitungsaushänger posaunten den Polizistenmord heraus. Sie bekam einen Platz in einer Maschine um zwölf Uhr und rief ihren Vater an, der sie in Sturup abholte.
»War es schön?« fragte er.
»Was glaubst du?«
»Ich weiß nicht. Ich war ja nicht da.«
»Darüber haben wir heute nacht gesprochen, falls du dich erinnerst.«
»Natürlich erinnere ich mich. Du warst unhöflich.«
»Ich war müde und verbittert. Ein Polizist ist ermordet worden. Das Fest war natürlich danach nur noch fad. Man konnte nicht mehr fröhlich sein.«
Der Vater nickte, sagte aber nichts. Er setzte sie in der Mariagata ab.
»Was macht der Sadist?«
Er verstand zuerst nicht, was sie meinte.
»Der Tierquäler. Die brennenden Schwäne.«
»Das war bestimmt nur jemand, der sich wichtig machen wollte. Es wohnen ziemlich viele Leute in der Nähe des Sees. Irgend jemand müßte doch etwas bemerkt haben. Wenn es wirklich stimmt.«
Kurt Wallander fuhr ins Präsidium zurück. Als Linda in die Wohnung hinaufkam, sah sie neben dem Telefon einen Zettel mit seiner Schrift. Es ging um Anna. Ein Anruf vom Abend vorher. Ruf mich an. Wichtig. Daneben hatte der Vater einen Kommentar gekritzelt, den sie nicht entziffern konnte. Sie rief ihn im Büro an:
»Warum hast du nicht gesagt, daß Anna angerufen hat?!«
»Ich habe es vergessen.«
»Was steht da? Was du daneben geschrieben hast?«
»Ich fand, daß sie besorgt wirkte.«
»Was meinst du damit?«
»Das, was ich sage. Daß sie besorgt wirkte. Am besten, du rufst sie an.«
Linda wählte Annas Nummer. Zuerst war besetzt, dann meldete sich niemand. Später versuchte sie es noch einmal, vergeblich. Gegen sieben, nachdem sie und ihr Vater zu Abend gegessen hatten, zog sie ihre Jacke an und ging zu Annas Wohnung und klingelte. Als Anna aufmachte, sah Linda sogleich, was ihr Vater gemeint hatte. Annas Gesicht war verändert. Ihre Augen flackerten unruhig. Sie zog Linda in den Flur und schlug die Tür zu.
Als habe sie es eilig, die Umwelt auszuschließen.
5
Plötzlich erinnerte sich Linda an Annas Mutter, Henrietta.
Eine magere Frau, mit ruckhaften und nervösen Bewegungen. Linda hatte immer Angst vor ihr gehabt. Es war wie eine fixe Idee über sie gekommen, daß Annas Mutter wie eine leicht zerbrechliche Vase war, die zerspringen konnte, wenn jemand zu laut sprach, eine heftige Bewegung machte oder die Stille störte, die das Wichtigste in ihrem Leben zu sein schien.
Linda erinnerte sich an das erste Mal, als sie Annas Zuhause besucht hatte. Sie war acht oder neun, Anna ging in ihre Parallelklasse, und warum sie sich mochten, konnten sie nie beantworten. Wir mochten uns eben, dachte Linda. Sonst nichts. Jemand steht da und wirft unsichtbare Bänder um Menschen und verknotet sie. So war es mit Anna und mir. Wir waren unzertrennlich, bis dieser picklige Junge zwischen uns trat und wir uns beide in ihn verliebten.
Annas verschwundener Vater war für sie nur noch ein Mann auf ein paar vergilbten Fotos. Aber in ihrer Wohnung waren keine Bilder zu sehen. Henrietta hatte alle Spuren beseitigt, als wolle sie ihrer Tochter zu verstehen geben, daß ihr Vater nie mehr wiederkommen würde. Er war gegangen, um nicht zurückzukommen. Die Fotos hatte Anna in einer Schublade aufbewahrt, gut versteckt zwischen ihrer Unterwäsche. Linda erinnerte sich an einen Mann mit langen Haaren und Brille, der schaute, als sei das Bild gegen seinen Willen aufgenommen worden. Anna hatte ihr die Fotos in höchster Vertraulichkeit gezeigt. Als sie Freundinnen wurden, war ihr Vater seit zwei Jahren verschwunden. Anna leistete einen wortlosen Widerstand gegen die Art und Weise, in der ihre Mutter in der Wohnung und in ihrer beider Leben jede Spur des Vaters tilgte. Als die Mutter seine letzten Kleider in einen Papiersack gestopft und ihn zum Müll in den Keller gestellt hatte, war Anna in der Nacht hinuntergegangen und hatte sich ein Paar Schuhe und ein Hemd herausgesucht. Sie hatte die Sachen unter ihrem Bett versteckt. Für Linda hatte der verschwundene Vater etwas Abenteuerliches. Oft wünschte sie sich, es wäre umgekehrt und ihre streitenden Eltern wären verschwunden, wie graue Streifen von Rauch an einem blauen Himmel.
Sie setzten sich aufs Sofa. Anna lehnte sich zurück, so daß ihr Gesicht halb im Schatten blieb.
»Wie war euer Ball?«
»Wir bekamen zum Tanz einen toten Polizisten. Da war es vorbei. Aber das Kleid war prima.«
Ich kenne das, dachte Linda. Anna kommt nie direkt zur Sache. Wenn sie etwas Wichtiges zu sagen hat, braucht es seine Zeit. Deshalb fragte sie:
»Und wie geht es deiner Mutter?«
»Gut.«
Plötzlich stutzte Anna jedoch.
»Gut? Warum sage ich ›gut‹? Es geht ihr schlechter denn je. Seit zwei Jahren schreibt sie an einem Requiem über ihr eigenes Leben, ›Die namenlose Messe‹ nennt sie es. Zweimal hat sie die Noten ins Feuer geworfen, zweimal hat sie sie im letzten Moment wieder aus den Flammen gefischt. Ihr Selbstvertrauen ist ungefähr genauso tief abgesackt wie bei einem Menschen, der nur noch einen Zahn im Mund hat.«
»Wie klingt ihre Musik?«
»Ich habe kaum eine Ahnung. Dann und wann hat sie versucht, es mir zu erklären, indem sie etwas vorgesummt hat. In den seltenen Augenblicken, in denen sie glaubte, das, was sie schreibe, habe irgendeinen Wert. Aber ich erkenne nie eine Melodie. Gibt es Musik ohne Melodie? Ihre Musik hört sich an wie Schreie, als ob jemand nach dir sticht oder dich schlägt. Es will mir überhaupt nicht in den Kopf, daß jemand sich so etwas anhören will. Gleichzeitig bewundere ich sie, weil sie nicht aufgibt. Zweimal habe ich versucht, ihr zu raten, eine andere Richtung einzuschlagen, etwas ganz anderes zu machen. Sie ist doch noch keine Fünfzig. Beide Male ist sie auf mich losgegangen, hat gekratzt und gezerrt und gespuckt. Da war ich überzeugt, daß sie drauf und dran ist, verrückt zu werden.«
Anna unterbrach sich, als fürchtete sie, zuviel gesagt zu haben. Linda wartete auf die Fortsetzung. Ihr fiel ein, daß sie schon einmal so gesessen hatten, als sie entdeckten, daß sie beide in denselben Jungen verliebt waren. Keine hatte etwas sagen wollen. Sie hatten diesen stummen und atemlosen Schrecken geteilt, daß ihre Freundschaft auf dem Spiel stand. Damals hatte ihr Schweigen den ganzen Abend und bis tief in die Nacht gedauert. Es war in der Mariagata gewesen. Lindas Mutter war schon mit ihren Sachen ausgezogen, und ihr Vater war in den Wäldern bei Kadesjö gewesen auf der Suche nach einem Psychopathen, der einen Taxifahrer überfallen hatte. Linda wußte sogar noch, daß Anna an jenem Abend und in der Nacht schwach nach Vanille geduftet hatte. Gab es Parfüm mit Vanilleduft? Oder Seife? Sie hatte damals nicht gefragt und wollte es auch jetzt nicht tun.
Anna richtete sich auf und kam aus dem Halbschatten heraus. »Hast du jemals das Gefühl gehabt, daß du drauf und dran warst, den Verstand zu verlieren?«
»Jeden Tag.«
Anna warf irritiert den Kopf in den Nacken. »Ich mache keine Witze. Ich meine es ernst.«
Linda bereute sofort.
»Es ist vorgekommen. Du weißt, wann.«
»Du hast dir die Pulsadern aufgeschnitten. Und auf einem Brückengeländer gestanden. Aber das ist Verzweiflung. Das ist nicht dasselbe. Alle Menschen sind irgendwann einmal verzweifelt. Es ist wie ein Initiationsritus für das Erwachsenenleben. Wenn man nicht gegen das Meer oder den Mond oder seine Eltern anschreit, hat man keine Chance, erwachsen zu werden. Prinz und Prinzessin Sorgenfrei sind verfluchte Geschöpfe. Denen hat man Betäubungsspritzen in die Seele verpaßt. Wir Lebenden müssen wissen, was Trauer ist.«
Linda beneidete Anna wegen ihrer Fähigkeit, sich zu artikulieren. Sprache und Gedanke, dachte sie. Ich müßte mich erst hinsetzen und es zu Papier bringen, wenn ich versuchen wollte, so schön zu reden wie sie.
»Dann habe ich nie Angst gehabt, ich könnte verrückt werden«, antwortete sie.
Anna stand auf, ging zum Fenster und kehrte nach einer Weile zurück. Man ähnelt seinen Eltern, dachte Linda. Genau das habe ich ihre Mutter tun sehen, ständig die gleiche Bewegung, um ihre Unruhe unter Kontrolle zu behalten. Aufstehen, zum Fenster gehen und zurückkommen. Mein Vater verschränkt die Arme fest vor der Brust, und Mona reibt sich die Nase. Und was hat meine Großmutter getan? Sie starb, als ich so klein war, daß ich mich nicht an sie erinnern kann. Und Großvater? Der pfiff auf alles und malte einfach weiter seine gräßlichen Bilder.
»Ich glaube, ich habe gestern auf der Straße in Malmö meinen Vater gesehen«, sagte Anna plötzlich.
Linda runzelte die Stirn und wartete auf eine Fortsetzung, die aber ausblieb. »Du glaubst, du hättest deinen Vater in Malmö auf der Straße gesehen?«
»Ja.«
Linda überlegte. »Aber du hast ihn doch nie gesehen. Nein, das ist falsch. Du hast ihn gesehen, aber du warst so klein, als er wegging, daß du dich nicht an ihn erinnerst.«
»Ich habe die Fotos.«