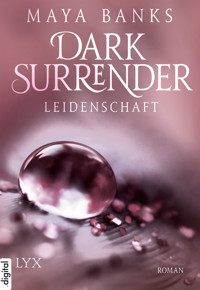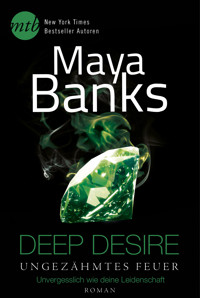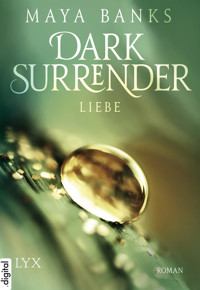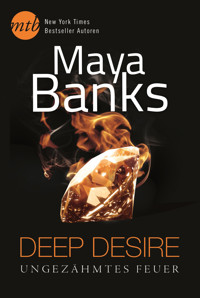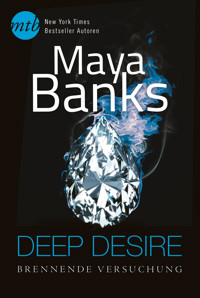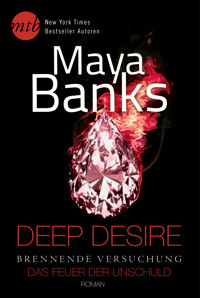9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: KGI-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er lebt nur für die Pflicht
Für den Elitesoldaten Hancock zählt allein die Pflicht. Nichts stellt sich zwischen ihn und seine Mission! Zu diesem Zweck hat er eine Fassade errichtet, hinter der niemand sein wahres Ich erkennen kann. Als er aber Honor, eine Gefangene, bewachen soll, geraten seine Prinzipien gehörig ins Wanken. Denn Honor ist die Einzige, der es gelingt, die Mauer einzureißen, die Hancock um sein Herz erbaut hat. Aber kann er nach den vielen Jahren der Pflichterfüllung auf seine Gefühle hören, oder wird er die Liebe für seinen Auftrag opfern?
"Mit diesem Buch werden sie vor lauter Spannung kaum noch stillsitzen können!" Night Owl Reviews
Band 10 der KGI-Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Maya Banks
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem Buch12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546EpilogDie AutorinMaya Banks bei LYXImpressumMAYA BANKS
KGI
Verloren im Dunkel
Roman
Ins Deutsche übertragen von Richard Betzenbichler
Zu diesem Buch
Für den Elitekämpfer Hancock zählt allein die Pflicht: Nichts und niemand drängt sich zwischen Hancock und seine Mission! Als er aber eine Gefangene bewachen muss, geraten seine Prinzipien gehörig ins Wanken. Honor ist die Einzige, der es jemals gelang, die Mauern einzureißen, die der Kämpfer um sein Herz errichtet hat. Aber kann Hancock jemals seinen Gefühlen folgen, oder muss er die Liebe seiner Mission opfern?
1
Honor Cambridge klebte eines der bunten Pflaster mit den gelben Smileys über den winzigen Stich auf dem Arm des vierjährigen Jungen und lächelte ihn freundlich an. In makellosem Arabisch lobte sie ihn, weil er so tapfer gewesen war und seiner Mutter nicht noch mehr Sorgen gemacht hatte.
Er antwortete mit einem Grinsen, in dem bereits trotz seines jungen Alters die männliche Arroganz zu erkennen war, als wollte er sagen, dass er natürlich tapfer gewesen sei.
Honor hatte zwar keinen medizinischen Abschluss, aber sie war schon weit fortgeschritten in ihrer Ausbildung und hatte eine Menge in akuten Notsituationen gelernt. Offiziell war sie als Helferin tätig und unterstützte in allem, was gerade nötig war, die Armen und Unterdrückten in den Dörfern, die zwischen verfeindeten Lagern und dem nie endenden Kampf um die Vorherrschaft in der Falle saßen.
Ihre Familienangehörigen stärkten ihr durchaus den Rücken, aber sie wusste, dass sie ihrer glühenden Leidenschaft, ihr Leben dem Dienst an anderen zu widmen, auch skeptisch gegenüberstanden. Sie waren stolz auf sie, gleichzeitig wünschten sie, sie hätte sich andere,weniger unsichere Orte für ihre Hilfstätigkeit ausgesucht. Nicht den vom Krieg gebeutelten Nahen Osten, wo die Bedrohung nicht nur von anderen Nationen ausging, sondern auch von Gruppen innerhalb des Landes, die sich in ihren religiösen, politischen und kulturellen Unterschieden gegenseitig nicht tolerieren konnten. Sie alle wollten die jeweils anderen zwingen, sich ihrem Lebensstil zu unterwerfen. Noch immer erstaunte und entsetzte es Honor, wie weit sie bereit waren zu gehen, um denen ihren Glauben aufzuzwingen, die nicht ihrer Ideologie anhingen. Eigentlich hätte sie inzwischen abgehärtet sein müssen. Nichts hätte sie mehr schockieren sollen. Und dennoch … Jeden Tag war sie aufs Neue überrascht, denn immer wieder kam etwas nie Gekanntes dazu. Wenn sie glaubte, alles gesehen zu haben, geschah regelmäßig etwas, das sie unvorbereitet traf.
Aber abgestumpft und zynisch zu werden, würde ihr den Todesstoß versetzen. Der Tag, an dem sie nicht mehr mit den Unschuldigen und Unterdrückten mitfühlte und nicht mehr wütend über die sinnlose Gewalt und Verzweiflung wurde, die sich in dieser Region so hartnäckig hielten, wäre der Tag, an dem sie eine seriöse, langweilige Arbeit mit festen Arbeitszeiten suchen und ein Leben führen müsste, in dem das Gefährlichste der Feierabendverkehr war.
Honor legte die Hand auf den Arm des Jungen und führte ihn zu seiner wartenden Mutter, die bereits das große Hilfspaket in Händen hielt. Es enthielt Dinge, die für die meisten Menschen selbstverständlich waren, die aber in Dörfern, in denen fließend Wasser ein Luxus war, kostbare Güter darstellten.
Plötzlich erbebte das gesamte Gebäude, und der Boden unter Honors Füßen wölbte sich wie bei einem Erdbeben.
Niemand schrie. Aber rundum war das nur allzu vertraute Entsetzen in den Gesichtern der Menschen zu sehen, die Honor ans Herz gewachsen waren. Es folgte eine unheimliche Stille, und dann …
Die Welt um sie herum explodierte in einem grausigen Sturm, einem Wirbel aus Hitze, Feuer und dem beißenden Geruch nach Sprengstoff.
Und Blut.
Der Tod hatte seinen ganz eigenen Geruch. Und Honor hatte bereits genug Blut und Tod gesehen, hatte den entsetzlichen Anblick ertragen müssen, wie das Leben langsam aus einem eben noch pulsierenden Körper herausfloss. Ein unschuldiges Kind. Eine Mutter, die nur ihre Kinder schützen wollte. Ein Vater, der vor seiner gesamten Familie abgeschlachtet wurde.
Chaos brach aus. Die Menschen rannten los, ohne zu wissen, wohin, und dennoch beobachtete Honor ruhig, was geschah, als wäre sie losgelöst von ihrem Körper und würde den Angriff auf das Hilfszentrum ohne Gefühle wahrnehmen. Eine ihrer Mitarbeiterinnen – ihre Freundin – schrie sie an, Deckung zu suchen, dann stand sie auf einmal seltsam still da, mit toten Augen, auf ihrer Brust ein riesiger Blutfleck. Sie sackte wie eine Marionette in sich zusammen, und auf ihrem Gesicht zeigte sich nicht Schmerz, sondern nur unendliche Trauer. Und Bedauern.
Tränen traten Honor in die Augen, und jetzt endlich setzte sie sich in Bewegung. Es galt, Kinder zu beschützen. Frauen zu retten. Die brutale Extremistengruppe würde sie nicht alle erwischen. Das war ein Schwur, eine Litanei, die sie ununterbrochen in ihrem Kopf wiederholte, während sie Kinder wie Mütter aus dem Hintereingang und hinaus in die Wüstenhitze scheuchte.
Als Honor sich umdrehte, um wieder hineinzugehen, griff eine der Frauen nach ihrer Hand und bat sie auf Arabisch, mit ihnen zu kommen. Davonzulaufen. Sich in Sicherheit zu bringen. Die Extremisten würden keine Gnade kennen. Besonders bei Menschen nicht, die aus dem Westen kamen.
Honor entzog sich sanft dem verzweifelten Griff. »Möge Allah euch beschützen«, flüsterte sie, und betete, dass Gott, irgendein Gott, jeder Gott, den Hass und das Blutvergießen beenden möge. Das sinnlose Töten der Guten und Unschuldigen.
Dann drehte sie sich um und lief zurück in das Gebäude oder besser in das, was davon noch übrig war. Am Rande nahm sie wahr, dass sie die leichten, aber kühlen Flipflops, die sie normalerweise trug, irgendwo in dem Chaos verloren hatte. Jedoch war der Schutz ihrer Füße das Letzte, was wichtig war, wenn ihr Leben auf dem Spiel stand.
Fieberhaft suchte sie nach ihren Kolleginnen und Kollegen. Nach den beiden Ärzten, die unermüdlich Tag und Nacht arbeiteten, manchmal auch die ganze Nacht durch, weil der Bedarf an medizinischer Hilfe so groß war. Nach den Krankenschwestern, die Arbeiten verrichteten, wie das in den USA meist nur Ärzte taten, und das mit sehr viel weniger modernen Hilfsmitteln oder Diagnosemöglichkeiten.
Wo immer sie sich hinwandte, sah sie nur Blut, Ströme von Blut. Und Tod. Der Gestank brachte ihren Magen zum Rebellieren, und sie schlug die Hand vor den Mund, um sich nicht zu übergeben und um den Schrei zu ersticken, der aus den Tiefen ihrer Seele heraufdrängte.
Wohin sie auch schaute, nirgendwo bot sich etwas Tröstliches dar. Zumindest konnte sie dankbar sein, nicht die Leichen zu vieler Kinder und ihrer Mütter zu sehen. Die meisten hatten fliehen können. Sie waren an solche Angriffe gewöhnt und wussten damit umzugehen. Honors Kameraden, ihren Freunden, den Menschen, die derselben Berufung gefolgt waren wie sie, war es nicht so gut ergangen.
Die Erde selbst explodierte unter ihr. Um sie herum. Steine und Trümmer prasselten auf sie herab und versetzten sie in Angst und Schrecken. Sie machte einen Schritt und zuckte zusammen, als etwas Scharfes in ihre zarte Fußsohle schnitt. Und dann brach das bereits eingesunkene Dach zusammen und presste sie schmerzhaft auf den zerfurchten Boden. Weitere Trümmer regneten auf sie herab. Nein, das war die Decke, die sich wie ein Käfig über sie stülpte und sie zwischen Steinen, Schutt und einem zerbrochenen Balken einklemmte. Die Wolke aus Staub und Rauch war so dick, dass sie keine Luft mehr in ihre gequälten Lungen saugen konnte.
Sie war sich nicht sicher, ob es an dem dicken Rauch und dem zerbröselten Putz lag, dass sie kaum noch atmen konnte, oder an dem Trümmerberg, unter dem sie begraben war. Gnadenlos presste er sie in den Boden, bis sie sich sicher war, dass jeder Knochen in ihrem Körper zerquetscht werden würde, weil er einem derart unglaublichen Druck einfach nicht standhalten konnte.
Der Schmerz war da. Das wusste sie. Aber er war ein Stück weit entfernt. Als versuche er, den dichten Nebel zu durchdringen, der sie umgab. Heimtückisch schlich sich Taubheit über und in ihren Körper, und sie hätte nicht sagen können, ob es ein Segen war, den vermutlich unerträglichen Schmerz nicht zu spüren, oder der Fluch des Todes.
Ihres Todes.
Ihre Augenlider flatterten, während sie verzweifelt versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben. Wenn sie der herannahenden Dunkelheit nachgäbe, so fürchtete sie, würde der Tod diesen Kampf letztlich gewinnen.
Der Tod war ihr nicht fremd. Sie wurde täglich mit ihm konfrontiert. Auch hatte sie sich nie Illusionen über das enorme Risiko einer Arbeit in einem Land gemacht, das nicht nur dauernd im Krieg mit seinen Nachbarn lag – alle mit unterschiedlichen Interessen, Glaubensrichtungen und diversen Ausprägungen von Fanatismus –, sondern auch innerhalb der eigenen Grenzen geteilt war. Jede Region war darauf aus, die Macht im gesamten Land zu übernehmen und ihre Sichtweise allen Andersdenkenden aufzuzwingen.
Und dann gab es noch die, die keinen Grund brauchten, um ihre Landsleute zu töten, zu terrorisieren und zu Opfern zu machen. Das waren die Schlimmsten. Unberechenbar. Sie stanken förmlich nach Fanatismus, und ihr einziges Ziel bestand darin, alle in Angst und Schrecken zu versetzen, die ihnen über den Weg liefen. Sie wollten Ruhm. Sie wollten von ihren Feinden gefürchtet und von den Gruppierungen verehrt werden, die es nicht wagten, gegen sie zu kämpfen.
Sie wollten, dass die Welt sie wahrnahm. Wusste, wer sie waren. Sie wollten, dass die Leute ihren Namen flüsterten, aus Angst, sie könnten plötzlich vor ihnen stehen, wenn sie zu laut über die Monster sprachen. Sie hatten schnell gelernt, welches die beste Methode war, ihren Status zu erhöhen, weltweite Medienaufmerksamkeit zu erlangen und die Elite, die Besten der Besten zu rekrutieren, jene, die keine Angst hatten, ihr Leben für ihre Sache zu opfern, und willig die Rolle des Märtyrers akzeptierten. Die beste Methode war, Menschen aus westlichen Ländern ins Visier nehmen. Vor allem Amerikaner.
Die Medien in den USA gaben den Ruhmsuchenden genau das, was sie wollten. Bei jedem neuen Übergriff wurde rund um die Uhr berichtet. Diese Aufmerksamkeit weckte den Ehrgeiz nach mehr. Sie waren dreister geworden, hatten ihr Netzwerk in rasantem Tempo erweitert, und ihre Macht ließ gerade die Länder verstummen, die einen derartigen Hass auf den Westen normalerweise verurteilt hätten.
Solch eine Machtfülle machte die Führer der reichen Ölstaaten nervös. So nervös, dass ein Gipfeltreffen einberufen worden war, wie es noch nie stattgefunden hatte, das Todfeinde an einen Tisch gebracht hatte, um über das unvermindert wachsende Problem einer fanatischen Gruppe mit Macht, Reichtum, militärischer Überlegenheit und einer noch nie dagewesenen Zahl an täglich neuen Rekruten zu diskutieren.
Männer und Frauen aus allen Ecken und Enden der Welt. Was konnte bloß diesen Hass auslösen? Dieses Verlangen nach Schmerz, Gewalt, Verletzung und Leid?
Honor überlief ein Schauder, als die Hülle aus Dumpfheit, die sie umgab, kurzzeitig löchrig wurde und der Schmerz auf sie losging und ihr den Atem endgültig raubte. Vor ihren Augen wurde es schwarz, das Licht verblasste immer mehr. Ihre Tränen brannten wie Säure, aber sie weigerte sich, ihnen freien Lauf zu lassen. Sie war am Leben. Noch zumindest. So viel Glück hatte keiner der anderen Helfer gehabt.
Das Gebäude sah aus, als wäre ein Meteor durch die Erdatmosphäre gerast und hätte das gesamte Grundstück in eine Mondlandschaft verwandelt. Das halbe Dach war eingestürzt, und so wie der Rest bei jedem Windhauch knarrte und stöhnte, würde er bald folgen.
Sie würde niemals hier herauskommen. Vielleicht war ihren Kolleginnen und Kollegen doch irgendeine höhere Macht etwas gnädiger gewesen. Ein rascher Tod war sicherlich besser als das, was Überlebende erwartete, wenn sie von den blutrünstigen Barbaren entdeckt wurden, die solch eine Zerstörung angerichtet hatten.
Warum war sie verschont geblieben, um zu leiden? Warum wurden ihr nicht Gnade und Mitleid zuteil? Welche Sünde hatte sie begangen, dass sie überlebte, nur um zur Hölle verdammt zu sein, einem Schicksal, schlimmer als der Tod? In ihrem zerschlagenen Körper breitete sich eine eisige Kälte aus und bemächtigte sich ihrer Knochen und ihres Bluts. Sie fror in den tiefsten Tiefen ihrer Seele, obwohl die Welt um sie herum lichterloh brannte und die Flammen der Hölle gierig die Opfer verzehrten.
»Reiß dich zusammen, Honor«, murmelte sie. Sie konnte nur noch lallen, ein typisches Zeichen, dass sie unter Schock stand.
Da jammerte sie, weil sie noch am Leben war. Sie hatte wider alle Wahrscheinlichkeit überlebt, im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und Kollegen, und da wagte sie es, diese zu beneiden? Sie war verschont worden, und das war keinem der anderen zuteilgeworden. Irgendetwas musste das zu bedeuten haben. Ihr Leben hatte einen Sinn. Es gab noch viel für sie zu tun. Gott war noch nicht fertig mit ihr, und hier lag sie unter dem Schutt der Zerstörung und führte sich wie ein undankbares Kind auf, weil sie überlebt hatte. Noch nie hatte sie sich so geschämt. Was würde ihre Familie denken? Sie wäre bestimmt nicht unglücklich, dass Honor noch am Leben war. Ihr Tod würde ihnen endloses Leid bereiten. Sie war das Baby. Die Jüngste von sechs Geschwistern, und alle liebten sie von ganzem Herzen. Es mochte ihnen vielleicht nicht gefallen haben, dass sie sich solch einem Risiko aussetzte, aber sie verstanden ihre Berufung und unterstützten sie. Sie waren stolz auf sie. Wenn für niemanden sonst, dann würde sie für ihre Familie überleben.
Laute Stimmen, gebellte Befehle und das Geräusch, das beim Wegschieben von Schutt entsteht, drangen an Honors Ohr, und sie erstarrte. Panik erfasste sie, und ihr Herz begann zu rasen. Das Atmen, das ihr schon schwer genug fiel, wurde noch mühseliger. Sie schloss die Augen und zwang sich, keinen Laut von sich zu geben.
Die Milizen arbeiteten sich durch die Ruinen, einzig und allein auf der Suche nach Leuten aus dem Westen – den Leuten, die in dem Hilfszentrum arbeiteten und allen Geflüchteten Unterstützung boten. Ihr Triumphgefühl über den Erfolg des Angriffs bereitete Honor Übelkeit. Sie hörte ihre schadenfrohen Rufe, während sie einen toten Kollegen nach dem anderen entdeckten. Die Tränen ballten sich in ihrer Kehle zu einem Kloß zusammen, als vorgeschlagen wurde, die Leichen aus der Klinik zu schleppen und draußen aufzureihen, um Fotos zu machen und der Welt zu zeigen. Eine Warnung an andere, dass ihre Anwesenheit nicht erwünscht war.
Himmel, was würde geschehen, wenn sie sie fanden? Sie gingen bei ihrer Suche systematisch vor, fast als wüssten sie, wer die Helfer waren und wie viele. Wenn sie sich über so viele Tote freuten, wie begeistert würden sie dann erst sein, eine lebendige Geisel zu haben? Jemanden, an dem man ein Exempel statuieren konnte?
Das Gebäude knarrte und stöhnte, die verbliebenen Wände protestierten gegen die Instabilität des Baus. Weitere Trümmer prasselten herab. Honor gelang es gerade noch, einen Schmerzensschrei zu unterdrücken, als etwas auf die Trümmer über ihr donnerte, so dass sie jetzt noch tiefer auf sie herabsanken.
Auf einmal wurden die Eindringlinge vorsichtig und besprachen sich, ob es noch sicher sei, ihre systematische Zählung der Leichen fortzusetzen. Einer von ihnen schlug vor, das Gebäude unverzüglich zu verlassen – bevor ihnen der Rest auch noch um die Ohren flog –, und da brach eine wilde Diskussion los. Die lauten und barschen Stimmen waren für Honors Geschmack viel zu nah.
Sie waren nicht weit von ihr entfernt und kamen immer näher. Sie meinte schon fast, die Männer in ihrem Nacken atmen zu hören, obwohl sie wusste, dass das unmöglich war. Aber sie fühlte sich in der Falle. So, wie sich ein Beutetier fühlen musste, wenn es der Jäger in die Ecke gedrängt hatte, um es zu töten.
Sie schloss die Augen und betete um ihr Leben, nachdem sie sich nur Sekunden zuvor darüber beklagt hatte, dass sie nicht gestorben war. Das inbrünstige Gebet, nicht nur zu leben, sondern zu überleben, wurde in ihrem Kopf zu einer Litanei. Unversehrt dem schrecklichen Schicksal zu entkommen, das sie erleiden würde, sollte sie entdeckt werden. Diese Männer hatten keine Hemmungen, Frauen zu vergewaltigen, zu foltern und zu töten.
Ein Schauder durchlief ihren Körper, ohne dass sie es verhindern konnte, und sie hielt den Atem an und hoffte, dass sie sich nicht verraten hatte. Sie zwang sich zur Ruhe und blendete den Schmerz und die lähmende Angst aus. Noch nie hatte sie sich so sehr gefürchtet wie jetzt. Alle Vorbereitung und alle Beinahezusammenstöße mit militanten Kräften, die nur auf Zerstörung aus waren, hatten sie nicht einmal ansatzweise auf eine solche Situation vorbereiten können, auch wenn sie sich monatelang darauf eingestellt hatte.
Sie hatte es für unausweichlich gehalten, dass sie Angst und Schmerz kennenlernen würde, aber nie hatte sie den Gedanken zugelassen, sie könnte bei dem, was sie als ihre Berufung empfand, getötet werden. Ihre Eltern hatten versucht, es ihr auszureden. Am Anfang hatten sie sie angefleht, waren sogar so weit gegangen, ihr zu sagen, sie würden ihr »Baby« nicht verlieren wollen.
Ihre vier älteren Brüder und ihre ältere Schwester hatten sich extra mit ihr zusammengesetzt, um sie zu überreden, nicht zu gehen. Sie hatten voll auf die Tränendrüse gedrückt, hatten ihr gesagt, sie müsse unbedingt eine Rolle im Leben ihrer Nichten und Neffen spielen. Ihre Schwester hatte unter Tränen Honors Hand in ihre genommen und mit erstickter Stimme gesagt, sie würde sie gern bei ihrer Hochzeit dabeihaben, an ihrer Seite – dabei hatte ihre Schwester gar nicht vor, in nächster Zeit zu heiraten.
Beinahe hätte sie dieser emotionalen Erpressung nachgegeben. Sie zuckte innerlich zusammen. Es Erpressung zu nennen war zu hart. Alles, was sie gesagt und getan hatten, war aus Liebe geschehen. Irgendwann hatte Honors Mutter gespürt, wie hin- und hergerissen Honor zwischen den Wünschen und dem Glück ihrer Familie und dem Bedürfnis war, Menschen in umkämpften und von Terrorgruppen heimgesuchten Gebieten zu helfen. Sie hatte die Familie zusammengerufen und leise, aber nachdrücklich darauf bestanden, dass sie Honor in Ruhe ließen.
Es hatte so viel Liebe und Verständnis – und Stolz – in ihrem Blick aufgeblitzt, als sie Honor mit Tränen in den Augen angesehen hatte. Für Honor war es wie eine Flutwelle gewesen, die sie verschlingen wollte. Die Liebe ihrer Mutter hatte sie innerlich zermalmt und ihr gleichzeitig das Herz gewärmt wie nie etwas zuvor.
Nein, ihre Mutter hatte nicht gewollt, dass sie ging, aber sie hatte sie verstanden, und sie hatte ihrem Mann und ihren anderen Kindern gesagt, dass es an der Zeit sei, Honor flügge werden zu lassen. Sie sein zu lassen, wer sie sein wollte. Ihre Zeit, sich zu entfalten, war gekommen, zumal sie in ihrem jungen Leben immer die Ruhige gewesen war, die sich mit den Leistungen und dem Glück ihrer Geschwister identifiziert hatte, während jeder von ihnen seinen eigenen Weg ging.
Die Worte ihrer Mutter hatten ihre Geschwister und ihren Vater beschämt, auch wenn Honor das nie gewollt hatte. Jeder von ihnen hatte ihr seine bedingungslose Unterstützung angeboten. Ihr Vater hatte sie fest in die Arme genommen und ihr mit rauer Stimme versichert, dass sie immer sein Baby bleiben würde und dass sie ihm versprechen müsse, heil wieder nach Hause zurückzukehren.
Bei dem Gedanken, sie könnte dieses Versprechen vielleicht nicht halten, wurde ihr eng ums Herz.
Wieder erbebte das zerstörte Gebäude, und weitere Trümmer und Deckenteile stürzten herab. Sie hörte die Männer husten und fluchen, und dann fasste sie neuen Mut, nachdem sie die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte.
Die Extremisten kamen zu dem Schluss, dass sie das Gebäude verlassen mussten, bevor sie darin in der Falle saßen. Oder getötet wurden.
Die Gespräche wurden leiser, und einigen der Stimmen, die für das Verlassen des Gebäudes plädiert hatten, war die Erleichterung deutlich anzuhören. Ihr Argument war, dass die Toten nirgendwohin gingen und niemand die Explosionen oder die Schüsse der Scharfschützen überlebt haben konnte, die die Fliehenden ins Visier genommen hatten.
Honor hätte beinahe laut aufgeschluchzt. So viel sinnloses Sterben, und weshalb? Weil sie Menschen geholfen hatten, die dringend Hilfe benötigten?
Die nächsten Worte, die Honor − jetzt schon aus einiger Entfernung − hörte, ließen sie bis ins Mark erstarren.
Sobald die Gefahr vorbei war, würden sie zurückkehren und jedes einzelne Opfer suchen, bis sie sicher sein konnten, dass keiner der Helfer mit dem Leben davongekommen war. Himmel. Sie kannten jeden einzelnen Helfer. Hatten ihre Opfer genau beobachtet. Selbst wenn Honor sich befreien konnte, bevor sie zurückkamen, würden sie wissen, dass sie nicht gestorben war, sobald sie ihre makabre Zählung abgeschlossen hatten.
Was bedeutete, dass sie sie gnadenlos jagen würden, denn noch weniger als alles andere duldete diese Gruppe Versagen. Und wenn auch nur eine − nämlich Honor − davonkam, dann hatten sie ihr Ziel nicht erreicht.
2
Honor erwachte und wusste nicht, wo sie sich befand und was geschehen war. Sie versuchte verzweifelt, die Situation zu begreifen. Doch sofort fiel der Schmerz über sie her, als hätte er nur darauf gewartet, dass sie wieder zu Bewusstsein kam, und wäre zornig, dass sie sich seiner harten Strafe durch Ohnmacht entzogen hatte.
Sie schnappte leise nach Luft, betrachtete die Mengen von Schutt, die auf ihr lagen, und begann vorsichtig, ihren Spielraum darunter auszuloten. Sie wollte nicht nur feststellen, ob die Schmerzen schlimmer wurden und auf ernstere Verletzungen hindeuteten, sondern auch, ob irgendeine Chance bestand, sich aus dem Trümmerhaufen zu befreien.
Es war stockdunkel, die Nacht musste also inzwischen hereingebrochen sein. Sie atmete erleichtert auf, doch dann wurde ihr bewusst, dass sie noch lange nicht außer Gefahr war. Die Dunkelheit half ihr nur, wenn sie sich aus ihrem Gefängnis befreien konnte und beweglich genug war, um in den Schutz der Nacht zu fliehen.
Bevor ihre Verzweiflung endgültig die Oberhand gewinnen konnte, schob sie die negativen Gefühle energisch beiseite. Sie war in großer Gefahr, auch ohne dass sie sich noch zusätzlich einredete, keine Chance zu haben. Zu diesem Zeitpunkt war Hoffnung das Einzige, was ihr noch blieb. Und ein starker Überlebenswille. Der Wille, sich nicht von Männern besiegen zu lassen, die Schmerz, Angst und völlige Unterwerfung eines jeden genossen, der nicht ihrer Ideologie anhing.
Sie würde nach Hause kommen. Sie würde eine Möglichkeit finden. Und sobald ihr das gelungen war, würde sie der Terroristenzelle, die ihre Kollegen – ihre Freunde – ermordet hatte, ein riesiges »Leckt mich am Arsch« senden und sie wissen lassen, dass eine einfache amerikanische Frau ihnen trotz allem entkommen war.
Mit neuer Entschlossenheit machte sie sich daran, herauszufinden, was sie bewegen und wie sie sich am ehesten aus dem Trümmerfeld befreien konnte, auf dem sie gefangen war.
Die Minuten vergingen unendlich langsam. Der Schmerz war ihr ständiger Begleiter. Sie war schweißgebadet, aber die Nässe konnte nicht ausschließlich Schweiß sein. Sie wusste, dass sie blutete. Nicht stark, sonst hätte sie nicht das Bewusstsein wiedererlangt. Aber ihre Haut fühlte sich klebrig und warm an, und jetzt, wo der durchdringende Geruch nach Schimmel, Putz, zerbrochenen Steinen und zerborstenem Holz sowie der chemische Gestank des Sprengstoffs vom Nachtwind davongeweht worden waren, konnte sie es auch riechen.
Sie nahm sich Zeit, einen Körperteil nach dem anderen zu testen, beginnend bei ihren Füßen. Sie wackelte mit den Zehen, dann dehnte sie die Füße und drehte die Beine, so gut es ging. Als ihr Knie gegen einen spitzen Stein stieß, zuckte sie leicht zusammen. Die Wände der Klinik waren alle aus Ziegeln, die Decke, die von schweren Balken getragen wurde, bestand aus Holz. Der Boden war aus Beton, und wie oft sie ihn auch gefegt oder gewischt hatten, immer war alles voller Sand gewesen, der sich auf jeder Oberfläche absetzte. Das hatte es äußerst schwierig gemacht, eine sterile Umgebung herzustellen, und Infektionen waren eine ständige Sorge unter Ärzten und Krankenschwestern gewesen.
Ihr Knie fühlte sich geschwollen und steif an. Sie beugte es behutsam, um nicht noch mehr Schaden anzurichten, falls es ernsthaft verletzt sein sollte. Allerdings musste sie ihre Beine unbedingt einsetzen können. Ihre Arme waren nicht so wichtig. Aber sie brauchte einfach ihre Füße und Beine, um von hier wegzukommen. So schnell wie nur irgend möglich.
Auf Hilfe von außen brauchte sie nicht zu hoffen. Niemand würde sie retten. Das Auswärtige Amt hatte in einem Erlass alle US-Amerikaner aufgefordert, die Region zu verlassen, und gewarnt, dass man denjenigen, die diese Warnung ignorierten, nicht zu Hilfe kommen würde. In dieser Region gab es auch kein US-Militär. Keine US-Botschaft. Überhaupt keine amerikanische Präsenz.
Und aus Angst vor Vergeltungsaktionen wagten auch keine andere Gruppe und kein Militär eines anderen Landes, sich mit den militanten Barbaren anzulegen. Sie waren gerade zu sehr damit beschäftigt, ein Gipfeltreffen abzuhalten, bei dem jeder das Thema zu Tode diskutierte, statt etwas zu tun – eine Tatsache, die Honor unglaublich wütend machte.
Wie konnten die Regierungen einhellig dem Leid und Schmerz unzähliger Männer, Frauen und Kinder in dieser derart weitläufigen Region den Rücken kehren? Warum gab es keinen lauteren öffentlichen Aufschrei? In den Medien wurde weiß Gott genügend darüber berichtet. Waren alle so ermüdet von der Rund-um-die-Uhr-Berichterstattung, dass sie alles nur noch gelangweilt zur Kenntnis nahmen und sich innerlich längst davon distanziert hatten? Oder waren sie einfach so selbstgefällig und hatten es sich in ihrer sicheren Umgebung so gemütlich gemacht, dass die Notlage anderer ihnen egal war?
Sie machte sich die hilflose Wut, die an ihr nagte, zunutze, um ihre Entschlossenheit und Kraft zu steigern und sich zu befreien.
Nachdem sie ihre Glieder und den Teil ihres Körpers untersucht hatte, der die lebenswichtigen Organe schützte, war sie zuversichtlich – vielleicht aber auch nur hoffnungsvoll –, dass sie es schaffen würde.
Mit bloßen Händen begann sie, allen Schutt um sich herum beiseitezuschieben. Sie fluchte, als sie an scharfe Kanten geriet, die ihr die Haut aufkratzten, bis sie blutete. Ihre Fingernägel rissen ein, aber der Schmerz war nichts im Vergleich zu dem im Rest ihres Körpers, allenfalls ließ er ihre Entschlossenheit nur wachsen. Je schwieriger es wurde, desto wütender wurde sie. Adrenalin verdrängte den Schmerz und die selbstzerstörerischen Gedanken, an denen sich ihr Gehirn festgebissen hatte.
Aufgrund ihrer Lage – halb auf dem Bauch, halb verdreht auf der Seite – war es keine leichte Arbeit. Sie konnte fast nur die eine Hand einsetzen, diejenige, die nicht unter ihrem Körper lag und somit keine große Reichweite hatte.
Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit verging, sie spürte nur den Drang, noch vor Anbruch der Morgendämmerung zu fliehen, bevor die Mörder garantiert zurückkamen, um die Zählung der Leichen zu vervollständigen. Sie biss sich auf die Lippe, um die Tränen zurückzuhalten. Sie würde sich von ihnen nicht aufhalten lassen. Nur sie konnte die Geschichte der jetzt toten Helden und Heldinnen erzählen, die ihr Leben der Hilfe anderer gewidmet hatten. Nur sie konnte die Gräueltaten bezeugen, die hier begangen worden waren, und sie wollte, dass die Welt von dem Mut und der Selbstlosigkeit ihrer Kollegen erfuhr. Jedenfalls, wenn es nach ihr ging.
Stunden schienen vergangen zu sein, bis sie ihren Oberkörper endlich ausgegraben hatte. Sie legte einen Moment die Wange auf den Boden und ruhte sich für den nächsten Schritt aus. Irgendwie musste es ihr gelingen, sich umzudrehen und sich so weit wie möglich aufzurichten, damit sie die untere Hälfte ihres Körpers ausgraben konnte. Ihre Beine. Nur dann hatte sie eine Chance, zu fliehen.
Sie sammelte ihre Kraft, nahm ihren ganzen Mut zusammen und fing an, sich zu drehen und zu winden, wobei jeder Muskel gegen die ungelenken Bewegungen protestierte. Sie fühlte sich schwach wie ein neugeborenes Kätzchen. Schweiß tränkte ihre zerrissene Kleidung, und zusammen mit dem Blut, das Teile ihres Körpers bedeckte, klebten Hose und T-Shirt an ihr wie festgewachsen.
Ihr verletztes Knie würde ihr die meisten Probleme bereiten. Sie musste die gesamte untere Körperhälfte drehen, egal, welches Gewicht sie nach unten presste.
Sie biss die Zähne zusammen, drückte eine Hand fest auf den Boden und drehte den Oberkörper so weit, dass die andere Hand ein paar Zentimeter über dem Boden schwebte. Sie schob sich hoch, drehte sich weiter und schnappte nach Luft, weil ein heftiger Schmerz durch ihre Beine schoss. Durch beide.
Himmel, würde sie am Ende doch nicht gehen können? Hatte sie beide Beine gebrochen und stand nur zu sehr unter Schock, um die Brüche spüren zu können? Der einzige Schmerz, den sie identifizieren konnte, saß in ihrem Knie.
Wieder bewegte sie Zehen und Füße. Sie wollte sich vergewissern, sich eben nicht nur eingebildet zu haben, dass dies möglich war. Diesmal spürte sie noch genauer hin und konzentrierte sich bei jeder kleinen Bewegung, wo genau ein Schmerz ausgelöst wurde.
Dann kam ihr auf einmal der Gedanke, dass der Grund, wieso sie keinen Schmerz empfand, darin liegen könnte, dass sie ihre Beine überhaupt nicht spüren konnte. Als sie merkte, welche Panik das in ihr auslöste, schob sie diese Vorstellung energisch beiseite. Irrationale, hysterische Gedanken konnte sie jetzt nicht brauchen. Wäre sie gelähmt, hätte sie ihre Füße nicht bewegen und auch nicht wissen können, dass sie sie bewegen konnte, und den pochenden Schmerz in ihrem Knie würde sie dann auch nicht wahrnehmen.
Sobald sich ihre Angst wieder auf ein erträgliches Maß reduziert hatte, betrachtete sie entschlossen den Schutthaufen, der ihre untere Körperhälfte bedeckte. Obwohl es absurd schien, war sie begeistert, als sie die kalte Nachtluft über die Zehen ihres linken Fußes streichen spürte. Wieder bewegte sie sie, diesmal mit mehr Aufmerksamkeit, und stellte fest, dass sie aus dem Schutt herausragten.
Ein Schauder durchlief sie. Ein Glück, dass die Milizen ihr nicht nahe genug gekommen waren, um ihre Zehen hervorschauen zu sehen. Sie hätten sie ausgegraben, um zu prüfen, ob sie tot war wie die anderen. Und wenn sie festgestellt hätten, dass sie noch lebte? Sie wollte diesen Gedanken nicht weiter verfolgen. Sie hatten sie nicht gefunden. Sie würden sie nicht finden. Also war es überflüssig, sich damit zu quälen, was hätte sein können. Sie musste sich an das halten, was passiert war.
Sie drückte die Lippen aufeinander, damit ihr ja kein Laut entschlüpfte, und versuchte, sich diesmal mit größerer Entschlossenheit umzudrehen. Dabei presste sie die Zähne so fest zusammen, dass ihr die gesamte Kinnpartie wehtat.
Ihre Willenskraft hatte gesiegt. In diesem Moment war die Möglichkeit, sich nicht befreien zu können, nicht einmal ansatzweise denkbar. Ein Zischen entfuhr ihr, und sie übte schwer atmend mehr Druck aus und strengte sich heftig an, Hüfte und Beine zu verdrehen.
Die Rückseiten ihrer Beine brannten wie Feuer, während sie über die scharfen Kanten von Stein, Metall, Holz und Glas glitten. Als sie mit dem Knie gegen einen unbeweglichen Gegenstand stieß, machte ihr Magen Anstalten, seinen Inhalt von sich zu geben. Sie sah Sterne, und Tränen traten ihr in die Augen. Es machte sie nur noch wütender, bis sie schließlich vor Wut zitterte.
»Wieso hilfst du mir nicht?«, tobte sie, den Blick nach oben gerichtet, doch sofort schämte sie sich für ihren Ausbruch. »Entschuldige«, murmelte sie und schloss die Augen. »Aber ich könnte deine Hilfe gerade wirklich brauchen. Ein Engel wäre nett, falls du selbst zu sehr beschäftigt bist.«
Sie atmete tief ein und fand die Ruhe wieder, die sich unter ihrer Wut verbarg. Gott anzuschreien, würde sie nicht weiterbringen. Und wie sagte doch das alte Sprichwort? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Im Moment tat sie nichts auch nur ansatzweise Hilfreiches. Jammern, sich wünschen, gestorben zu sein und dauernd gegen die Tränen anzukämpfen, waren nicht das Markenzeichen eines Menschen, der das Geschenk des Lebens verdient hatte. Und doch lag sie hier. So nahe der Freiheit, während die Seelen der anderen, die um sie herum lagen, längst diese Welt verlassen hatten.
Sie hatte ein Ziel. Ja, sie hatte eines. Das stärkte ihren Geist und nahm ihr einige der Ängste, die sie von innen aufzufressen drohten. Vielleicht diente alles, was bisher geschehen war, nur dazu, dass sie den wahren Sinn ihres Lebens erkannte, auch wenn sie den Sinn schon bisher zu kennen geglaubt und nach ihm gelebt hatte. Das würde sie niemals herausfinden, wenn sie sich nicht davonmachte, bevor die Sonne aufging.
Mit all der Wut, die sich wie die Lava eines Vulkans kurz vor dem Ausbruch in ihr aufgestaut hatte, und ohne auf den Schmerz und die Einschränkungen ihres Körpers zu achten, versuchte sie, sich umzudrehen. Diesmal gab sie nicht auf, als ihre Beine zerkratzt wurden und ihr empfindliches, geschwollenes Knie protestierend aufschrie. Sie weigerte sich, erneut zu versagen, und schließlich standen beide Fersen fest auf dem Boden, Vorderfuß und Zehen nach oben gerichtet.
Ihr Knie pochte wütend, da das Bein jetzt ausgestreckt dalag. Hastig richtete sie sich auf, beugte sich vor und setzte die Handfläche in den Schutt.
Obwohl ihre Augen sich daran gewöhnt hatten, dass es nirgendwo Licht gab, war es unmöglich, Einzelheiten zu erkennen, weil das ganze Gebiet unter einer erstickenden Decke aus Dunkelheit lag. Zaghaft streckte sie die Hände aus, tastete über ihre Beine und streifte mit den Fingern leicht über die Hindernisse, die zwischen ihr und ihrer Freiheit lagen.
Als sie an den schweren Balken stieß, der, wie sie sich jetzt wieder erinnerte, bei der Explosion auf sie gefallen war, fluchte sie laut. Er war es, der ihr Knie erwischt hatte, bevor sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch gelandet und das Gebäude auf sie gestürzt war. Ursprünglich war sie rückwärts gefallen, hatte sich aber im Fallen instinktiv umgedreht und so versucht, sich möglichst gut zu schützen.
Sie hielt einen Moment lang inne, grub die Fingerspitzen in die Schläfen und massierte sie fest. Vielleicht konnte sie so das dumpfe Dröhnen in ihrem Kopf und den restlichen Nebel vertreiben, durch den sie alles sah, seit sie wieder zu Bewusstsein gekommen war.
Es war nur ihr eiserner Wille gewesen, der sie davor bewahrt hatte, der drohenden Dunkelheit in ihrem Kopf nachzugeben, der erlösenden Vorstellung, dass Schmerz, Angst, einfach alles, aufhören würde, wenn sie losließe. Aber sie wusste, wenn sie – falls sie – erneut erwachte, würde sie in einen Albtraum geraten, der schlimmer war als der Tod, dass sie in die tiefsten Tiefen der Hölle gestoßen und erneut die Tatsache beklagen würde, noch am Leben zu sein. Dieses Wissen half ihr, sich mit aller Kraft auf ihre Aufgabe zu konzentrieren.
Dass sie kurz in einem Moment der Schwäche, des Schmerzes und der Verwirrung nach dem Aufwachen bedauert hatte, überlebt zu haben, bevor sie sich zusammengerissen und ihre eiserne Willenskraft zurückgefunden hatte, war das Eine. Etwas ganz anderes war es, den Feiglingen, die für dieses Massaker verantwortlich waren, die Befriedigung zu verschaffen, sie um ihren Tod betteln zu hören.
Diese Vorstellung erzürnte sie genauso wie der sinnlose Tod so vieler guter und großherziger Menschen, die keiner Seele jemals etwas zuleide getan hatten. Menschen, die nur den brennenden Wunsch gehabt hatten, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen konnten.
Den Teufel würde sie tun und diese Dreckskerle jemals um irgendetwas bitten. Sie würde auf ihren »Glauben« spucken und ihnen den Mittelfinger zeigen. Und sollte sie zu dieser Geste nicht mehr in der Lage sein, würde sie die Botschaft mit jedem Blick, jeder Antwort, sogar jedem Atemzug vermitteln. Auch noch mit ihrem letzten Atemzug.
Aber besser war es, ihnen lebendig den Stinkefinger zu zeigen. Von zu Hause aus, nachdem sie ihren Plan zunichte gemacht hatte, jeden einzelnen Helfer umzubringen. Sie würde hämisch triumphieren und ihnen nicht nur mit Worten sagen: Ihr habt mich nicht besiegt. Ihr konntet mich nicht besiegen.
Es war eine Fantasie, ein Ziel, das ihr half, weiter an der Befreiung aus ihrem Gefängnis zu arbeiten. Mit neuer Energie, schneller und wütender, warf sie Steine, Trümmerteile, Teile von Stühlen und Untersuchungsliegen beiseite. Alles außer dem Balken, der quer über ihren Beinen lag.
Sie tastete ihn ab und stellte fest, dass sie alles von ihm heruntergeräumt hatte. Dann beugte sie sich schwer atmend so weit wie möglich vor, fühlte unter ihren Beinen herum und suchte nach einer Möglichkeit, sich unter dem schweren Balken hervorzuwinden.
Nachdenklich runzelte sie die Stirn. Ihre Unterschenkel lagen nicht auf dem Boden, sondern auf einer Schicht Schutt und Trümmer, und waren zwischen dieser Schicht und dem Balken eingeklemmt.
Sie tastete umher, ob der Balken noch auf etwas anderem lag als nur auf ihren Beinen. Er war schwer, aber es fühlte sich nicht so an, als würde das gesamte Gewicht auf ihr lasten. In diesem Fall hätte sie sich unmöglich umdrehen können.
Tatsächlich, der Balken lag zu beiden Seiten auf unebenen Schutthaufen auf. Zwischen ihrem Bein mit dem verletzten Knie und dem Balken blieben gut zwei Zentimeter, aber bei dem anderen Bein drückte er sich in ihre Haut. Allerdings war das Gewicht nicht unerträglich.
Aufgeregt schob sie den Schutt unter ihren Beinen weg und beugte sich vor, mal zur einen, mal zu anderen Seite, um jedes noch so winzige Hindernis zwischen ihren Beinen und dem Boden zu beseitigen. Während ihre blutigen Fingerspitzen über den rauen Betonboden kratzten, entzündete sich Hoffnung in ihr und wurde rasch zu einer lodernden Flamme. Sie würde hier herauskommen, ja!
Nachdem sie alles so weit wie möglich von ihren Beinen weggeschoben hatte, legte sie die Hände hinter sich auf den Boden und lehnte sich möglichst weit zurück. Dann machte sie sich an die schwierige Aufgabe, sich Zentimeter für Zentimeter nach hinten zu schieben. Sie betete, dass sie genügend Platz zwischen Balken und Boden geschaffen hatte, um die letzte Hürde nehmen zu können, die sie von ihrer Freiheit trennte.
Es kostete sie ihre ganze noch verbliebene Kraft. Sie atmete laut ein und aus und sog so viel kostbaren Sauerstoff wie möglich in ihre Lungen, während sie mit vollem Körpereinsatz ihre Beine unter dem schweren Holz hervorzuziehen versuchte.
Jeder Zentimeter verursachte ihr unsägliche Schmerzen. Diesmal verfluchte sie die Tränen nicht, die ihr nicht nur in die Augen traten, sondern ihre Wangen hinabflossen. Sie war zu sehr auf ihr Ziel konzentriert, um sich darum zu kümmern. Außerdem konnte sie die Tränen, so es ihr gelang, sich zu befreien, als Tränen der Erleichterung umdeuten.
Als es einfacher wurde, weil der dickere Teil ihrer Beine heraus war, wuchs ihre Aufregung. Da ihre Beine zu den Füßen hin dünner waren, konnte sie sich nun viel rascher bewegen. Schließlich schlug sie mit den Füßen gegen das Hindernis, und sie musste erst einmal innehalten, Luft holen und Schmerz und Anspannung wegatmen.
Sie streckte die Füße so flach nach vorne, wie es ging. Dann drehte sie sie zur Seite, und das löste solch einen Schmerz in ihrem Knie aus, dass sie die Zähne fest zusammenbeißen musste. Aber es funktionierte. Ihr Fuß glitt ein wenig unter dem Balken hervor und rieb dabei über das raue Holz. Sie spürte, wie sich Splitter in die weiche Haut ihres Fußgewölbes bohrten, aber sie war dem Erfolg zu nahe, um sich davon irritieren zu lassen.
Sie hieß das Gefühl willkommen, das die kleinen Splitter oben auf ihren Füßen auslösten, denn es zeigte ihr, dass sie es fast geschafft hatte. Zum Schluss nahm sie die Splitter gar nicht mehr wahr, nur noch das warme Blut von den Schürfwunden, die sie sich an dem Balken geholt hatte.
Als ihre Füße endlich frei waren, rutschten ihr die Hände weg, und sie wäre beinahe mit dem Rücken auf den Boden geschlagen. Sie richtete sich wieder gerade auf, denn sie wusste, wenn sie sich auch nur einen Moment Ruhe gönnte, würde sie vielleicht nicht mehr die Kraft aufbringen, aufzustehen und zu fliehen.
Das Triumphgefühl wallte heiß und wild durch ihre Adern. Aber als sie aufstand – oder besser gesagt, als sie es versuchte –, fiel sie in sich zusammen wie ein Ballon, aus dem man die Luft gelassen hatte. Ein rasender Schmerz schoss durch ihre Wirbelsäule und weiter hinunter bis zu ihren Füßen, dann wieder hinauf in ihren Kopf, wo er zwischen den Schädelwänden hin und her zu schießen schien. Mehrere Sekunden lang bewegte sich ihr Kopf bei dem Schmerz, der ihr den Hals hinaufjagte, in spasmischen Zuckungen, fast wie bei einem epileptischen Anfall. Sie atmete tief ein und aus, bis sich der Schmerz auf ein erträgliches Maß gelegt hatte. Schließlich ließ auch die Starre in ihrem Nacken nach, und sie konnte sich wieder bewegen.
Sie zitterte wie Espenlaub. Der Versuch aufzustehen, etwas sonst so Unkompliziertes und Selbstverständliches, hatte ihr jegliche Kraft geraubt, sodass sie jetzt wie ein alter Spüllappen schlaff auf dem Boden lag.
Nein. Nicht jetzt. Verdammt. Sie hatte nicht die ganze Nacht lang darum gekämpft, sich unter dem eingestürzten Balken herauszuarbeiten, nur um hier liegen zu bleiben und diesen Männern, die so voller Bosheit waren, deren Hang zu Hass und Gewalt sie nicht im Geringsten nachvollziehen konnte, in die Hände zu fallen. Nein. Sie würden sie nicht in ihre Gewalt bekommen. Lieber würde sie sich umbringen, als diese Monster über ihr Leben entscheiden zu lassen. Aber zum Sterben war sie noch nicht bereit. Sie hatte noch viel vor im Leben. Dies war nur eine kleines – nun gut, ein großes – Hindernis auf ihrem Lebensweg.
Jeder stieß auf Hindernisse. Vielleicht sah sich nicht jeder mit Waffen schwingenden, Raketenwerfer herumschleppenden, gehirnamputierten Irren konfrontiert, die Sprengstoff genauso selbstverständlich einsetzten wie andere atmeten, und die als Transportmittel Panzer benutzten, aber sie hatte relativ unversehrt überlebt. Körperlich unversehrt. Die psychischen Narben würden ihr bis ans Ende ihres Lebens bleiben. Daran bestand kein Zweifel.
Diesmal setzte sie ihre Kraft sehr dosiert ein, stemmte sich mit Hilfe ihrer Hände und ihres unverletzten Knies hoch und achtete sorgfältig darauf, das verletzte Knie nicht zu belasten. Nur mithilfe zweier Hände und einem Bein aufzustehen war nicht gerade die schnellste Methode, aber es würde funktionieren. Diesmal war sie vorbereitet. Sie würde nicht fluchtartig wie eine Idiotin aus dem zerstörten Gebäude rennen, das das ganze letzte Jahr ihr Zuhause gewesen war, nur um sich draußen töten zu lassen.
Sie sah sich gründlich um und erlaubte sich dabei nicht, Trauer zu empfinden. Sie belastete das linke Bein mit dem geschwollenen Knie nur so stark wie nötig, um langsam weiterhumpeln zu können. Sie musste Mittel und Wege finden, ohne Hilfe zu überleben. In einem fremden Land, ohne amerikanische Militärpräsenz, ohne amerikanische Botschaft, ohne Zuflucht oder Unterschlupf, gab es für sie keine Rückkehrmöglichkeit nach Hause, außer es gelang ihr irgendwie, ihre Familie zu verständigen.
Sie hätte den Anblick der zerfetzten, blutigen Leichen nicht ertragen, von denen sie wusste, dass sie hier lagen. Zum Glück waren sie in der Dunkelheit kaum zu erkennen. Sie musste jetzt sehr konzentriert vorgehen, alles genau beobachten und nach Dingen Ausschau halten, die ihr bei ihrer Flucht nützlich sein konnten. Ihrer Flucht nicht nur aus diesem Gebäude und vor den Männern, die sie grundlos angegriffen hatten. Auch aus dem Land als solchem.
Irgendwie musste sie sich auf den langen, gewundenen, beschwerlichen Weg nach Hause machen.
3
»Meine Männer und ich sollen was tun?«, fragte Hancock herablassend, ohne sein Gefühl von »Was soll der Scheiß?« zu verbergen.
Guy Hancock, oder Hancock, wie er meist nur genannt wurde – wobei sowieso nur wenige seinen richtigen Namen kannten –, starrte Russell Bristow durchdringend an. Er ließ sich seine Fassungslosigkeit über dessen Dummheit nicht offen anmerken, dennoch war sie spürbar.
Hancocks Identität wechselte mit dem Wind, und manchmal wusste er selbst beinahe nicht mehr, wer er gerade war. Es war eine ermüdende Art zu leben, die ihm von Tag zu Tag mehr zum Hals heraushing. Aber zumindest hatte sein Leben einen Sinn. Oder hatte mal einen Sinn gehabt. Jetzt war er sich da nicht mehr so sicher. Im Laufe der Zeit war ihm sein strikter Ehrenkodex so weit abhanden gekommen, dass er sich manchmal fragte, ob er nicht längst eine Grenze überschritten hatte und selbst zu dem geworden war, was er so unermüdlich bekämpft hatte. Sein Leben hatte nur aus Töten und Manipulieren bestanden. Er hatte die Meister des Bösen bezwungen und auf seine eigene kalte, methodische Art Gerechtigkeit geübt, die nichts mit irgendeiner existierenden Gesetzgebung zu tun hatte.
Schon lange verfügte er über nichts mehr, das man als Gewissen hätte bezeichnen können. Dafür hatte er einen nie infrage gestellten, tief in ihm verankerten Sinn für ehrenhaftes Verhalten, aber nicht jeder wäre damit einverstanden, dass ehrenhaftes Verhalten auch automatisch ein Gewissen bedeutete. Und sein persönlicher Ehrenkodex war genau das: persönlich. Er sah die Welt nicht schwarz-weiß. Sie bestand aus Grautönen. Aus riesigen Schatten, die ihn zu verschlingen drohten. Manchmal fühlte er sich gejagt – was auch de facto so war –, und es war, als wüsste er, dass seine Zeit begrenzt war. Die Dringlichkeit, sein Opfer aus dem Weg zu räumen – ein Opfer, dem er schon lange hinterherjagte –, hatte allmählich manische Züge angenommen. Der Erfolg war ihm bisher verwehrt geblieben, und jetzt lief ihm die Zeit davon. So nah würde er seinem Opfer nie wieder kommen. Dass wusste er. Seine Leute wussten es ebenfalls. Auch sie hatten alle das Gefühl, dass sie auf dieser Mission vermutlich sterben würden. Und dennoch hatte keiner gekniffen. Sie nahmen den Tod als unabänderlich für den Sieg in Kauf.
Russell Bristow verzog angewidert den Mund. Seine Augen funkelten wütend. Das blöde Arschloch war nicht in der Lage, seine Gefühle zu verbergen und sich seine Wut nicht anmerken zu lassen. Das würde ihn noch das Leben kosten. Hancock zuckte innerlich mit den Schultern. Ein Arschloch weniger auf der Welt und eine Person weniger, die er am Ende beseitigen musste. Aber bis er sein eigentliches Ziel erreicht hatte, musste dieser blöde Dreckskerl am Leben bleiben, auch wenn er ihm nur zu gern den Hals umgedreht und die Welt von dieser miesen Kreatur befreit hätte. Bristow war Mittel zum Zweck, deshalb durfte Hancock seine Abscheu nicht zeigen, bis Bristow seinen Zweck erfüllt hatte. Dann würde er sterben, denn solch ein verkommenes Etwas würde Hancock niemals am Leben lassen.
»Sie meinen wohl meine Männer?«, herrschte Bristow ihn an.
Hancock zog eine Augenbraue nach oben und starrte Bristow nieder. Er wusste, dass dieser Blick andere in Angst und Schrecken versetzte, und auch Bristow, dessen Hals rot angelaufen war, wurde darunter unruhig wie ein Käfer unter dem Mikroskop. Er schaute zur Seite, dann wieder nach vorn, sah Hancock aber nicht mehr in die Augen. Seine Angst verpestete die Luft und ekelte Hancock und seine Männer an. Nicht immer brauchte man Mut, um erfolgreich zu sein. Entschlossenheit schon. Aber aus Angst erwuchs Dummheit. Angst führte zu Fehlern. Angst konnte dazu führen, dass Menschen sich selbst, ihre Ziele und alle anderen verrieten.
Bristow kannte Loyalität nur sich selbst gegenüber, und Hancock beging nicht den Fehler, etwas anderes anzunehmen oder ihn falsch einzuschätzen – genauso wenig wie irgendjemand anderen. Bristow würde Hancock und alle seine Männer opfern, sobald er das Gefühl bekäme, sein Leben sei in Gefahr. Und das war es. Hancock und seine Männer mussten dafür sorgen, dass sich Bristow sicher und unbesiegbar fühlte. Sie mussten ihn in seiner angeborenen Arroganz bestätigen und in seinem Machtstreben unterstützen. Hätte er gewusst, mit was für einem Gegner er sich eingelassen hatte, hätte er sich längst vor Angst schlotternd in einem tiefen dunklen Loch verkrochen, und Hancocks letzte Verbindung zu seiner Zielperson wäre abgerissen. Nein, er brauchte Bristow mit all seiner Dummheit und Eitelkeit. Auch Maksimov wusste, womit er es zu tun hatte. Mit einer Marionette. Einem Mann, der glaubte, alles im Griff zu haben, und doch problemlos von anderen beherrscht wurde. Es war wie ein Schachspiel – das wichtigste, das Hancock je gespielt hatte. Es musste für Maksimov so aussehen, als könnte er Bristow nach Belieben manipulieren, während Hancock ihn gleichzeitig so manipulierte, dass er Maksimov schließlich dort hatte, wo er ihn haben wollte. Hancock musste also beide so beeinflussen, dass es keinem der beiden bewusst wurde.
»Da Sie alle von mir bezahlt werden und meine Befehle ausführen, sind Sie auch alle meine Männer«, sagte Bristow schließlich. Allerdings klang seine Stimme nicht mehr so gebieterisch wie zuvor. Aber er war ja auch ein Feigling, der die Drecksarbeit immer von anderen erledigen ließ. Stünde er vor der Wahl, bei seinen Männern zu bleiben und zu kämpfen, oder sie im Stich zu lassen und zu fliehen, würde er fliehen. Das taten Leute wie er immer. Genau deshalb hatte Hancock sein eigenes Team bei sich, auch wenn er Bristow gegenüber so tat, als hätte er es für ihn zusammengestellt. Bristow wusste nicht, dass Hancocks Leute seit Jahren mit ihm zusammenarbeiteten und ein verschworenes Team waren. Dass sie nur Hancock gehorchten und sonst niemandem. Niemals.
Hancock lebte in einer Welt, in der er nur wenigen Auserwählten traute. So vertraute er Titan, auch wenn sie nicht länger Titan waren. Sie waren … nichts, Überbleibsel jener Regierung, die sie erschaffen hatte, die ihren Tod vorgetäuscht und sie dann wie Phoenix aus der Asche wieder hatte auferstehen lassen, ihnen neue Identitäten verpasst und sie verpflichtet hatte, alle Verbindungen zur Außenwelt zu kappen. Nur die Mission zählte. Nicht Menschen. Nicht Politik. Und auch nicht der heikle Tanz der Diplomatie.
Was die Regierung erschaffen hatte, waren … Monster. Tötungsmaschinen, die weder Gnade noch Gewissen kannten, ausgebildet, Befehle ohne Rücksicht auf Verluste auszuführen. Die Interessen der Mehrheit galten immer mehr als die der Minderheit. Und als Titan zu mächtig wurde, als sie begannen, ihre Befehle zu hinterfragen, als die Missionen zu persönlich zu werden schienen, zu belanglos für eine Gruppe mit ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten, hatte man sie aufgelöst und als Verräter und gemeingefährliche Mörder gebrandmarkt. Sogar als Terroristen. Man hatte sie genauso genannt wie die, die sie gejagt hatten, und das nagte noch immer an Hancock. Nachdem er so viele Jahre ohne Gefühle gelebt, sie willentlich abgeschaltet und seine Arbeit mit eiskalter Effizienz erledigt hatte, hatte er echte Wut kennengelernt. Zuletzt hatte er eine derart überwältigende Wut gespürt, als seine Pflegemutter, die ihm das Gefühl gegeben hatte, etwas wert und Teil ihrer Familie zu sein, ermordet worden war, ein Vergeltungsschlag für eine Mission ihres Mannes. Jene Mission war ein persönlicher Rachefeldzug gewesen. Der einzige. Big Eddie, der Mann, der Hancock seinen Sohn nannte, hatte ihn um Hilfe gebeten. Hatte Rache gewollt. Und selbst wenn Big Eddie ihn nicht gebeten hätte, hätte Hancock Caroline Sinclairs Mörder gejagt.
Aber seitdem hatte sich einiges verändert. Das alles lag Jahre zurück. Damals hatte Titan noch dem Befehl der US-Regierung unterstanden, auch wenn nur wenige Auserwählte von ihrer Existenz gewusst hatten. Sie hatten weitgehend freie Hand gehabt, um die aufzustöbern, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit gewesen waren. Und dann hatte sich ihre eigene Regierung gegen sie gestellt, hatte sie für entbehrlich und leicht zu entsorgen erklärt.
Inzwischen waren die Jäger selbst die Gejagten, und jedes geheime Militärkommando hatte den Befehl, sie zu töten, sobald sie ihrer ansichtig wurden. Nachdem Hancock sich Zugang zu den Computerdateien eines undurchsichtigen CIA-Agenten verschafft hatte, hatte er verdammt viel über das Land erfahren, dem er seinen Treueeid geschworen hatte.
Nein, nicht jeder, der mit der Verteidigung Amerikas und seiner Einwohner betraut war, war schlecht und handelte nur aus Eigeninteresse oder betrog die Menschen, die zu schützen und verteidigen er geschworen hatte. Es gab Männer und Frauen, die sich dieser Aufgabe unermüdlich widmeten. Aber sie alle würden Hancock töten, sobald er ihnen über den Weg lief, weil sie ihn für einen Verräter jener Prinzipien hielten, für die sie lebten und für die sie bereit waren zu sterben.
Titan hatte sich geweigert zu sterben. Sie hatten sich weit über das hinaus entwickelt, was ihre Ausbilder ihnen am Anfang beigebracht hatten. Und jetzt kämpften sie nicht nur, um sogar jene zu schützen, die sie verraten hatten, sowie für zahllose unschuldige amerikanische Leben, nein, sie hatten ihren Einsatzbereich auch auf eine Welt ausgedehnt, in der es genauso Gut und Böse gab wie in der Regierung und dem Militär der USA.
Unschuld kannte keine Grenzen. Keine Nationalität. Niemand war gut oder schlecht, weil er einer bestimmten Nation oder einem anderen Glaubenssystem angehörte. Jeden Tag starben Unschuldige einfach deshalb, weil es niemanden gab, der für sie kämpfte. Nicht einmal ihre eigenen Regierungen. Titan konnte nicht die ganze Welt retten, aber zumindest Teile davon. Einen Teil nach dem anderen.
Maksimov zu beseitigen – endlich –, würde eine Menge Leben retten. Die Zeit, die vergehen würde, bis jemand anderer sich der Überreste seines Reichs bemächtigen und seine Operationen weiterführen konnte, würde ausreichen, dass andere Länder, andere Spezialeinheiten es infiltrieren und zerschlagen konnten, bevor es wieder mächtig wurde.
Denn nach Maksimov … Hancock verfolgte den Gedanken nicht weiter, sondern konzentrierte sich wieder auf die aktuelle Situation. Bristow sollte nicht merken, wie wenig Hancock ihn respektierte. Dass er ihn nicht im Geringsten fürchtete, dass er sich absolut sicher war, Bristows elende Existenz jederzeit vernichten zu können. Auch wenn Hancock versuchte, die vielen Stimmen in seinem Kopf zum Schweigen zu bringen – die ihm von vergangenen Ereignissen erzählten und dafür sorgten, dass seine ungeteilte Aufmerksamkeit dieser Mission galt –, ging ihm immer wieder ein Gedanke durch den Kopf und nistete sich so fest ein, dass er nicht umhinkam, ihn wahrzunehmen. Dieser Gedanke hatte sich tief verwurzelt, und anders als sonst machte Hancock sich diesmal gar nicht erst die Mühe, ihn mit Stumpf und Stiel herauszureißen, um zu vergessen, dass er jemals da gewesen war.
Nach Maksimov kannst du dieses Leben hinter dir lassen. Dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, dich auszuruhen.
Beinahe hätte er mit den Zähnen geknirscht. Der Gedanke machte ihm zu schaffen, wo ihm doch sonst nie etwas zu schaffen machte, ihm nichts naheging. Für einen Mann wie ihn konnte »ausruhen« vieles bedeuten. Aber eine Vorstellung und ein Verdacht verfolgten ihn unermüdlich, und zwar, dass für ihn »ausruhen« die ewige Ruhe bedeutete. Und schlimmer als der Gedanke, dass die Ruhe eine ewige sein würde, war die Tatsache, dass er sich nicht davor fürchtete. Er empfand weder Traurigkeit noch Bedauern. Alles was er spürte, war so etwas wie … Vorfreude. Davon erzählte er jedoch weder seinem Team noch den vier Menschen etwas, die er als Familie betrachtete, den einzigen Menschen auf dieser Welt, die ihm etwas bedeuteten. Die einzigen Menschen, für die er wirklich etwas empfand. Liebe. Treue. Respekt. Für jeden von ihnen würde er willig sterben, das wusste er. Nein, wenn sie Bescheid wüssten, würden sie es ihm viel schwerer machen. Sie würden es niemals verstehen. Sie würden wollen, dass er dieses Leben hinter sich ließe. Sie würden wollen, dass er lebte. Mit ihnen. Sie würden nicht verstehen, dass er sich niemals in ein ziviles Leben einfügen könnte – ein normales Leben. Er wusste ja nicht einmal, was »normal« bedeutete. Er passte nicht in eine Welt, in der alles schwarz und weiß war, wo grau nicht akzeptiert wurde. Er konnte kein Leben führen, in dem er – sollte einem geliebten Menschen etwas passieren – die Verantwortlichen nicht jagen und büßen lassen durfte. Man würde von ihm erwarten, dass er sich auf Polizei und Justiz verließ. Wie bescheuert war das?
Er machte sich seine Gesetze selbst, und das würde sich auch nicht ändern. Er wollte auch gar nichts daran ändern. Niemals würde er sich zurücklehnen und zulassen, dass andere taten, was allein seine Pflicht war.
Bristow kochte vor Ungeduld. Hancocks ausgedehntes Schweigen interpretierte er als Geringschätzung und Ungehorsam. So gern Hancock ihm gesagt hätte, er könne ihn am Arsch lecken, so sehr musste er sich doch wegen des übergeordneten Ziels zurückhalten. Bristow war nur ein Mittel zum Zweck. Hancock würde sich seiner noch nicht entledigen. Aber er würde ihm zeigen, wer hier wirklich das Sagen hatte. Bristow würde lernen, Hancock nicht in die Parade zu fahren, auch wenn er nicht verstehen würde, wieso. Hancock würde nichts konkret aussprechen. Aber Bristow würde genau Bescheid wissen.
»Sie bezahlen mich«, sagte Hancock freundlich. »Ich habe meine Männer eingestellt und bezahle sie. Sie befolgen meine Befehle. Machen Sie sich nicht vor, es wäre anders.«
Obwohl es eine einfache Richtigstellung war, schwang eine Warnung mit, die Bristow durchaus nicht entging. Kurz flackerte ein Hauch von Angst in den Augen des Berufskriminellen auf, bevor er sie ganz offensichtlich mit einem Kopfschütteln verscheuchte und durch einen finsteren Ausdruck ersetzte, der jeden Gedanken an Einschüchterung weit von sich weisen sollte. Er hasste es, sich unterlegen zu fühlen. Hasste es, dass Hancock, der hart und unnachgiebig und nach allgemeinem Standard weder gutaussehend noch irgendwie anziehend war, es fertigbrachte, dass sich ein Mann wie Bristow so … unterwürfig fühlte. Und doch war er sich Hancocks Macht zu sehr bewusst, um den Mann herauszufordern, der für ihn arbeitete. Er hatte … Angst vor ihm. Und das verdross ihn am meisten.
Hancock hätte beinahe gelächelt, aber dafür war er zu diszipliniert. Er wollte, dass das kleine Arschloch Angst vor ihm hatte – und vor seinen Männern. Und dieser machthungrige selbsternannte Herrscher sollte genau wissen, wem die Loyalität seiner Männer galt. Nicht Bristow. Der wäre ein Idiot, würde er sich jemals so etwas einbilden.
»Jetzt zu dieser Frau«, kehrte Hancock zu ihrem vorherigen Gesprächsthema zurück. »Was könnte so wichtig an einer einzelnen Frau sein, dass Sie bereit wären, das Risiko einzugehen, einen der mächtigsten Männer der Welt zu verärgern?«
Wieder flackerte Wut in Bristows Augen auf. Sein rechtes Augenlid zuckte heftig, und er konnte seine Verärgerung kaum zügeln. Bei jedem anderen wäre er längst zur Tat geschritten. Er hätte befohlen, den Mann zu töten, der seine Anordnungen zu hinterfragen wagte und behauptete, nicht er sei der mächtigste Mann der Welt. Er hätte ihm nicht einmal einen raschen, gnädigen Tod gegönnt. Hancock kannte Bristows Verderbtheit aus erster Hand. Er war gezwungen gewesen, ihren Auswüchsen beizuwohnen, um sich zu beweisen. Um in Bristows engeren Kreis zu gelangen, sein Vertrauen zu gewinnen und zu seinem Stellvertreter aufzusteigen.
Der Mann war zutiefst verdorben, und nur das Wissen, dass Hancock ihn, sobald er sein eigentliches Ziel eliminiert hatte, aus dem Verkehr ziehen und seine gesamte Organisation zerstören würde, hatte ihn davon abgehalten, Bristow auf der Stelle zu töten. Aber er brauchte diesen Mann als Schachfigur, so ungern er das zugab. Jeder Idiot mit Bristows Verbindungen wäre genauso gut gewesen. Es ging nicht um Bristow persönlich. Maksimov, das eigentliche Ziel, war ein raffiniertes Dreckschwein, dem Hancock schon so oft nahegekommen war, dass er nicht mehr mitzählen konnte. Doch jedes Mal war ihm der Russe entkommen.
Hancock hatte beschlossen, dass dies die letzte Jagd wäre. Dieses Mal würde alles enden. Er würde jedes einzelne Glied in dieser makabren Kette des Übels aus dem Spiel nehmen. Sie machten die Unschuldigen zu Opfern, stellten die notwendigen Mittel zur Verfügung für jeden, der das Geld und die Mittel hatte, Krieg gegen die Unschuldigen zu führen. Sie waren an so viel Blutvergießen schuld. Strömen von Blut. Hunderttausende von Toten konnten den einzelnen Gliedern der Kette zugeschrieben werden, aber alle waren sie letztlich auf denselben Mann zurückzuführen. Maksimov. Er hatte überall seine Finger im Spiel. Sobald sich eine Gelegenheit ergab, von Leid, Elend und Terrorismus zu profitieren, nutzte er sie.
Ironischerweise versorgte Maksimov gern auch sich feindlich gegenüberstehende Gruppen. Zweifellos fand er es amüsant, wenn sich Gruppen mit Waffen bekämpften, die er ihnen geliefert hatte. Seine Taschen waren prall gefüllt mit dem Geld, das er aus seinem Quasi-Monopol für Waffen, Sprengstoff, jede denkbare Militärwaffe und sogar die nötigen Komponenten für den Bau von Nuklearwaffen schöpfte.
Er stand ganz oben auf der Fahndungsliste jedes zivilisierten Landes. Weltweit war er der meistgesuchte Mann, und dennoch war es noch niemandem gelungen, ihn zu fassen zu bekommen. Während der Jahre, in denen Hancock ihn unablässig gejagt hatte, hatte er mehr Niederlagen einstecken müssen als ihm lieb war. Er hatte alle Wege ausgelotet, die zu Maksimov führten. Hatte Partnerschaften mit denen gepflegt, die weit oben in der Hackordnung standen, an deren Spitze sich Maksimov befand. Hätte Hancock nicht einen Hauch von dem gehabt, von dem er schwor, es gar nicht zu besitzen – ein Gewissen –, hätte er den Dreckskerl schon zweimal dingfest gemacht haben können.
Im Stillen hatte er sich schon hundertmal ausgeschimpft, und doch konnte er nicht wirklich Reue über die Entscheidungen empfinden, die er getroffen hatte. Allerdings hatte er sich geschworen, niemals mehr das Schicksal eines Einzelnen über das der Menge zu stellen. Der Preis war zu hoch. Er hatte sein Ziel für einen einzelnen Unschuldigen geopfert. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Auch wenn er sich vorstellte, wie viele Tausende von Unschuldigen gestorben waren – noch immer starben –, nur weil er zwei Unschuldige gerettet hatte, zwei Menschen, die durch und durch gut waren – genau das Gegenteil von ihm selbst –, bestärkte ihn das nur in seinem Beschluss, nie wieder gegen seine Ehre, gegen sein Glaubenssystem zu verstoßen. Ihm war klar, dass der Verlust der beiden Frauen, für deren Rettung er seine Mission hintangestellt hatte, eine Tragödie gewesen wäre. Die Welt brauchte Menschen wie Grace und Maren. Aber ihm blieb keine andere Wahl, als wieder in seine von Gefühlen freie Existenz einzutauchen, die so viele Jahre sein Leben gewesen war, und sich hinter einer dicken Mauer zu verschanzen, damit er nur noch das brennende Verlangen verspürte, seine Mission um jeden Preis zu Ende zu bringen.