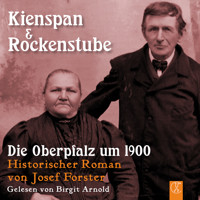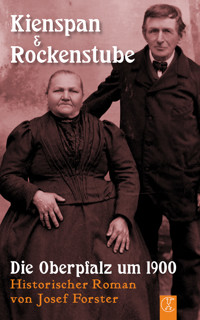
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Yellow King Productions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Roman von Josef Forster beschreibt anhand einer Oberpfälzer Bauernfamilie ein eindrucksvolles und umfassendes Sitten- und Gesellschaftsbild der Menschen im nordostbayerischen Grenzgebiet um 1900. Die Jahrhundertwende läutete auch im damaligen Nordgau das Industriezeitalter ein, während sich die Menschen ihren Sitten und Gebräuchen des 19. Jahrhunderts noch verpflichtet fühlten. Es war eine Zeit großer Neuerungen, die von den Menschen mit Bravour und viel Geschick gemeistert wurden, ohne dadurch die ursprünglichen Traditionen zu vernachlässigen oder zu verleugnen. Das Buch erschien erstmals als Fortsetzungsroman in der Tageszeitung "Der Neue Tag", Weiden und wurde dort auch ausführlich vorgestellt. Unter anderem schrieb der Redakteur: "Wenn es Ihnen so geht wie uns, dann werden Sie von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt sein. Das Rezept ist klassisch: Es wird schlicht und einfach das Leben einer Familie im Jahreslauf erzählt, gespickt mit so vielen Details, die wir vergessen haben und die verschütt gegangen sind. Die Themen sind vielfältig wie das Leben selbst: Gesinde und Schlachttag, Federnschleißen und Waldarbeit, Zahnschmerzen und Zauberei, Schule und Kirche, Paschen und Prügelstrafe, Geister, Wunder und Arme Seelen, Taufe, Kommunion, Heirat und Tod und natürlich auch Kienspan & Rockenstube. Geschichte und Geschichten verbindet der Autor mit Romanfiguren, welche die normalen Freuden, Bedürfnisse und Beschwernisse durchleben, die schmuggeln und um ihr karges Brot bangen, die sich verlieben...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Copyright © Yellow King Productions Mario Weiß Neuöd - Gewerbepark 12a 92278 Illschwang E-Mail: [email protected] Web: www.yellow-king-productions.de
Autor: Josef Forster Lektorat: Mario Weiß Cover: Axel Weiß
Josef Forster
Kienspan & Rockenstube Die Oberpfalz um 1900
Historischer Roman
Heimat ist Gefühl und Wissen
Erinnerung
Gedankenversunken kauerte der alte Mann auf dem angewitterten Baumstumpf, dem er sich in Farbe und Gestalt anzupassen schien. Auf seinen knorrigen Stock gestützt, hing er müde seinen Gedanken nach. Was war aus ihm geworden? Lange Jahrzehnte seines Lebens waren in gleichmäßiger Ordnung an ihm vorüber gezogen und er war zufrieden gewesen, dass er sein Auskommen hatte. Die Landwirtschaft, die ihm sein Vater als jüngsten Sohn einer vielköpfigen Bauernfamilie vererbte, sorgte für ein bescheidenes aber immerhin regelmäßiges Einkommen. Er hatte gut gewirtschaftet und das Anwesen um einige Tagwerk Acker und Wiesen vergrößert, bevor er es nach langem Drängen und mit schwerem Herzen an seinen Sohn Hans übergab.
Mit seinen sechzig Jahren konnte er sich nur noch schwach an die wichtigsten Stationen seines Lebens erinnern. Davon war lediglich die Kindheit unbeschwert. Sobald er nicht mehr am Rockzipfel der Mutter hing, konnte er frei umherstreunen, von kleineren Pflichten und Arbeiten abgesehen. Die Schule ging nebenbei. Nur die harte Zucht der schlecht ausgebildeten Lehrer war ihm noch im Gedächtnis, die ihr bescheidenes Wissen mit dem Stock in die verschüchterten Kinder eintrichterten. Danach gab es Arbeit, Arbeit und wieder Arbeit, verbunden mit einem einfachen aber auskömmlichen Leben in einem schönen, manchmal unwirtlichen Mittelgebirge, dem bayerischen Nordgau. Unterbrechung brachten zwei Kriege, in denen er 1866 erst mit den Österreichern gegen die Preußen und dann 4 Jahre später mit eben diesen Preußen gegen die Franzosen zog. Erst danach suchten seine Eltern für ihn eine passende Frau. Die gebar ihm acht Kinder, von denen drei am Leben blieben. Vor einigen Jahren war nun seine Frau gestorben. Dies war letztendlich der Anlass, den Hof an seinen Sohn zu übergeben.
Ein altes Sprichwort sagt:
„Übergeb’n – nimmer leb’n“.
Wenn der Hof einmal an den Sohn übergeben war, hatte man viele Sorgen los, man war aber auch überflüssig und eine Last für seine Mitmenschen. Sein Los war, Gott sei Dank, nicht ganz so schlimm, wie er es von anderen Austräglern immer wieder hörte. Sein Sohn hatte sich schon früh ein zweites Standbein geschaffen, um zusammen mit den Ersparnissen seiner Eltern die zwei Schwestern ausbezahlen und gut verheiraten zu können. Diesem Nebengeschäft, dem Handel, besser gesagt dem Paschen mit Rindern und Pferden aus Böhmen, ging sein Sohn immer noch nach und war daher oft unterwegs. Das Paschen oder Schmuggeln war zeitaufwändig und gefährlich, da es verboten war, aber man konnte gutes Geld damit verdienen. Während der regelmäßigen Abwesenheiten seines Sohnes war er nach wie vor der Bauer und konnte sich um alles kümmern. Sein Sohn hielt sich an den vereinbarten Austrag und so konnte er in seiner Stube und auf dem Hof ein zufriedenes Leben führen, bis er vor etwa einem Jahr mit einer fiebrigen Krankheit nieder lag. Davon hatte er sich nicht mehr richtig erholt. Den Sommer über ging es noch recht und schlecht. Jetzt aber, da die Sonne wieder schwächer wurde und die Kühle bereits am späten Nachmittag in die alten Glieder kroch, fühlte er, dass der Körper die Last des Alters nicht mehr tragen wollte. Viel schlimmer war aber noch, dass auch sein Geist müde geworden war. Was ihm sein Sohn und seine Enkel in den letzten Jahren immer wieder erzählten, konnte er nicht mehr verstehen. Nach dem gleichmäßigen Ablauf und Verständnis seines Lebens waren für ihn die Welt und die Menschen auf ihr verrückt geworden.
Schon seit einigen Jahren jammerten die Bauern, dass sie keine Knechte und Mägde mehr bekamen, weil alle jungen Leute in die Fabriken gingen und in die Städte auswanderten, wo sie vermeintlich viel mehr Geld für weniger Arbeit erhielten. Vor einigen Jahren gründeten der Pfarrer, der Schullehrer und einige andere „Närrische“ einen Darlehenskassen-Verein. Nun bewahrten die Leute ihr sauer erspartes Geld nicht mehr im Strohsack oder einem anderen häuslichen Versteck auf, sondern brachten es auf die „Kasse“, wo es in einen eisernen Schrank geschlossen und bei Bedarf gegen Zinsen wieder an andere Leute verliehen wurde. Jetzt war es so, dass der Bauer an Lichtmeß sein Geld von der Kasse holte und den Lohn an seine Dienstboten ausbezahlte. Die zahlten es dann schnellstens wieder im Darlehensverein ein. Sie bekamen dafür sogar noch Geld, „Zinsen“, wie sie sagten. Wollte der Bauer nun etwas anschaffen, konnte er sich vom Verein das Geld seines Gesindes oder anderer Einzahler wieder leihen, natürlich auch gegen „Zinsen“. Das sollte noch jemand verstehen. Er selbst hätte Angst gehabt, sein Geld nie wieder zu sehen. Aber die Jungen waren voll Begeisterung. Über Einlagen von mehr als 100.000 Mark sollte der Verein bereits verfügen. Im vorigen Jahr wurde eine Getreidereinigungsmaschine angeschafft, die gegen eine Gebühr von fünf Pfennigen pro Zentner Getreide die mühselige Arbeit von vielen Tagen in wenigen Stunden erledigte und zugegebenermaßen noch viel besser als bisher. In diesem Jahr sollte sogar noch eine Dampf- und Dreschmaschine gekauft werden, „um auf dem Weltmarkt konkurrieren zu können“, wie der Bürgermeister sagte. Wie sich das rechnen sollte war ihm unklar, vor allem weil die Getreidepreise seit den Bestrebungen des Zollvereins, die Einfuhr aus dem Ausland zu erleichtern, stetig sanken. Dafür baute die Gemeinde selbst in kleinen Orten wie Waidhaus bereits Wasserleitungen bis in die Häuser. Straßenleuchten, die der Nachtwächter täglich anzündete und morgens wieder löschte, erhellten die vormals finsteren Gassen. Vor kurzem beschloss der Gemeinderat sogar, die Eisenbahn bis nach Waidhaus zu holen. Die Grundstücke waren bereits gekauft. Verträge über die Versorgung mit Wasser und den Neubau einer Zufahrt wurden geschlossen. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis das fauchende und Rauch speiende Ungeheuer einer Lokomotive auf den eisernen Schienen die Kühe erschrecken würde, so dass sie keine Milch mehr gaben. Ruß und Asche würden sich auf Wiesen und Felder legen. Mit einer solchen Feuermaschine durch die dichten Wälder der Oberen Pfalz zu fahren, erschien dem Austragsbauern geradezu selbstzerstörerisch, genauso wie die übermütigen Fahrer der Benzinkutschen, die von Zeit zu Zeit auf der alten Handelsstraße nach Böhmen und Prag ratterten. Nein, er verstand die Welt nicht mehr und fühlte sich auch nicht mehr zu ihr gehörend. Wenn er an den bevorstehenden Winter dachte, den er die meiste Zeit allein in seiner Kammer verbringen würde, sah er keinen Sinn mehr in seinem Leben. Für ihn war es Zeit, Frieden mit sich und seinem Herrgott zu machen.
„Großvater, ich soll Euch holen. Die Mutter hat gesagt ich soll ausbuttern und dann gibt’s eine frische Buttersuppe“,
schreckte ihn seine Enkelin Maria aus seinen depressiven Tagträumen. Unwirsch streifte er die Hand beiseite, die ihn stützen wollte. Solange er lebte, würde es sein Stolz nicht zulassen, dass er sich helfen ließ, lieber würde er freiwillig sein Leben beschließen. Die einzige Hilfe, die er sich gestattete, war ein fester Stock aus Haselnussholz, dessen Astwucherung am Ende als Griff diente. So erhob er sich langsam und schlurfte, begleitet von seiner Enkeltochter Maria, die sich in respektvollem Abstand hielt, bedächtig auf das Haus zu.
Er betrachtete sich den Bauernhof mit Wohlgefallen. Für ihn war es immer noch sein Haus, auch wenn nun sein Sohn als Bauer das Sagen hatte. Er hatte das Anwesen von seinem Vater übernommen, erweitert und erhalten. Es war ein typisches Oberpfälzer Anwesen. Die niedrige Traufseite zog sich entlang der Straße und vermittelte einen verschlossenen, wehrhaften Eindruck, der durch die kleinen, durch Sprossen geteilten und von granitenen Laibungen umrandeten Fenster, verstärkt wurde. Der Giebel wandte sich der Südseite zu, wo sich ein großzügiger Hausgarten für frische Kräuter, Blumen und Gemüse anschloss. Die Rückseite des Gebäudes duckte sich tief in das etwas ansteigende Gelände. Durch die niedrigen Fenster kletterten die Kinder direkt auf die angrenzenden Wiesen. West und Ost waren die Wetterseiten. Während von Westen die häufigsten Regenschauer und Gewitter herzogen, blies von Osten regelmäßig der gefürchtete böhmische Wind, der oft tagelang anhielt und im Winter Straßen und Häuser unter großen Schneemassen vergrub. Die Männer mussten dann ausrücken, um mit Hand- und Spanndiensten die Zugänge und Straßen freizuschaufeln. Währenddessen vergnügten sich Kinder und Heranwachsende, indem sie mit ihren Schlitten oder auch nur auf dem Hosenboden von den Dächern rutschten.
Jetzt im Spätherbst war der Hausgarten innerhalb des hohen verwitterten Hanikelzaunes aus dünnen Fichtenstämmen braun und aufgeräumt. Nur noch wenige Blumen trotzten dem schlechter werdenden Wetter.
Von der Straße aus führte ein schmaler Zugang über tiefe Treppenstufen aus Granitplatten zu dem etwas erhöht stehenden Anwesen. Auf die Haustüre zugehend, wanderte der Blick des alten Mannes von links an den beiden Fenstern, die ein schwaches Licht in die Stube des Hauses brachten, vorbei, zu der schmalen zweiflügeligen Eingangstüre und einem weiteren Fenster, das zu seiner eigenen Stube gehörte. Dem Wohnhaus schloss sich der Stall an, mit einer niedrigen Türe und einem kleinen Fenster mit fast blinden Scheiben für die Belüftung und Beleuchtung. Haus und Stall waren aus Stein gebaut. Massive, fünfzig Zentimeter dicke Mauern aus Granitblöcken, verfugt mit einem Mörtel aus Sand und gelöschtem Kalk, trugen das hohe spitze Dach, das erst vor einigen Jahren mit Tonziegeln gedeckt worden war, die sich nach den verheerenden Bränden des letzten Jahrhunderts immer mehr einbürgerten. Von der Haustüre führte ein etwa eineinhalb Meter breiter, mit Steinplatten belegter, Gang entlang der Traufseite bis zum Stadel. Gleich gegenüber dem Stalleingang lag in einer vertieften Kuhle der Misthaufen und an dessen Ende stand das Klohäusl. Dem Stall schloss sich ein hölzerner Stadel an, der mehrfach erweitert worden war und den der Jungbauer vor einigen Jahren durch einen rückwärtigen Giebel nochmals umbaute. Nur wenige Menschen wussten, dass er dort, hinter dem Schweinekoben, noch einen zweiten Stall als Versteck für die gepaschten Rinder eingerichtet hatte.
Durch die zweiflügelige massive Haustüre gelangte der Altbauer in die Diele, die das Haus in zwei Hälften teilte. Links lagen die große Stube und der Schlafraum für die Eltern und die kleinen Kinder. Geradeaus erreichte man den Vorratsraum, neben dessen Zugang ein klobiger bemalter Schrank bereits einen Teil der Vorräte enthielt. Nach dem Eingang, gleich rechts, lag die Austragsstube des Altbauern. Danach mündete ein kurzer Gang direkt in den Viehstall. Die hölzerne Treppe führte auf den Dachboden. Hinter der Treppe gelangte man durch eine Art Gang, in der die Werkstatt untergebracht war, in die Tenne und den Stadel. Unter der Treppe hatten die früheren Anwesensbesitzer in mühevoller Arbeit den Zugang zu einem kühlen und feuchten Erdkeller aus dem steinigen Boden gegraben.
Der Hauptteil des täglichen Lebens spielte sich in der großen Stube ab. In ihr wurde gegessen, gekocht, gearbeitet und manchmal sogar geschlafen. Gleich links neben der Tür spendete der immer gefüllte tönerne Behälter das unverzichtbare Weihwasser. Daneben nahm eine wuchtige Rem das irdene Geschirr des Haushalts auf. Vom ersten Fenster auf der Straßenseite lief eine stabile Holzbank über die halbe Giebelseite. Im Eck stand der große massive Tisch, in dessen Schublade das Besteck, das angeschnittene Brot, Salz und Pfeffer ihren Platz hatten. Im Winkel über Tisch und Bank hing ein geweihtes Kreuz, mit Palmzweigen dekoriert und von zwei strahlend bunten Bildern des dornengekrönten Heilands und der himmelwärts betenden Mutter Maria flankiert. Die andere Zimmerecke, die rechts gegenüber der Türe lag, füllte der alte grüne Kachelofen aus. In der großen Öffnung auf halber Höhe konnte man Speisen garen oder warm halten. Die freie Fläche unter dem Sockel stand im Winter als Hühnerstall zur Verfügung. Zwischen Wand und Kachelofen befand sich die Höll, ein freier Spalt, der dem Bauern als überaus beliebter, warmer Liegeplatz für seine Mußestunden oder auch als allgemeines Krankenlager diente. Einen Teil seiner Wärme gab der Kachelofen auch in die dahinter liegende Schlafstube ab, in die man durch eine weitere Türe neben dem Kachelofen gelangte. In der rechten Ecke vom Stubeneingang gesehen stand die neueste Errungenschaft des Hauses, ein neumodischer Herd mit einer großen Eisenplatte. Direkt über dem Feuerraum waren verschieden große abnehmbare Ringe eingelassen. Man konnte dadurch Pfannen und Töpfe auf der Herdplatte erwärmen oder wenn die Ringe entfernt wurden, direkt auf das offene Feuer stellen, um so eine bessere Hitze zu erreichen. Gleichzeitig hatte der Ofen eine große Bratröhre in der vorzugsweise am Sonntag der Braten und wochentags der allseits beliebte Dotsch knusprig gebraten werden konnten. Ein weiterer Bestandteil des Ofens war ein großes Granl, ein rechteckiger, tiefer Wasserbehälter, der zu jeder Zeit warmes oder heißes Wasser bereit hielt. Über dem Ofen hingen an dünnen entrindeten Fichtenstangen, die mit eisernen Haken an der Decke befestigt waren, nasse oder feuchte Kleidungsstücke. Auf dem Ofen stand fast immer ein großer blecherner Topf, in dem der tägliche Bedarf an gekochten Kartoffeln für Mensch und Tier dämpfte. Durch das dauernde Kochen und Vorhalten des heißen Wassers war es in der Stube ständig warm und feucht, im Sommer auch manchmal unerträglich heiß. Wasserdampf ließ die Fenster im Sommer und im Winter anlaufen und zauberte in der kalten Jahreszeit herrliche Eisblumen an die kleinen Scheiben. Die ungesunde Wechselwirkung der kühlen Granitmauern mit der feuchtwarmen Zimmerluft sättigte den dünnen Mauerputz mit Wasser, so dass sich vor allem in den Ecken und unter der Decke regelmäßig Wassertropfen bildeten, die dann in dünnen Rinnsalen an den Wänden herabsickerten. Von regelmäßigem Lüften hielten die Bauernleute wenig. Frische Luft hatten sie den ganzen Tag. Wenn sie sich in der Stube aufhielten, dann liebten sie es warm, auch wenn es dabei ziemlich muffig wurde.
Der alte Mann konnte sich seine Familie vorstellen, wie sie versammelt um den großen klobigen Tisch saß. An der Stirnseite auf der Bank unter dem Herrgottsbild war der Platz seines Sohnes, Hans Grabner, des Steffelhofbauern. Steffelbauer war der Hausname des Anwesens, der Name der unabhängig vom jeweiligen Besitzer den Hof bezeichnete. Seine Frau Katharina saß ihm gegenüber auf einem der vier Stühle. Sie hatte damit den kürzesten Weg zum Ofen, zum Geschirr und zur Speis. Vor ihr war auch der Schub in den Tisch eingelassen, der Brot und Bestecke enthielt.
Links auf der Bank saßen die drei Kinder, die Tochter Maria, mit ihren 18 Jahren die Älteste, dann die Buben Hansl und Seppl, acht und sechs Jahre alt. Auf der freien rechten Seite standen zwei Stühle für die Ehalten, den alten Knecht Alois und die Magd Zilli. Sein eigener Platz war neben dem seines Sohnes.
Heute drängte es den Austragsbauern nicht in die warme Stube. Er wollte allein sein und ging, nachdem er seine Enkelin weggeschickt hatte, zu seiner eigenen Kammer. Die hölzerne Türe knarrte in den Angeln als er den abgewetzten Türgriff niederdrückte. Das Zimmer war nicht groß aber ausreichend. Auf der rechten Seite stand ein zweiflügeliger Holzschrank mit zwei Schüben im unteren Teil. Der Kasten enthielt seine eigenen Habseligkeiten und Dinge, die ihn noch an seine verstorbene Frau erinnerten. Für seinen Gebrauch hatte er einige lange leinene Hemden, darunter noch sein weißes Hochzeitshemd, eine gute Hose, Hosenträger, Kragen, Hut, Weste, Joppe, lange Unterhosen, Strümpfe und Schnäuztücher. Daneben lagen in den Fächern noch unbearbeitetes Leinen, Flachszöpfe, Wäsche und Röcke seiner Frau. Geklöppelte Borten verzierten Rahmen und Fachbretter. Gebrauchte und neue Wachsstöcke erinnerten an die zahlreichen Wallfahrten zur lieben Frau auf dem Fahrenberg, zur Rosenquarzkirche in Pleystein oder ins Böhmerland.
Den Rest des Zimmers dominierte das massive hölzerne Gestell, das ihm und seiner Frau während ihres gemeinsamen Lebens als Bettstatt gedient hatte. Kopf und Fußteile hatte der Schreiner aus dicken Brettern zu einem beeindruckenden Möbel verbunden, das mühelos die dicksten Federbetten zu kleinen Kissen schrumpfen ließ. Im Bettrahmen dienten ungehobelte Bretter als Auflage für den mit Haferstroh gefüllten Sack, der, wie man an den Einbuchtungen sah, bereits gut eingelegen war. Ein dickes, mit Gänsefedern gefülltes Bettzeug verdeckte fast das ebenfalls prall mit Daunen ausgestopfte Kopfkissen.
Der alte Mann entledigte sich seiner Jacke und streifte die Hosenträger von den Schultern, worauf das weite Beinkleid auf den Boden glitt. Das lange Hemd, das bisher im Hosenbund steckte, rollte sich dadurch bis zu den Knien aus. Dieses Kleidungsstück mit dem kleinen Stehkragen diente gleichzeitig als Oberhemd und als Nachtgewand. Früher trug er das Hemd höchstens zwei Wochen. Dann legte ihm seine Frau ein Frisches hin. Heute wechselte er das Kleidungsstück allenfalls alle vier Wochen. Mit seiner langen Unterhose und seinen wollenen Strümpfen schlüpfte er in sein Bett und versuchte unter dem Berg von Federn etwas Wärme um seine alten Knochen zu sammeln. Er hoffte, dass ihm seine Schwiegertochter vor dem Schlafengehen einen in der Backröhre erwärmten Ziegelstein zu den Füßen legte, der die gespeicherte Hitze bis in die frühen Morgenstunden abgeben würde.
Maria kam ohne den Großvater in die Stube. Die Mutter war momentan zu beschäftigt, als dass ihr dies aufgefallen wäre. Die Bäuerin nahm gerade einige Kartoffeln aus dem auf dem Ofen stehenden Topf, zerdrückte sie in einer Schüssel und vermischte sie mit Kleie und Magermilch. Im Hinausgehen bemerkte sie zu Maria:
„Ich muss noch die Schweine füttern. Du butterst einstweilen aus. Der Rahm steht in der Speis. Wenn du fertig bist, streichst du die Butter in die Holzmodeln und stürzt sie auf ein Holzbrett. Die Pfarrköchin kommt morgen und holt die Butter ab. Pass aber auf, dass keine Buttermilchblasen drin sind, sonst kommt sie sich wieder beschweren. Was übrig bleibt, kannst du heute Abend zum Essen hinstellen und die Budersupp`n machst schön dick, damit auch alle satt werden.“
Maria wusste, dass sie nunmehr mit ihren Aufgaben allein war und dass keine Ausreden halfen. Die Mutter erwartete, dass das Essen fertig war, wenn sie wieder aus dem Stall kam. Maria hoffte nur, dass der Rahm in Ordnung war und nicht zu lange brauchte, bis das weiße Milchfett zu den begehrten cremigen Klumpen gerann. Sie holte das Butterfass in die Stube, einen rechteckigen Holzkasten, der von zwei Metallbändern zusammengehalten wurde. In der Mitte der breiten Seite befand sich die Kurbel, an deren Achse im Innern des Fasses vier mit runden Löchern durchbrochene Holzflügel befestigt waren. Mit diesen Flügeln wurde die weiße Flüssigkeit, je nachdem wie schnell man die Kurbel drehte, kräftig durcheinander gemischt. Es war eine Kunst, den Rahm gerade am Anfang mit viel Gefühl aufzuschäumen und dann erst mit Schwung das Fett von der Milch zu trennen. Maria hatte bereits Erfahrung. Sie wusste wie schwierig und langwierig es werden würde, wenn das Butterfass nicht richtig vorbereitet war. Sie nahm kaltes Wasser aus dem Bottich, der täglich mit frischem Brunnenwasser gefüllt wurde und schwenkte das Fass aus. Es konnte sein, dass die Kuh und damit die Milch bereits im Stall verhext war. Vorsorglich gab sie deshalb einige Tropfen Weihwasser in die Spülflüssigkeit. Das Wasser goss sie in das Granl, denn das Weihwasser durfte nicht achtlos weggeschüttet werden. Auf dem Umweg über den Wasserbehälter gelangte es ehrenvoll wieder in Speis und Trank für Mensch und Tier. Maria füllte den seit einigen Tagen gesammelten Rahm, der einfach von der über Nacht abgestandenen Milch abgeschöpft wurde, in das Fass und gab nochmals einen Spritzer Weihwasser hinzu. Dann nahm sie das am großen Deckenbalken der Stube in Form eines Ringes hängende, geweihte Dreikönigssalz und schabte vorsichtig einige Körner in das Butterfass. Danach schloss sie den Deckel, machte das Kreuzzeichen darüber, drehte die Kurbel und achtete auf das platschende Geräusch im Innern des Behälters. Nach einer Weile erhöhte sie die Geschwindigkeit und hoffte inständig, dass bald die ersten Butterflocken von den Lochbrettern fallen würden. An diesem Tag war der Rahm in Ordnung. Bald konnte sie den Deckel abnehmen, mit der Hand die gelben Butterstücke herausfischen und in die vorher in kaltem Wasser eingeweichten Holzmodeln drücken. Mit dem Stiel eines Kochlöffels strich sie die offene Seite des Models glatt und stürzte das schön geformte Butterstück unter leichtem Klopfen auf das bereitliegende Holzbrett. Zufrieden mit dem Ergebnis, wiederholte sie den Vorgang noch dreimal, bis nur noch einzelne Butterstückchen in der Milch schwammen. Die fischte sie einzeln heraus und legte sie in eine kleine irdene Schüssel. Nachdem sie die Butterschlegel, die an die Pfarrerköchin verkauft werden sollten, in die Speis gebracht hatte, fachte sie mit einigen Reisigzweigen, die sie aus der Holzkiste unter dem Ofen nahm, die Glut im selbigen wieder an. Als die große Herdplatte spürbare Wärme verströmte, setzte sie den großen Emailtopf darauf und füllte die dünne Buttermilch hinein. In einem festen Tonbecher verzwirlte sie warmes Wasser aus dem Granl mit Mehl zu einem klumpenfreien flüssigen Brei, den sie in die heiße Milch rührte. Sie würzte die nunmehr dickflüssige Milch mit einer Prise Salz und zog sie nach dem Aufkochen an den weniger heißen Rand des Herdes. Mit jetzt von der Hitze geröteten Wangen zog sie den Topf mit den Kartoffeln in die Mitte des Ofens, um auch diese zu erwärmen. Heute gab es eines ihrer Lieblingsgerichte, eine feinsäuerliche Buttermilchsuppe, heiße gedämpfte Kartoffeln, mit Salz bestreut und mit frischer zerlaufender Butter oben drauf.
Geschichte und germanische Götter
Der alte Steffelbauer hatte sich in seinem Strohsack mittlerweile erwärmt und war eingeschlafen. Zeit seines Lebens war er ein tiefgläubiger Mensch gewesen. Mit seinem Herrgott hatte er in Frieden gelebt. Die Muttergottes verehrte er und bat sie beizeiten um gutes Wetter und fruchtbare Ernte. An Sonn- und Feiertagen besuchte er regelmäßig die Gottesdienste. Manchmal war er nicht ganz aufmerksam und tauschte mit seinen Nachbarn auf den hinteren Bänken der Empore auch mal die neuesten Nachrichten oder landwirtschaftlichen Preise aus. Mit zunehmendem Alter war er auch ein paar Mal eingenickt. Aber das waren kleine, lässliche Sünden. Dafür beichtete er auch regelmäßig und an Fronleichnam trug er bis vor wenigen Jahren, als einer der vier Auserwählten, den goldenen Himmel über der Monstranz, was eine große Ehre war. Nie versäumte er, sich mit Weihwasser das Kreuzzeichen auf die Stirn zu zeichnen, wenn er das Haus verließ und nur ganz selten hatte ihn jemand fluchen hören. Aber er vergaß auch nicht die Überlieferungen, die alten Sagen und Geschichten, die ihn seine Eltern und Verwandten gelehrt hatten. Sie hatten viel mit dem Glauben der Menschen vor vielen Generationen zu tun. Pfarrer, Lehrer oder Amtspersonen, die in diese traditionelle Gegend des Böhmerwaldes verschlagen wurden, bezeichneten dies abwertend als Aberglauben oder heidnische Bräuche. Er, der sein Wissen wieder an seine Kinder weitergegeben hatte, sah das anders.
Der Nordgau oder der Oberpfälzer Wald, wie er jüngst auch genannt wurde, war erst sehr spät christianisiert worden. Durch seine Lage nördlich der Donau und des römischen Limes, unwirtlich genug um bis ins späte Mittelalter fremde Eroberer abzuhalten, gelangten kaum fremde Einflüsse ins Land. Dafür nutzten zahlreiche keltische oder germanische Stämme die Abgeschiedenheit, um auf ihren Wanderungen unbemerkt bis zu den römischen Grenzen an der Donau zu gelangen. Viele germanische Stämme und Völker durchzogen dieses Land. Zahlreiche Menschen mit unterschiedlicher Herkunft blieben in dem undurchdringlichen und damit sicheren Bergland. Sie brachten außer weiteren Göttern auch neue Überlieferungen und Sitten mit, die zu einem ganz eigenen Brauchtum verschmolzen das sich über Jahrhunderte erhielt.
Viele der Bräuche waren von der christlichen Kirche in ihrem Ritus übernommen worden und konnten deshalb nicht so schlecht sein. Einige wurden nur geduldet, wieder andere abgelehnt. Zugute kam den Menschen, dass die Germanen ihre Götter nicht als Bilder oder plastische Abbildungen darstellten. So konnten die Mythen nicht zerstört oder gestürzt werden. Sie existierten fest in der Gedankenwelt und wurden von Generation zu Generation weitergegeben.
Für die Urbewohner waren die Götter Bestandteile in der Natur. Die vier Elemente Licht, Luft, Wasser und Erde waren besetzt mit mystischen Wesen, die die Geschicke der Menschen bestimmten und die man nicht verstimmen durfte. In der Schule nahm die Lehre von den germanischen oder nordischen Göttern noch einen breiten Raum ein. Den Altbauern hatten die Geschichten über das Götterland Asenheim und die himmlische Burg Asgard, in der Donar oder Wodan mit den zwölf Göttern residierte, schon als Kind fasziniert und auch als Erwachsenen nicht mehr losgelassen. Sagen über Wallhall, in dem Freyja, die schöne und mächtige Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe und der Zärtlichkeit, die gefallenen Helden empfing oder über Midgard dem Himmel der Menschen zwischen der Feuerwelt im Süden und der Eiswelt im Norden.
Diese Geschichten hatten den Einfluss auf ihn auch im Alter nicht verloren. So sah er die Natur, seine Felder, Wiesen und den Wald nicht nur als Gegenstände und Kapital, sondern als allgegenwärtigen Aufenthaltsort vieler Geister, Kobolde, Götter und Dämonen, auf die Rücksicht zu nehmen war und die man mit bestimmten jahreszeitlichen Verrichtungen besänftigen oder beeinflussen musste. Besondere Stimmung überfiel ihn jedes Mal in den zwölf Rauhnächten des Jahres, wenn die wilde Jagd durch die Lüfte stürmte und die Menschen gut beraten waren, unsichtbar zu bleiben und dem geisterhaften Treiben aus dem Weg zu gehen. Es wunderte ihn nicht, dass gerade jetzt, da er seines Lebens müde war, seine Vorstellungen von der wilden Geisterjagd in seinen unruhigen Träumen noch einmal an ihm vorbeizogen. Allen voran brauste der Göttervater Wodan mit rotem Haar und wallendem Bart auf seinem achtfüßigen Pferd Sleipnir durch die stürmische Nacht, in der Hand seinen Speer Gungnir, der nie im Stoß innehielt und nie sein Ziel verfehlte. In seiner Nähe befanden sich seine ständigen Begleiter, die Raben Hugin, der Gedanke und Munin das Gedächtnis, die ihm täglich ins Ohr flüsterten, was sie auf der Welt gesehen oder gehört hatten, begleitet von den beiden Wölfen, dem heißhungrigen Freki und dem gierigen Geri. Hinter ihnen folgten seine Gemahlin Frigga, die Göttermutter, die alle Menschenschicksale kannte, mit den Wallküren, den Totenwählerinnen, angetan mit Schild, Speer, Helm und Brünne auf ihren feurigen Rossen. Sie waren die Gehilfinnen Wodans in jeder Schlacht. Ansonsten bewirteten sie die gefallenen Helden in Wallhall. Auf seinem Wagen, gezogen von zwei Böcken, jagte Thor oder Donar, der stärkste Gott und Sohn Wodans hinterher, um die Hüften seinen Kraftgürtel Megingjadar und in der erhobenen eisenbehandschuhten Faust den Hammer Mjöllnir, der nie sein Ziel verfehlte und nach jedem Wurf in die Hand Donars zurückkehrte. Das Rollen seines Wagens erzeugte den Donner und wenn er zornig war, schleuderte die Faust feurige Blitze auf die Erde. Zuständig für das Wetter, war er der eigentliche Fruchtbarkeitsgott der Bauern.
Zahlreiche Ungeheuer und Dämonen ergänzten das spukende Heer, wie Fenrir, der ungeheuere Wolf mit seinen Geschwistern, die Midgardschlange und die Todesgöttin Hel sowie Garm, der Höllenhund, der unter der Weltesche Yggdrasil als Wache lag und die ankommenden Toten mit lautem Gebell empfing. Riesen, Zwerge und andere Fabelwesen stürmten durcheinander. Nicht minder rauschend, aber deutlich würdevoller, schlossen die Nornen den Zug ab. Sie waren die Geisterwesen, welche die Runen bewachten und die Geschicke aller Menschen vorherbestimmten. Angetrieben wurde der Zug von Kári dem Wind, dem Sohn des Urzeitriesen Ymir, der von den Göttern erschlagen wurde und aus dessen Fleisch sie die Erde schufen, mit dessen Blut sie die Meere füllten und dessen Schädel den Himmel bildete.
Krankheit und Tod
„Großvater, habt ihr keinen Hunger? Soll ich Euch etwas zum Essen bringen, wenn Ihr schon nicht zu uns in die Stube kommt“,
riss Katharina den kranken alten Mann aus seinen Träumen. Der alte Steffelbauer musste sich erst wieder in der Wirklichkeit zurechtfinden. Immer wenn er seinen mystischen Gedanken nachhing, hatte er doch ein schlechtes Gewissen und so machte er auf die Bäuerin einen denkbar schlechten Eindruck.
„Jesus und Maria, Ihr schaut aber gar nicht gut aus. Fehlt Euch etwas, kann ich etwas für Euch tun?“
drängte sie ihn.
„Ich bin einfach nur müde,“
entgegnete er,
„schick mir doch den Bauern rüber.“
Mit einer solchen Bestimmtheit hatte der Austrägler schon lange nicht mehr mit ihr gesprochen. Sie beeilte sich ihren Mann zu holen.
„Hans, komm, dein Vater will dich sehen. Er liegt in seiner Kammer und schaut gar nicht gut aus. Er will auch nichts essen, deshalb mache ich ihm einstweilen einen stärkenden Trank.“
Während Hans aufstand und in seinen Holzschuhen zur Türe hinausschlurfte, holte Katharina aus dem Keller eine Flasche Kommunbier, die sie im warmen Wasser des Granl erwärmte. Anschließend füllte sie es in einen Tonkrug und verquirlte darin ein Ei und einen Löffel Zucker. Das würde dem alten Mann wieder neue Kraft geben.
Währenddessen erkundigte sich der Jungbauer bei seinem Vater:
„Seit ein paar Tagen ist mir schon aufgefallen, dass Ihr ganz ruhig und zurückgezogen seid! Seid’s krank, Vater?“
„Bub, müde bin ich und nicht nur weil ich schlafen will. Ich fühle, dass es mit mir zu Ende geht. Ich weiß den Hof bei dir in guten Händen und das macht mich stolz. Helfen kann ich alter Mann dir nicht mehr. Wenn ich weiter leben würde, wäre ich euch allen nur eine Last. Darum habe ich meinen Frieden mit der Welt gemacht und werde meiner Lisl in’s Paradies folgen. Sie wird mir schon ein gutes Quartier gemacht haben.“
Betroffen von der Deutlichkeit der Botschaft, die ihm sein Vater da vermittelte, verstummte Hans und wusste für den Moment nichts mehr zu sagen. Er war froh als seine Frau mit ihrem stärkenden Getränk in die Austragskammer kam. Gemeinsam flößten sie dem Großvater das warme Getränk ein.
„Wir reden morgen noch mal, schlaf gut, Vater,“
verabschiedete sich Hans. In der Stube, in der die restlichen Familienmitglieder um den großen Tisch saßen, verkündete der Bauer, dass der Großvater krank sei und im Sterben liege. Morgen würden sie den Pfarrer holen und ihn mit den Sterbesakramenten versehen lassen. Vorerst ginge die Arbeit normal weiter. Man würde sehen, wie sich die Situation entwickelte. Alles Notwendige würde veranlasst werden. Damit erhob er sich wieder, um seinen täglichen Kontrollgang um den Hof zu unternehmen. Die beiden Kinder Hansl und Seppl wurden ins Bett geschickt. Verunsichert durch den vom Vater in ernsten Worten angekündigten Sterbefall, fügten sie sich ihrem Schicksal ungewöhnlich widerspruchslos. Leise schlichen sie am Zimmer des Großvaters vorbei zur Stiege, wobei sie gern einen Blick auf den Sterbenden geworfen hätten. Andererseits hatten sie aber doch einen großen Respekt vor dem Tod und dem Unerklärlichen an der Situation.
Der Großvater fand, beruhigt durch das warme süße Bier, das ihm Katharina eingeflößt hatte, langsam zu seinem Schlaf. Als er ruhig atmete, verließ ihn seine Schwiegertochter, wobei sie sich aber vornahm, des Öfteren nach ihm zu schauen.
Gegen Mitternacht wurde der Kranke von einem einengenden, drückenden Gefühl in der Brust geweckt. Eine furchtbare Beklemmung ließ ihn zittern. Kalter Schweiß perlte auf der Stirn und lief über den Rücken. Er war unfähig aufzustehen oder zu schreien. Verzweifelt bemühte er sich, die aufsteigende Angst zu verdrängen, welche die zunehmende Atemnot hervorrief. Langsam wurde ihm bewusst, dass etwas eingetreten war, was er bisher nur vom Hörensagen kannte – die Drud saß auf ihm. Angestrengt versuchte er sich zu erinnern, was er von diesem Phänomen wusste. In den vielen Geschichten, die es über Druden gab, waren das immer unglückselige Personen, die einem besonderen Fluch unterlagen. Der zwang sie, von Zeit zu Zeit Menschen oder Tiere heimzusuchen. Dann waren sie halbgeistige, für normale Menschen nicht sichtbare, Wesen. Sie setzten sich auf die Brust eines Schlafenden und drückten, bis er keine Luft mehr bekam und nur noch stöhnte und röchelte. Druden, es konnten auch Männer sein, die dann Druderer hießen, waren Menschen, bei denen bei der Taufe etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Hauptsächlich waren es aber alte dürre Weiber mit schütterem Haar, die durch Schlüssellöcher oder Fensterritzen in Häuser eindrangen. Wer eine Drud bei ihrem schändlichen Tun erwischte, durfte sie nicht ansprechen oder beschreien, da er sonst deren Fluch auf sich ziehen konnte. Zur Abwehr empfahlen die Leute ein Messer mit der Schneide nach oben in die Türe zu stecken. Das sollte das Eindringen der Drud verhindern. Erprobte Gegenmittel waren auch mit dem rechten Fuß zuerst ins Bett zu steigen oder an der Türe, dem Bett und auf einem Zettel, den man sich unter das Kopfkissen legte, einen in einer Linie gezeichneten fünfzackigen Stern, den sogenannten Drudenfuß, anzubringen. Nichts von alldem hatte der alte Mann bisher nötig gehabt und vorbereitet. Krampfhaft versuchte er sich im Kopf einen imaginären Drudenfuß vorzustellen und so gut es ging mit den Fingern in der Luft nachzumalen. Nach einer ewig scheinenden Zeitspanne schien der Zauber zu wirken und die Beklemmung und Angstzustände ließen nach. Was blieb, war eine tiefe körperliche Müdigkeit und Erschöpfung.
Als Katharina am Morgen nach dem Alten sah, erschrak sie über dessen fahles Aussehen. Der wird nimmer, dachte sie für sich. Nachdem sie sich überzeugt hatte, dass sie momentan nichts tun konnte, ging sie wieder, um ihrem Mann, der als Bauer immer etwas später aufstand, zu berichten. Dann weckte sie Maria, die im Anschluss an den Morgenkaffee gleich nach dem Pfarrer oder dem Kooperator gehen sollte, um ihn zur Versehung zu bitten.
Der Pfarrer kam gegen zehn Uhr, eiligen Schrittes, mit der Stola angetan und dem Behälter mit dem heiligen Öl in der Hand. Ein Ministrant, den er eilig aus der Schule geholt hatte und der nun in einem weißen, spitzenbesetzten Überwurf steckte, hielt einen mannshohen Stab mit einer Laterne in seinen Händen. Er konnte kaum mit dem Geistlichen Schritt halten. Diese kleine Prozession war gleichzeitig die Information für Verwandte und Nachbarn, dass der Tod beim Steffelbauern zum Fenster hineinschaut oder dass er seinen Stock bereits an die Türe gelehnt hat. Wer konnte, machte sich eilig auf den Weg, um bei der Versehung, der letzten Ölung, dabei zu sein und den Sterbenden auf seinem letzten Weg zu begleiten.
Katharina hatte eine Truhe vom Dachboden in die Austragskammer bringen lassen und ein weißes besticktes Tuch darüber gebreitet. Darauf ordnete sie das Versehbesteck an, in der Mitte das alte mehrfach vererbte silberne Kreuz, rechts und links die passenden Kerzenleuchter mit geweihten weißen Kerzen und daneben den bronzeglänzenden Weihwasserkessel. Gerade hatte sie die Kerzen entzündet und reichlich Dreikönigsweihwasser in den Behälter gefüllt, als auch schon seine Hochwürden, der Pfarrer der Gemeinde und sein jugendlicher Begleiter mit einem lautstarken
„Gelobt sei Jesus Christus“
in die Kammer trat.
„In Ewigkeit Amen“
antworteten die Anwesenden. Dann stimmte der Priester ein
„Vater unser...“
an. Während die Gläubigen beteten, sah sich der Pfarrer den alten Steffelbauern nochmals an. Ja, dachte er bei sich, der hat seinen Frieden mit seinem Herrgott gemacht. Er war und ist ein guter Christ, so wie man das halt von einem einfachen Bauern erwarten kann. Fügt sich seinem Schicksal und geht ohne zu jammern, zu seinem Vater in den Himmel. Er ist ein wahrer Oberpfälzer, dem ein Leben ohne beständige Arbeit eine Last gewesen wäre. So ein Mensch arbeitet so lange er kann, bis die letzte Kraft aufgebraucht ist und dann legt er sich hin und bittet den Herrgott zum letzten Male in seinem Herzen Herberge zu nehmen und erwartet in stiller Ergebenheit die Erlösung. Im Schweiße seines Angesichts hat er sein Brot erworben und gegessen und so Gottes Gebot erfüllt. Der Pfarrer nahm sich vor, diesen Gedanken bei der Grabrede zu verwenden. Er hätte gerne noch einige Worte mit dem alten Mann gewechselt. Aber da dies nicht möglich war, sprach er laut und vernehmlich zu dem Sterbenden und zu denen, die mittlerweile die Stube füllten, das Gebet:
„O Gott, wir empfehlen dir die Seele deines Dieners und flehen zu dir, Herr Jesus Christus, Erlöser der Welt, dass du ihn in den Schoß der Patriarchen aufnehmen wollest, da du zu ihrem Heil aus voller Erbarmung vom Himmel auf die Erde herabgestiegen bist. Erkenne in ihm das Werk deiner Hände, das nicht von einem fremden Gott, sondern von dir, dem alleinigen, lebendigen und wahrhaftigen Gott, erschaffen worden ist; denn außer dir ist kein Gott und nichts ist deinen Werken gleich. Erfreue, o Herr, seine Seele mit deinem Angesicht und denk nicht an die Sünden seines verflossenen Lebens, nicht an die Gelüste seines Herzens, die böser Wahn und die Glut aufgeregter Begierden in seinem Innern entzündet haben. Hat er auch gesündigt, so hat er doch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nicht verleugnet, sondern den Glauben bewahrt, Eifer für die Ehre Gottes gehabt und Gott als den Schöpfer aller Dinge treu angebetet.“
Und dann wechselten sich Pfarrer und Volk in der Litanei ab:
„Herr, erbarme dich unser,
Christus, erbarme dich unser,
sei ihm gnädig,
erlöse ihn o Herr,
von allem Übel,
erlöse ihn o Herr,
von den Strafen der Hölle,
erlöse ihn o Herr,
von der Gewalt des bösen Feindes,
erlöse ihn o Herr,
durch deine Auferstehung,
erlöse ihn o Herr,
am Tage des Gerichts,
erlöse ihn o Herr.
Wir armen Sünder,
wir bitten dich erhöre uns,
dass du ihn verschonest,
wir bitten dich erhöre uns.
Herr erbarme dich unser
Christus erbarme dich unser
Herr erbarme dich unser.
Amen.“
Danach sprach der Priester die lateinischen Formeln für die Absolution und zeichnete mit dem in das heilige Öl getauchten Finger dem Sterbenden dreimal das Kreuzzeichen auf die Stirn. Mit einem
„Gott sei seiner Seele gnädig,“
verabschiedete sich der Pfarrer und ließ die Verwandten und Nachbarn wieder allein. Währenddessen hatte die Leichenbitterin, eine alte geschäftige Frau, ihren Platz am Kopfende des Bettes, noch vor der Familie, eingenommen, um als Vorbeterin zu fungieren. Sie stimmte der Gemeinde die Gebete an, die sich, soweit dies möglich war, um das Bett oder vor der Stubentür versammelt hatten. Der Platz direkt am Fußende blieb frei. Das war der Platz an dem der Gevatter Tod auf den Sterbenden wartete, um ihn dann am Bandl zu nehmen und ins Reich der Toten zu begleiten. Der Tod, den man sich als bleichgesichtigen alterslosen Mann im schwarzen Umhang, reitend auf einem klapprigen dürren Schimmel, vorstellte, griff niemals selbst in den Sterbevorgang ein. Seine Aufgabe war es lediglich, die arme Seele auf ihrem letzten Gang zu begleiten. Es wurde vermutet, dass ihn der Sterbende in den letzten Sekunden seines Lebens sehen konnte.
Der alte Steffelbauer merkte von all dem kaum etwas, zumindest nahm er es nicht mehr bewusst wahr. Katharina wischte ihm mit einem Tuch, das in eine Mischung aus Essig und Wasser getaucht war, von Zeit zu Zeit das Gesicht und den Hals ab und versuchte seine Lebensgeister wieder zu aktivieren. Während der Betpausen sprachen ihm die Umstehenden immer wieder Kraft und Trost zu. Geflissentlich vermieden sie dabei, den Sterbenden beim Namen zu nennen, um die Seele in ihrem Konflikt zwischen Gut und Böse oder Himmel und Hölle nicht zu beirren. Weihwasser, das man dem Sterbenden gab, aber auch in seinem Umkreis verspritzte, hielt die bösen Geister fern. Zusätzlich drückte man dem Sterbenden ein geweihtes Kreuz in die Hand. So vergingen fast zwei Stunden, in denen ihm die Anwesenden ihre volle Anteilnahme zukommen ließen, ihn aber auch genau beobachteten, um nicht den Moment des Todes zu verpassen. Irgendwann, noch kurz vor Mittag, tat der Steffelbauer dann seinen letzten Atemzug. Maria, die voll Trauer um ihren Großvater ganz nahe beim Bett stand, merkte es als Erste.
Mit tränenverschleierten Augen kniete sie nieder. Die Anwesenden folgten ihrem Beispiel. Ihre Mutter schloss dem Toten mit einer letzten zarten Geste die Augen, während Hans das Stubenfenster öffnete, um der Seele den freien Auszug zu ermöglichen. Da der Tod noch vor dem Mittag eingetreten war, hatte die Seele direkten Zugang in den Himmel, während sie am Nachmittag bis zum nächsten Morgen hätte warten müssen.
Frauen und Kinder jammerten durcheinander:
„Der Herr gib ihm die Ewige Ruhe und das Ewige Licht leuchte ihm“,
„Der Herr sei mit ihm“,
„Heilige Maria Muttergottes bitte für ihn“,
„Der Tod ist ein unvermeidlicher Gast, man braucht ihn nicht zu bitten, ihn hindert kein Schloss und kein Riegel“,
„Jetzt hat er es überstanden“,
„Sterben müssen wir alle.“
„Wo wird der Tod seinen Stecken als nächstes hinlehnen,“
mutmaßten die Nachbarn, während die Familienangehörigen ihren Tränen freien Lauf ließen.
Nach einem Vaterunser und der Allerheiligenlitanei, bei der die Anwesenden mit inbrünstigem
„bittet für ihn“,
die Seele allen Heiligen empfahl, löste sich die Versammlung mit letzten Weihwasserspritzern und dem Vorsatz auf, sich abends zur Totenwache wieder einzufinden. Bis dahin hatte die Leichenfrau mit den Familienmitgliedern einige Vorbereitungen zu erledigen. Im Hinausgehen und noch im Hof diskutierten kleine Grüppchen über die Vorzüge und Nachteile des Verstorbenen. Es ehrte die Familie, wenn ihn alle Nachbarn als pflichtbewussten und aufrichtigen Bauern und Nachbarn würdigten und wenn sie ihn lobten, weil er so leicht gestorben war. Verschiedene Vorzeichen wurden diskutiert, inwieweit sie den bevorstehenden Tod des Steffelbauern hätten voraussagen können, so zum Beispiel wegen einer stehen gebliebenen Uhr oder nächtlichen Geräuschen im Haus. Ziel der Spekulationen war es auch, wer ihm wohl als nächstes ins Reich des Todes folgen würde. Als dann das Sterbeglöcklein mit zweimaligem Läuten signalisierte, dass ein Mann gestorben war, lösten sich die Gruppen auf, um die Neuigkeit auch dem letzten Dorfbewohner mitzuteilen. Bei Frauen läutete das Sterbeglöcklein dreimal, weil, wie man sagte, die Frauen immer etwas extriges wollen und weil sie immer das letzte Wort haben müssen.
Im Haus begannen mittlerweile die Vorbereitungen für die Aufbahrung. Hans war schon unterwegs, um beim Schreiner ein etwa eineinhalb Meter langes, starkes Brett zu besorgen, sowie den Totengräber und den Pfarrer zu verständigen. Derweilen wuschen die Totenfrau und die weiblichen Familienangehörigen den Leichnam von Kopf bis Fuß mit einer Mischung aus Wasser und Branntwein, rasierten ihm die Stoppeln aus dem Gesicht und zogen ihm seine besten Sachen, das weiße Brauthemd und den schwarzen Hochzeitsanzug, an. Er sollte rein gewaschen und ordentlich gekleidet vor dem Gericht Gottes stehen, erklärte die Totengräberin der unsicher schauenden Maria, die der ungewohnten Verrichtung mit einer Mischung aus Furcht und Widerwillen begegnete. Trotzdem steckte sie einen der abgeschnittenen Fingernägel in die Schurztasche, da sie gehört hatte, dass der Nagel eines Toten gegen Zahnweh helfen könnte. Die restlichen Stücke warf sie in den Ofen.
Hans kam mit dem Totenbrett zurück. In der Stube stellte er zwei Stühle so gegeneinander, dass das Brett einen guten Halt fand. Ein kleiner Strohbund diente als Unterlage für den Kopf. Als Symbol für die abgelaufene Lebensuhr hielt er das Pendel im alten Uhrkasten an. Danach trugen er, der Knecht und die Frauen den Toten mit den Füßen voraus aus der Kammer und legten ihn auf das Brett, wieder mit den Füßen zur Türe, als Zeichen, dass der Großvater nicht mehr lange im Haus weilen würde. Die Hände wurden ihm auf der Brust gefaltet und mit einem Rosenkranz umschlungen. Der Strohbund hielt den Kopf hoch, damit der Tote zur Türe schauen konnte. Die Angehörigen prüften nochmals die exakte gerade Haltung des Körpers, damit der später auch bequem in den Sarg passte. Anschließend legten sie das große weiße Leichentuch über ihn. So würde der Tote nun mindestens zwei Tage im Hause aufgebahrt bleiben, bis man sicher sein konnte, dass er nicht nur scheintot war. Am Kopf des Verstorbenen stellte man als Schmuck die wenigen Blumentöpfe auf, die in dem Bauerhaus zu finden waren. Die Nachbarn würden am Abend, wenn sie zur Totenwache eintrafen, weitere Blattpflanzen mitbringen. Der kleine Weihwasserkessel mit einem kleinen Strohbüschel vervollständigte die Ausstattung.
Rasch ging Hans zurück in die Austragskammer, wo er schnell die Ersparnisse seines Vaters aus dem Strohsack holte und sicherstellte. Er war der Erbe des Hofes, die Geschwister waren ausgezahlt. Somit gehörte der Nachlass des Alten rechtmäßig ihm.
„Maria“,
rief die Mutter,
„hilf mir, wir müssen das Leichenbrot backen. Zur Totenwache und zur Leich kommen viele Menschen, die verköstigt werden müssen und wir wollen doch nicht als notleidende Leute dastehen. Komm, wir holen den Backtrog vom Boden.“
Maria folgte ihrer Mutter über die Stiege, um mit vereinten Kräften den aus einem mächtigen Eschenstamm geschlagenen schweren Backtrog in die Stube zu tragen. Dort lag zwar schon der Großvater, aber der Brotteig brauchte, wenn er schnell gehen sollte, Wärme und die gab es nur in der Stube. Wenn die ersten Nachbarn kamen, konnte man den Trog ja bis zum nächsten Morgen wegräumen. Aus der Speis holte Katharina den vom letzten Brotbacken übrig gelassenen Sauerteig und strich ihn in den Backtrog. Mit ein paar Spritzern Weihwasser bat sie für ein gutes Gelingen. Danach gab sie einige Handvoll angewärmtes Korn- oder Roggenmehl und warmes Wasser darüber und mischte das Dampfl, die Grundlage für den späteren Brotteig. Das Dampfl musste nun erst in der Wärme der Stube, später in der Speis bis zum nächsten Morgen gehen. Maria musste darauf achten, dass in der Zeit in der das Sauerteiglein gerichtet wurde, die Stubentüre nicht aufging, da das sonst dem Teig schaden könnte und das Brot später spindig würde. Der Bauer nahm vor der Geschäftigkeit der Weiberleute Reißaus und murmelte etwas von erledigen, Bier besorgen und überhaupt musste er auch auf dem Rathaus vorsprechen, wegen der Formalitäten. Die Frauen waren sicher, dass sie ihn so schnell nicht wieder sehen würden.
Mit einbrechender Dunkelheit fanden sich einige Frauen aus der Nachbarschaft ein, welche die erste Schicht der Totenwache übernehmen wollten. Später würden sich auch Männer dazugesellen, die etwa ab Mitternacht die Ablösung bildeten. Die Frauen gingen langsam und zaghaft zu dem Toten, um die am Kopfende brennende Kerze nicht zu verlöschen, das würde der armen Seele schaden. So hoben sie vorsichtig das Leichentuch vom Gesicht und gaben dem Toten etwas Weihwasser. Ein gemeinsames Gebet vor der Wache gab dem Toten die Ehre. Danach setzten sich die Frauen auf alle möglichen vorhandenen und zusammengetragenen Sitzgelegenheiten. Katharina legte noch vorhandenes Brot vom letzten Backtag auf den Tisch. Maria holte zwei Krüge Kommunbier aus dem Keller und übernahm es, die Becher und Gläser zu füllen. Sie würde an diesem Tag noch oft die schmalen und feuchtrutschigen Stufen in den dunklen Keller nehmen müssen um alle Gäste zu versorgen.
Katharina forderte die am Tisch sitzenden Frauen bereits zum dritten Mal auf, sich von dem Brot zu nehmen. Aber eine richtige Oberpfälzerin war zurückhaltend und beileibe nicht besitzergreifend. Man musste sie schon drängen. Sie wollte nicht den Eindruck erwecken auf das Brot angewiesen zu sein und wollte dem Gastgeber nicht zur Last fallen. So nahm Katharina nach dem üblichen Wortwechsel selbst einen frischen Laib in die Hand, zeichnete mit dem großen Brotmesser drei Kreuze darüber, bevor sie sorgfältig über den Tisch geneigt, Keil für Keil abschnitt und jeweils an eine der Anwesenden weiterreichte. Höflich dankte die Betreffende mit einem
„Vergelts´s Gott“
oder
„Es hätt`s nicht gebraucht“.
Trotzdem nahm eine Jede die Gabe dankbar an und würdigte das
„herzhafte“, „schmackhafte“
Brot, das so
„locker und gleichmäßig gelungen wäre“
als eine willkommene Brotzeit. Insgeheim freuten Sie sich aber auf den morgigen Tag, weil sie wussten, dass es dann extra für diesen Anlass frisches gewürztes Brot gab. Brot war für sie die Speise, die am höchsten in Ehren stand. Jesus Christus selbst hatte Brot gesegnet und an seine Jünger verteilt. So ähnlich passierte es heute auch.
Viele Geschichten und Bräuche rankten sich um das Brot. So mussten vor dem Anschneiden eines neuen Laibes immer drei Kreuzzeichen darüber gemacht werden, damit es der Herr segne und dass es ergiebig werde. Alle Brotbrösel wurden eingesammelt und für die armen Seelen in das Feuer des Ofens geworfen. Auf dem Tisch musste das Brot immer mit dem Anschnitt zum Herrgottswinkel gedreht sein. Es durfte nie auf der oberen Seite liegen, da sonst Glück und Segen aus dem Haus gehen würden. Wer das Brot über Nacht auf dem Tisch liegen ließ und nicht im Schub des Küchentisches verwahrte, musste mindestens mit starken Zahnschmerzen rechnen. Auf keinen Fall durfte man das Messer in das Brot stecken, da man sonst den armen Seelen wehtat. Das Brot hatte aber auch mystische Kraft. Jeder Wanderer oder Reisende hatte ein Stück Brot im Sack oder in der Tasche und das nicht nur um sich zu stärken. Wollte man aus einer Quelle trinken, so warf man erst drei Brotkrumen hinein, welche die Geisterkraft bannten und etwaiges Gift oder Verunreinigung herauszogen.
Entsprechend umsichtig und andächtig kauten deshalb die Frauen an ihren Brotbissen, bis der Teig gut mit Speichel durchsetzt, zu einer süßen angenehmen Masse wurde, zu der das kühle frische Bier einen herben wohlschmeckenden Gegensatz bildete.
Nachdem die Vorzüge und Eigenschaften des Verstorbenen in allen Einzelheiten ausreichend gewürdigt waren, wobei die Frauen bei jeder Nennung seines Namens nicht versäumten zu beteuern
„Unser Herrgott tröste ihn“,
begann eine der älteren Anwesenden die Gespräche in eine interessantere Richtung zu lenken.
„Der Tod eines Bauern“,
erzählte sie
„muss den Tieren auf dem Hof angesagt werden. In Neuenhammer wird das auch beim Sterben des Altbauern so gemacht. Da geht der Jungbauer zu allen Tieren und erzählt ihnen vom Tod ihres früheren Herrn. Man soll schon erlebt haben, das einzelne Tiere oder auch ganze Bienenvölker über den Tod ihres Herrn so erschrocken waren, dass sie verstarben, weil sie den Todestag ihres Herrn mit ihrer ehrgeizigen Emsigkeit entheiligt hatten.“
Katharina hörte den Hinweis und nahm sich vor, darüber mit dem Hans zu reden. Man konnte ja nicht wissen für was es gut war, wenn auch er den Tieren ansagen ginge. Lieber etwas mehr zu tun, als zu wenig.
„Was wird denn sein, nach dem Tode?“
war die Frage, die alle Anwesenden und alle Generationen vor ihnen schon gerne beantwortet gehabt hätten.
„Meine Mutter hat immer erzählt“,
begann eine würdige alte Dame mit silbergrauem Haar,
„die guten Seelen kommen, wenn sie von der Erde gegen den Sonnenaufgang aufsteigen, erst einmal in einen Vorhimmel. Der besteht aus einem blühenden Garten mit herrlichen Fruchtbäumen. Ähnlich dem Paradies darf niemand von den Früchten dieser Bäume kosten, sonst würde er zurück ins Fegefeuer geschickt. An der Türe zum Himmel steht St. Petrus und befragt jede einzelne Seele. Die erhält dann von unserem Herrgott Bescheid, in welche Abteilung des Himmels sie aufgenommen wird. Der Himmel selber ist ein noch viel größerer Garten mit vielen Abteilungen, welche durch große Bäume abgegrenzt sind. Da gibt es eigene Gärten für ungetaufte Kinderseelen, für getaufte Kinder, die in den ersten Tagen nach der Geburt schon verschieden sind, für Kinder bis zu sechs oder sieben Jahren, für uneheliche Kinder, für Kinder, die eine Braut am Tag ihrer Hochzeit, als sie den Jungfrauenkranz ins Haar steckte, schon unter dem Herzen trug, für Jungfrauen und für viele andere Gruppen. Die Geschlechter sind von einander getrennt. Aber selbst für Tiere, denen es auf der Erde durch Menschen recht übel erging, besteht eine eigene Abteilung. Denn Gott hat auch die Tiere lieb und vergilt ihnen was sie erleiden. Die Seligen kommen alle täglich zum gemeinsamen Mahle zusammen, wo es feinste Speisen und jeden Tag köstliche Braten gibt. Den Männern wird roter und weißer Wein und den Frauen süßer Met gereicht. Danach trifft man sich zu Spiel und Tanz“.
Bei der Vorstellung, dass Männer und Frauen im Himmel getrennt voneinander bleiben müssten, nickten die älteren Frauen verständnisvoll und erleichtert. Allein der Gedanke ohne die Plage und Last eines Ehemannes leben zu dürfen, hatte schon paradiesische Züge. Dann noch versorgt zu sein und keine Sorgen mit sich herumtragen zu müssen, musste einfach die Erlösung sein. Die jungen Frauen überlegten, ob es nicht doch etwas langweilig werden könnte ohne den Schabernack und die Unterhaltung durch die Burschen und Männer. Was wäre schon eine Rockenstube, wenn immer nur gearbeitet würde und nicht beizeiten die jungen Burschen vorbeischauten und mit ihren Späßen, Liedern und Geschichten für Abwechslung sorgten. Erst die Aussicht auf das gemeinsame Mahl aller Abteilungen und beider Geschlechter mit anschließendem Spiel und Tanz ließ sie den Himmel wieder uneingeschränkt erstrebenswert finden.
„Es ist aber manchmal nicht so einfach, vor allem für einen einfältigen Menschen, den richtigen Weg in den Himmel zu finden“,
berichtete eine zweite Frau.
„Da war einmal ein Bauer, der hatte in der Predigt vernommen, dass der Weg in den Himmel ein gerader sei. So machte er sich auf und ging fort über Berg und Tal, Wiesen und Felder, Wald und Wasser immer einen geraden Weg. Wo es nicht anders ging, stieg er sogar über Häuser hinweg. So gelangte er zu einer schönen Kirche und als er fragte wie sie hieße, gab man ihm zur Antwort „Himmelreich“. So wähnte er sich am Ziel und legte sich in seinem Paradies in eine Ecke, um für immer da zu bleiben. Die Mönche eines nahen Klosters waren nicht sehr begeistert aber gegen die gläubige Einfalt des Bauern kamen sie nicht an. Da er den ganzen Tag im Gebet verbrachte, versorgten sie ihn jeden Tag mit etwas Nahrung und er war zufrieden. An einem hohen Feiertag erhielt er bessere und reichliche Speisen. Da lud er unseren lieben Herrn, den er am Kreuze vor sich sah, ein, herabzusteigen und bei ihm Gast zu sein. Das reine Ansinnen fand seinen Lohn und der Heiland stieg vom Kreuz herunter, setzte sich zu ihm und teilte mit ihm das Mahl. Als Dank lud ihn der Herrgott zu sich in sein Himmelreich ein. Der Bauer lehnte aber ab, da er sich schon im Himmel wähnte. Worauf ihn unser Herrgott aufklärte. Der Bauer meldete den Vorgang dem Klosteroberen, worauf dieser bat, ihn mitzunehmen, wenn ihn unser Herr holen würde. So lud der Bauer den Herrgott nochmals zum Mahle und trug ihm die Bitte vor, die dann auch erhört wurde. Und als der nächste Sonntag kam und beide während der heiligen Messe vor dem Altare knieten, sanken sie um und zwei weiße Tauben stiegen zum Himmel auf.“
Nachdem sich mittlerweile auch einige junge Männer eingefunden hatten, meinte die Frau mit den silbergrauen Haaren, zur Warnung der oft übermütigen Burschen, auch etwas von der Hölle preisgeben zu müssen:
„Der Weg zur Hölle“
fuhr sie fort,
„geht ebenfalls durch einen großen Garten. Allerdings ist die Vorhölle nicht grün, sondern rotbraun gebrannt von der großen Hitze und den heißglühenden Füßen der Verdammten. Auf dieser Wiese wird gezecht und getanzt, umso närrischer, wenn ein Mädchen auf der Erde seine Unschuld verliert oder wenn ein uneheliches Kind auf die Welt kommt. Hinter dieser Wiese befindet sich die Hölle in drei Abteilungen. In der ersten sehen die armen Seelen wie die Marterwerkzeuge hergerichtet werden. In der zweiten bleiben sie stehen und müssen zuschauen, wie die anderen Verdammten gepeinigt werden. Im dritten Raum kommen sie dann selbst in das Martyrium und müssen die Höllenpein erleiden. Zum Beispiel werden sie in kochendem Öl gesotten und dann mit kaltem Wasser wieder abgekühlt. Sie leiden fürchterlichen Durst, während die klarsten Wasserbäche neben ihnen fließen. Nur die Teufel leiden keine Qual. Ihre Freude ist die Qual der Verdammten und die wird nur durch den Ärger getrübt, den sie empfinden, wenn sie auf der Welt ein Ehepaar in Treue und Frieden oder ein junges Mädchen in Unschuld lebend gefunden haben. Übrigens sind die Teufel sehr oft fort, vor allem an Feiertagen, um auf der Welt Menschenseelen zu fangen“.
Eine andere Frau hakte ein:
„In Pleystein haben sie erzählt, dass ein junger Bursche im Wirtshaus voller Übermut gerufen hat, dass ihn der Teufel holen solle, wenn es einen gibt. Auf dem Weg nach Hause ist er dann erfroren. Bei seinem Leichenbegängnis rissen dann Glockenstrang und Riegel, der Sarg brach und die Leiche fiel heraus.“
„Wisst ihr, dass der Teufel das Kartenspiel erfunden hat“,
fragte eine weitere Anwesende,
„als er nämlich nach dem Tode des Heilands vernahm, dass ein Buch unter dem Namen der Evangelien so viele Menschen zum Christentume bekehrte, verschaffte er es sich und las darin. Schließlich fand er das Buch sehr gefährlich und um ihm ein Gegenstück zu setzen, gab er den Menschen die Karten in die Hand und lehrte sie einige Spiele, wobei er sich anfangs immer zu einem Spieler hinstellte und ihm zu Gewinn verhalf. Weil ihm das gefiel und weil er die Menschen noch fester an sich binden wollte, benannte er noch jedes Kartenblatt mit Namen und lehrte einigen Menschen deren Bedeutung und wie sie daraus die Zukunft lesen könnten. Dann brachte der Teufel die Karten in die Wirtshäuser, wo zusätzlich berauschende Getränke ausgeschenkt werden. Und so kam es, dass wo früher die Familien am Herde und beim Kienlicht saßen und aus der heiligen Schrift lasen nunmehr die Hausväter in das Wirtshaus gehen und manchmal Haus und Hof verspielen.“
Sie machte damit eine Andeutung, dass um Mitternacht die Ablösung für die nächste Schicht der Totenwache erfolgte, die dann bis zum frühen Morgen dauerte. Diese Wache wurde von jungen Männer und Burschen gehalten, die sich unter anderem die Zeit mit Kartenspielen vertrieben. Pünktlich um Mitternacht erhoben sich die Anwesenden, Ruhe kehrte ein und mit vor der Brust gefalteten Händen begann die Vorbeterin:
„Lasst uns beten.
Wir empfehlen dir o Herr, die Seele deines Dieners, damit sie, da sie nun dieser Welt abgestorben ist, dir lebe, und du ihm die Sünden, die er aus menschlicher Schwachheit in seinem Lebenswandel begangen hat, nach deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit verzeihen wollest. Durch Christus unseren Herrn.“
Die restlichen Besucher fielen ein:
„Vater unser, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von allem Übel.
Amen.“
Danach verließen die Frauen die Stube. Zurück blieben die Männer, überwiegend junge Burschen aus der Nachbarschaft, die es sich zur Pflicht machten, die zweite Schicht der Totenwache bis in die frühen Morgenstunden zu übernehmen, unterstützt durch reichlich Freibier und vielleicht einigen Gläsern Branntwein. Dann waren da noch der Knecht Alois und der mittlerweile nach Hause gekommene Bauer sowie ein fremder, gut aussehender, junger Mann.
„Wen hast du denn mitgebracht, Vater?“
fragte Maria interessiert.
„Das ist der neue Lehrer, der unseren alten Hauptlehrer entlasten soll und den wir wahrscheinlich auch zum Gemeindeschreiber machen werden. Er heißt Joseph Königer und macht einen tüchtigen Eindruck“.
„Und du hast ihn gleich eingeladen, um ihn auf deine Seite zu ziehen“.
„Bist still“,
beendete Hans das Gespräch,
„es muss ja keiner hören.“
Maria warf von da an immer wieder einen Blick aus den Augenwinkeln zu dem neuen Lehrer. Es war das erste mal, dass sie so etwas wie Herzklopfen oder Beklemmung gegenüber einem jungen Mann verspürte. Joseph Königer hieß er, ein schöner Name und ein sauberer Bursche in seiner dunklen Hose und der schwarzen Joppe. Der kleine Stehkragen am Hemd legte sich frisch und reinlich um seinen schlanken Hals und machte keinen verdrückten oder abgewetzten Eindruck wie bei den meisten anderen Männern, die sie kannte.
„Maria, hol den jungen Leuten Bier, damit ihnen das Wachen leichter fällt“,
riss der Vater sie aus ihren Gedanken.
„Kannst gleich die Maßkrüge mitbringen, denn bei den kleinen Gläsern wirst du mit dem Nachschenken nicht fertig“
empfahl ihr ein besonders durstiger Gast, der sich schon lange auf reichliches Freibier freute. So musste Maria einige Zeit schleppen, bis der erste Durst gelöscht war und sie die vollen Krüge auf den Tisch stellen konnte. Die Burschen unterhielten sich bereits angeregt und auch der Lehrer diskutierte fleißig mit. Maria setzte sich einen Moment etwas abseits hin, um sich ein wenig auszuruhen. Darauf hatte der Sohn eines Nachbarn aber nur gewartet. Er machte sich immer einen Spaß daraus, Maria zu necken:
„Maria, fürchtest du dich eigentlich nicht vor dem Toten.“
„Warum sollte ich, es ist doch mein Großvater“,
antwortete die Angesprochene etwas erstaunt.
„Na, ja“,
bohrte der Bursch weiter,
„vielleicht ist er ja nur scheintot, und der Gevatter Tod wartet in der Stube bis er ihn mitnehmen kann und wir sehen ihn nur nicht. Gerade deshalb halten wir ja Wache und jetzt in der Geisterstunde kann allerhand passieren“.
„Du bist doch nicht ganz richtig im Kopf“,
konterte Maria forsch, war aber von den Worten doch etwas berührt.
„Ja, habt`s ihr denn keine Todesanzeichen bemerkt,“
fragte ein anderer,
„