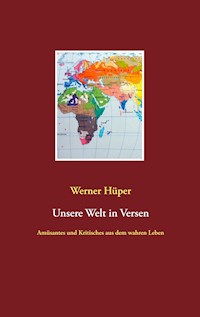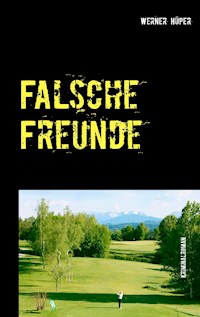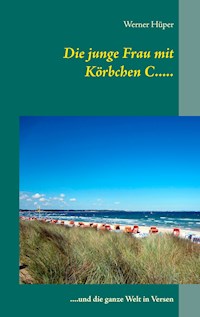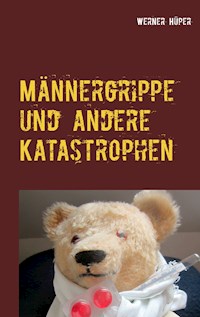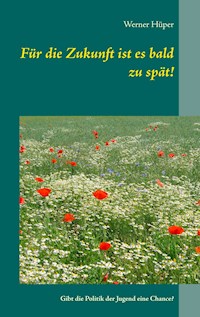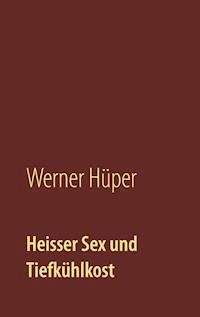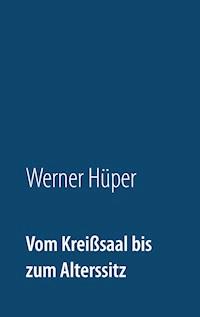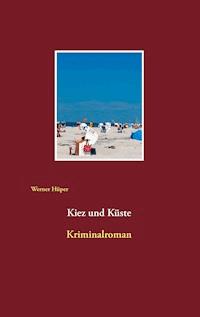
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hauptkommissar Maximilian Reischl, der im Roman „Falsche Freunde“ erfolgreich in der Golfszene ermittelt hatte, verbringt seinen Urlaub zusammen mit seiner Frau Theresa auf der Insel Amrum, wo sie Zeugen eines Verbrechens werden. Auch als „Urlauber“ zeigt er Interesse an den Ermittlungsarbeiten und gibt seinen Kollegen im hohen Norden den einen oder anderen Tipp. Alles deutet darauf hin, dass die Lösung dieses Falls im Rotlichtviertel von St. Pauli zu finden sein wird. Die Arbeit der Polizei erweist sich jedoch schwieriger als zunächst angenommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von Werner Hüper sind außerdem erschienen:
Die junge Frau mit Körbchen C ….
und die ganze Welt in Versen
ISBN: 9783734752872
*
Golf – Terrassengespräche
Berichte vom 19. Loch
ISBN: 9783734761454
*
Falsche Freunde
Kriminalroman
ISBN: 9783738616743
*
Vom Kreißsaal bis zum Alterssitz
Ein Leben in Versen
ISBN: 9783738646801
Zu den Genießern sicher zählt,
wer für den Urlaub Amrum wählt.
Und wer dies jemals schon erlebt,
nach einer Wiederholung strebt.
Dies ist gesünder als der Kiez,
es gibt dafür so manch‘ Indiz.
Auf dem Kiez gibt’s die Gefahr,
dass jeder Tag der letzte war!
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
1
Als Ermittler in Mordsachen war Hauptkommissar Maximilian Reischl von der Kripo Rosenheim überaus erfolgreich und deshalb weit über Rosenheim hinaus bekannt. Mitarbeiter und Kollegen schätzten ihn sehr, auch wenn der eine oder andere nicht verstehen konnte, wie konsequent Reischl an seinen Prinzipien festhielt, wenn es um seine Arbeit ging. Wer etwa seine Kompetenz in Zweifel zog, konnte sehr schnell erleben, wie der ansonsten ruhige und ausgeglichene Hauptkommissar aus der Haut fuhr. Das hatte ein ums andere Mal sein früherer Assistent Ludwig Grassinger erfahren. Der hatte es beispielsweise gewagt, bei von Reischl geführten Verhören Zwischenfragen zu stellen. „Maul halten, zuhören, lernen!“ wies Reischl den ungeduldigen, aber aus seiner Sicht offensichtlich für den Polizeidienst völlig ungeeigneten Grassinger bei derlei Gelegenheiten schon einmal zurecht. Reischl war jedenfalls heilfroh, als Grassinger endlich seine Prüfung zum Kommissar bestanden hatte - weiß der Himmel, wie ihm das gelungen war - und zur Kripo Passau versetzt wurde.
Beim letzten Fall, den Reischl aufzuklären hatte, ging es um einen Selbstmord, der sich jedoch später als Mord herausstellte. Erst mehrere Jahre nach dem vermeintlichen Suizid gab es Hinweise, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war. Reischl ermittelte und sorgte letztlich dafür, dass die angeblichen Freunde eines Golfplatzbesitzers für lange Jahre in den Knast wanderten. Sie hatten aus Habgier einen Mitarbeiter zum Mord angestiftet, was Reischl nach mühsamer Kleinarbeit hatte nachweisen können. Bei diesen Ermittlungen stand Reischl der Assistent Grassinger zur Seite. Das war die offizielle Version. Aus Reischls Sicht stand Grassinger ihm nicht zur Seite sondern eher im Wege. Aber das war nun vorbei, und Reischl hoffte auf entspannte Zeiten im Dienst. Deshalb war er auch über die Nachfolgerin an seiner Seite sehr erfreut. Es handelte sich nämlich um eine junge, außerordentlich intelligente und darüber hinaus auch noch sehr hübsche junge Dame.
Hauptkommissar Reischl war eine imposante Erscheinung. Bei einer Körpergröße von 1,90 m und einem durch regelmäßigen Sport gestählten Körper konnte er trotz seiner inzwischen 55 Lebensjahre manch jüngeren Kollegen in den Schatten stellen. Sein Schnauzer, der perfekt zu seinem bayrischen Outfit passte, ließ eine gewisse Gutmütigkeit vermuten. Sich auf diesen Wesenszug zu verlassen war jedoch ein Fehler. Reischl konnte zwar außerordentlich nett und freundlich sein, im Dienst jedoch war er kompromisslos. Es gab sogar Kollegen in der Polizeidirektion Rosenheim, die ihn hinter vorgehaltener Hand aus irgendeiner Verärgerung heraus „Stinkstiefel“ nannten. Wer ihn besser kannte, hielt diese Verunglimpfung für ungerecht und unfair.
Was die Kollegen im Präsidium nicht wussten oder nur ahnen konnten: Auch im Privatleben Reischls gab es Gewohnheiten, von denen er nur ungern abwich. Bei dem erwähnten Fall des vorgetäuschten Selbstmords wäre es beinahe dazu gekommen, dass er seinen liebgewonnenen Urlaub in Südtirol, den er regelmäßig im Frühjahr anzutreten pflegte, hätte verschieben müssen. Diese Konsequenz blieb ihm jedoch damals erspart, weil es wirklich keine überzeugenden Anhaltspunkte für eine Straftat gab. Dass sich der Sachverhalt Jahre später anders darstellte und er die Ungereimtheiten bei dem Fall nicht rechtzeitig erkannt hatte, wurmte ihn gewaltig. Er hatte sich deshalb vorgenommen, zukünftig noch sorgfältiger bei seiner Arbeit vorzugehen und dem Zufall keine Chance einzuräumen.
Seit vielen Jahren war Maximilian Reischl mit Theresa verheiratet. Sie kannten sich schon seit der Schulzeit. Resi, wie er sie von Anfang an nannte, hatte auch das Ignaz-Guenther-Gymnasium in Rosenheim besucht, allerdings 2 Klassen unter ihm. Während seiner Ausbildung, die zunächst am Studienort Sulzbach-Rosenberg und später im Verlauf der fachpraktischen Ausbildung in Fürstenfeldbruck und München stattfand, hatten sie sich aus den Augen verloren.
Erst später, als er am Standort Rosenheim seine Polizeikarriere im aktiven Dienst begann, liefen sie sich wieder über den Weg. Maximilian fand, dass aus ihr eine attraktive Frau geworden war, um die es sich zu kämpfen lohnte. Resi war tatsächlich ein fesches bayrisches Madl, das mit ihrer „Dirndl-Figur“ die Männer nervös werden ließ. Ihr charmantes Lächeln tat ein Übriges, Maximilian war nicht der einzige Bewerber. Resi allerdings war sich ihrer Wirkung auf die Männerwelt gar nicht immer bewusst, weil sie wegen der nach ihrer Meinung zu geringen Körpergröße voller Komplexe war. Mit ihren 1,60 m fühlte sie sich gegenüber ihren Freundinnen oft benachteiligt. Dass sich ausgerechnet der stattliche Polizist Maximilian Reischl um sie bemühte, schmeichelte ihr sehr. Deshalb gab sie nur zu gern seinen Avancen nach, mit der Folge, dass die beiden schon bald eine prachtvolle Hochzeit feierten.
In den ersten Jahren ihrer Ehe war das Hotel „Plunhof“ in Ridnaun immer wieder ein beliebtes Urlaubsziel für sie, wo sie regelmäßig ihren Ski-Urlaub verbrachten. Zu den Besitzern, der Familie Volgger, hatte sich mittlerweile eine freundschaftliche Beziehung entwickelt.
Nach einem Skiunfall hatte Theresa keine Freude mehr am Wintersport. Reischl entschloss sich deshalb schweren Herzens, seiner Frau zuliebe ebenfalls darauf zu verzichten und die Gewohnheiten in Sachen Urlaub zu ändern. Ab diesem Zeitpunkt verbrachten sie jedes Jahr im Frühjahr eine Woche in Bozen, wo sie für Leib, Seele und Gaumen beste Rahmenbedingungen vorfanden. Im Spätsommer ging es dann wenn irgend möglich für zwei Wochen in die Toskana. In Montaione, in der Provinz Florenz, hatten sie sich in eine Ferienwohnung namens „San Gimignano“ verliebt, die sich auf dem „Gut Ghizzolo“ befand und aus ihrer Sicht geradezu der ideale Ort für einen erholsamen Toskana-Urlaub war. Hier fühlten sie sich von Anfang an heimisch und waren jedes Jahr wieder von der herrlichen Landschaft und dem traumhaften Ambiente dieser Ferienanlage begeistert. Auch wenn sie die meiste Zeit ihre großzügige Terrasse mit phantastischem Blick über die beeindruckende Landschaft genossen, die Ausflugsziele in der Nähe wie Siena, Volterra oder auch Livorno boten ihnen willkommene Abwechslung. Ein Urlaub jedenfalls, auf den sie sich regelmäßig schon lange vorher voller Ungeduld freuten. Sie verwendeten keinen Gedanken daran, irgendwann einmal einen Urlaub außerhalb Italiens zu verbringen.
Eines Tages jedoch hatte das Ehepaar Reischl eine Nachricht zu verarbeiten, die Vorfreude und Vorbereitung auf den nächsten Urlaub nachhaltig beeinträchtigte.
Zunächst muss man wissen, dass bei etwa 20 % der Bevölkerung Jodmangel eine Vergrößerung der Schilddrüse, auch „Struma“ oder „Kropf“ genannt, bewirkt. Frauen sind davon etwa viermal häufiger betroffen als Männer. Meistens entwickelt sich eine Struma zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr.
Im alpenländischen Raum, der zu den jodarmen Gebieten Deutschlands zählt, beklagen besonders viele Frauen diese Schilddrüsenfehlfunktion. Leider war auch Theresa, die Ehefrau des Hauptkommissars Maximilian Reischl, davon betroffen, ein Umstand, der sich auf die Urlaubsplanung der beiden in unangenehmer Weise auswirken sollte.
Um eine leidige Nebenwirkung der erwähnten Krankheit zu kaschieren, hatten die einfallsreichen Bayern das Kropfband erfunden, das früher so manchen Frauenhals schmückte. Auch heute noch ist dieses Accessoire unverzichtbarer Bestandteil einer typischen bayrischen Tracht.
Bei den Veranstaltungen in der Region, wie der Kirmes in Rosenheim oder gar dem Oktoberfest in München, konnte Theresa Reischl nun mittels eines derartigen Kropfbandes leicht von den Auswirkungen dieser Krankheit ablenken. Leider stellten sich bei ihr mit der Zeit Symptome ein, die Anlass für einen Arztbesuch waren. Die Beschwerden hatten nämlich zugenommen. Der konsultierte Arzt in Rosenheim wies mit Nachdruck darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf bestünde. Bevor er aber eine OP empfehlen würde, wäre es aus seiner Sicht angeraten, wegen des akuten Jodmangels einen längeren Aufenthalt an der Nordsee in Betracht zu ziehen, der sich sicher positiv auf die Funktion der Schilddrüse auswirken würde.
Für einen Bayern kommt die Vorstellung, zum Zweck des Urlaubs den „Weißwurstäquator“ in Richtung Norden überqueren zu müssen, einem Verstoß gegen die Menschenrechte gleich. Besonders Theresa, die den Kreis Rosenheim als ihren eigentlichen - und völlig ausreichenden - Lebensraum ansah und allenfalls anlässlich der „Wiesn“ „auf Minga“ (München – manchmal braucht es eben in Bayern Untertitel!) zu fahren bereit war, konnte sich einen Urlaub im hohen Norden überhaupt nicht vorstellen. An Südtirol und die Toskana hatte sie sich im Laufe der Jahre gewöhnt, aber Urlaub bei „die Preißn“? Niemals!
Maximilian Reischl musste seine ganze Argumentationskunst aufwenden, um Resi zu bewegen, eine derartige Reise wenigstens in Erwägung zu ziehen. Erst der Hinweis, dass die Alternative wohl eine Operation wäre, veranlasste sie, einmal darüber nachzudenken. Hilfreich bei der Überzeugungsarbeit Reischls war der Umstand, dass Theresas Freundin Gertrud, genannt Gerti, mit einem Hamburger verheiratet war. Dieser Hamburger war vor einigen Jahren aus beruflichen Gründen nach Rosenheim gekommen und hatte sich dem bayerischen Lebensstil weitgehend angepasst, so dass er im Freundeskreis von Gerti – wenn auch äußerst zurückhaltend – anerkannt worden war. Nachdem Gerti nun von der Freundin erfahren hatte, dass es auf ärztliche Empfehlung in den Norden gehen sollte, redete sie ihrer Freundin gut zu:
„Du sollst an die Nordsee fahren? Super! Wie du weißt, war ich mit Jens im letzten Jahr auf Amrum. Ein toller Urlaub. Da müsst ihr unbedingt hin!“
Gemeinsam mit den Männern wurde diskutiert, recherchiert, geplant und schließlich gebucht. Irgendwann war es perfekt: Das Ehepaar Reischl würde den nächsten Urlaub auf der Insel Amrum verbringen. Klar, dass die Reischls der Empfehlung der Freunde folgten und für ihren 3-wöchigen Erholungsurlaub - ein kürzerer Aufenthalt würde aus Sicht des Arztes keinen Sinn machen - eine Ferienwohnung in der Pension Flor in Norddorf buchten, in der man sich „sauwohl fühlen“ könne. So waren jedenfalls die Worte von Gerti. Natürlich gab es eine ganze Reihe von Tipps, was man auf der Insel besichtigen und erleben müsse. Dazu gehöre unbedingt auch das Restaurant im „Gasthaus zum Pharisäer“ in Norddorf, einem reetgedeckten Haus mit sehr guter Küche und einem gemütlichen, landestypischen Ambiente.
***
2
Das „Gasthaus zum Pharisäer“ in Norddorf verfügt über eine lange, bewegte Vergangenheit. Ein besonders dunkles Kapitel dieser Geschichte bleibt den Insulanern sicher noch lange im Gedächtnis. Das Haus, das nicht nur wegen seiner hervorragenden Küche sondern auch wegen der altertümlichen Raumausstattung über die Region hinaus hohes Ansehen genoss, brannte eines Tages bis auf die Grundmauern nieder.
Gäste und Einheimische waren sehr betroffen und empfanden tiefes Mitgefühl mit Silke und Nils Hansen, den Besitzern des Gasthauses.
Das „Gasthaus zum Pharisäer“ war schon immer Treffpunkt für ganz Amrum. Es gab Frühschoppen, Dämmerschoppen, Spätschoppen - zu früheren Zeiten war das „Gasthaus zum Pharisäer“ mehr Kneipe als Restaurant. 1973 wurde Vater Hansen unheilbar krank, aber er fand in Sohn Nils und Schwiegertochter Silke würdige Nachfolger. Beide haben das Haus im Sinne der Vorgänger weitergeführt und den guten Ruf gefestigt.
Als Brandursache stellten die Sachverständigen Funkenflug fest, der durch Dacharbeiten in der Nachbarschaft entstanden war. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich rasend schnell ausbreitete, erst löschen, als nur noch eine qualmende Ruine übrig geblieben war. Erfreulicherweise hatte der Vertreter der Provinz-Assekuranz, Kiel, ein gewisser Frieder Klasen, den Versicherungsfall beschleunigt bearbeiten lassen. Klasen, der in Wittdün am Hafen sein Versicherungsbüro hatte, spielte mit Nils Hansen und Hinnerk Petersen, dem Leiter der Polizeistation in Nebel, in den Wintermonaten regelmäßig Skat. Da war es ja wohl selbstverständlich, dass man dem Freund und Skatbruder in einer so schwierigen Situation hilfreich zur Seite stand.
So kam es, dass nur wenige Wochen nach dem Brand nicht nur die Ermittlungen der Polizei eingestellt wurden, auch die Schadensübernahme durch die Versicherung wurde äußerst kulant geregelt. Diesem Umstand war es zu verdanken, dass der Wiederaufbau nur sechs Monate nach dem verheerenden Feuer abgeschlossen werden konnte. Hotelbetrieb und Restaurant standen für die nächste Saison wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Bei der Wiedereröffnung im nächsten Frühjahr war die gesamte Amrumer Prominenz auf den Beinen, um das neue Gasthaus im Friesenstil zu bewundern und diesen besonderen Anlass zu feiern. Tatsächlich staunten viele Gäste über das, was sie sahen: Bemerkenswert viele Raritäten, die das alte Gasthaus geschmückt hatten, wie alte Schiffsmodelle, antike Uhren, eine große Zahl alter friesischer Kacheln und dergleichen mehr, waren nun auch im Neubau wieder zu bewundern. Dabei waren doch all diese wertvollen Einzelstücke den Flammen zu Opfer gefallen. Jedenfalls stand dies so im Bericht der Polizei und im Protokoll für die Versicherung. Die Familie Hansen hatte offensichtlich ein Mordsglück gehabt. Niemand traute sich, die bei der Eröffnungsfeier öfter mal hinter vorgehaltener Hand geäußerte Vermutung, „Da hat wohl jemand den Brand geahnt“, offen auszusprechen. Schließlich war man zu Gast bei den Hansens und es war ja auch alles gut gegangen. Außerdem wollte hier auf der Insel niemand Ärger haben.
***
3
Theresa Reischl war aufgeregt. Bis zum Start in den Urlaub waren es nur noch vier Tage. Sie hatte schon die Checkliste, die sie am letzten Wochenende mit ihrem Mann erstellt hatte, abgearbeitet. Auf gar keinen Fall wollte sie irgendetwas vergessen, wenn sie schon in den hohen Norden fuhren, in eine für sie völlig unbekannte Gegend. Noch dazu auf eine Insel!
Man konnte ja nicht sicher sein, wie die Versorgungslage auf einer solchen Nordseeinsel war. Deshalb hatte sie sicherheitshalber - unabhängig von der Checkliste - auch die eine oder andere Konserve mit bayrischen Lebensmitteln bereitgestellt, die es dort sicher nicht geben würde und auf die man nicht gerne verzichtete.
Als Maximilian Reischl vom Dienst heimkam, staunte er nicht schlecht über die „Vorratshaltung“ seiner Frau.
„Resi, auf Amrum gibt es inzwischen elektrischen Strom und Telefon“, kommentierte er amüsiert die Reisevorbereitungen seiner Frau. „Du musst nicht befürchten, dass wir eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen. Die Lebensmittel bleiben hier!“
Für die Befürchtungen seiner Frau hatte Reischl wenig Verständnis, zumal sie durch ihre Freunde über die Verhältnisse auf Amrum genauestens informiert worden waren.
Für die Anreise hatten ihre Freunde ihnen geraten, nicht etwa die ganze Strecke von Rosenheim bis zum Fährhafen Dagebüll in einem Stück zu fahren. Es galt immerhin über 1.000 Kilometer zurückzulegen. Da war es allemal besser, mindestens einmal unterwegs zu übernachten.
„Wenn ihr die Reise genießen und auch etwas von Deutschland sehen wollt, solltet ihr durch die Lüneburger Heide fahren. In der Zeit eurer Anreise wird sicher die Heide blühen – ein einmaliger Anblick, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.“ Jens wollte als Hamburger seinen bayrischen Freunden natürlich vermitteln, dass es nicht nur in Bayern schön ist.
„Außerdem kann ich euch in der Lüneburger Heide ein tolles Hotel empfehlen, wo ihr euch sehr wohl fühlen würdet. Dort gibt es übrigens einen äußerst leckeren Braten von der Heidschnucke“, ergänzte Jens.
„Heidschnucke? Was ist das denn?“, wollte Resi wissen.
Jens klärte sie auf: „Das sind Schafe, die überwiegend in der Lüneburger Heide vorkommen und deren Fleisch einen wildartigen Geschmack hat. Wenn es gut zubereitet wird, ist das eine Delikatesse. Und die könnt ihr in ‚Niemeyers Romantik Post Hotel‘ in Müden an der Örtze genießen.“
Resi schaute skeptisch und stellte dann fest: „Fleisch vom Schaf? Esse ich sicher nicht! Maximilian, du weißt genau, wie schrecklich der Lammbraten geschmeckt hat, den wir vor einiger Zeit im ‚Gasthof Huber‘ in Obernburg bei Ebersberg gegessen haben. Nie wieder!“
Gerti konterte: „Ach, du immer mit deinen Vorurteilen. Wenn die beim Huberwirt keine Ahnung von der Zubereitung eines Lamms haben, kannst du das nicht einfach auf andere Restaurants übertragen. Jens hat recht, die Fahrt nach Müden lohnt sich.“
Jetzt schaltete sich Maximilian ein: „Wo liegt denn dieses Müden, zeigt mir das mal auf der Karte.“
Der ADAC - Autoatlas wurde aufgeklappt und gemeinsam wurde die mögliche Route angeschaut.
„Das passt“, meinte Maximilian, „dann könnten wir am nächsten Tag noch einen Abstecher nach Hamburg machen, da wollte ich schon immer einmal hin. Was meinst du, Resi?“
„Meinetwegen“. Nach Begeisterung klang das nicht, aber sie war ja gewohnt, dass Maximilian entschied, wo es lang zu gehen hatte. Sie gehörte nicht zu den Frauen, die in einer Ehe mit einem beruflich erfolgreichen Mann die Hosen an hatte. Die Zurückhaltung ihrerseits hatte sich über viele Jahre hinweg bewährt. Insgeheim war sie ja ganz froh, dass Maximilian meistens die Initiative ergriff.
Jens war natürlich als gebürtiger Hamburger von der Idee der Freunde, auf der Hinreise Hamburg zu besuchen, begeistert. Er hatte sogleich eine Reihe von Sightseeing-Vorschlägen bereit. Die waren aber kaum an einem Tag unterzubringen, schon gar nicht, wenn man am Tag des Besuchs in Hamburg noch die letzte Fähre von Dagebüll nach Amrum erreichen wollte. Die legte nämlich um 17:25 Uhr ab, was ja kaum zu schaffen wäre. Lediglich freitags gab es noch eine spätere Fährgelegenheit, die aber nicht in Betracht gezogen wurde, weil man dem Wochenendverkehr auszuweichen gedachte. Deshalb wurde eine weitere Übernachtung eingeplant. Die Wahl fiel auf Husum, der „Grauen Stadt am Meer“, wie Theodor Storm sie 1852 in einem seiner Gedichte genannt hatte.
Entsprechend der Empfehlung ihrer Freunde wurden nun die Hotels für die Anreise und ein Platz auf der Fähre von Dagebüll nach Wittdün gebucht. Selbst an den Strandkorb hatten sie gedacht, den sie für die Zeit ihres Aufenthalts beim Strandkorbverleih Fiete Martens in Norddorf hatten reservieren lassen. Es war alles bestens vorbereitet für den „Gesundheitsurlaub“ auf der Insel.
Am Abend vor der Abreise war Resi Reischl besonders nervös. Eine so weite Reise nach Norden war ihr nun doch nicht ganz geheuer. Da war ihr Italien, das ja quasi „vor der Haustür“ lag, doch sehr viel vertrauter. Auch war sie sehr unsicher, wie sie wohl mit den Menschen im Norden zurechtkommen würde. Sie kannte zwar einige „Preißn“, die in Bayern lebten, aber das waren Einzelfälle, wie eben auch Jens, der Mann ihrer besten Freundin Gerti. Den „Fischköpfen“, wie die Küstenbewohner in Bayern häufig genannt wurden, sagt man ja eine gewisse Sturheit und Verschlossenheit nach, Wesenszüge, die den Bayern nach eigener Einschätzung völlig fremd sind. Resis ganze Hoffnung, dass bei dieser Reise alles gut gehen würde, ruhte auf ihrem Mann, der es gewohnt war, mit allen erdenklichen Situationen und Schwierigkeiten fertig zu werden.
***
4
„Zum Goldbarren“, so hieß eine der bekanntesten Kneipen auf dem Kiez in Hamburg - St. Pauli. Hier verkehrte ein bunt gemischtes Publikum. Neugierige Touristen, die sich unter Hamburger Partygänger mischten, waren ebenso vertreten wie seriöse Geschäftsleute und Hamburger Promis. Aber auch schillernde Gestalten der Hamburger Unter- und Halbwelt schätzten dieses Traditionslokal. An manchen Abenden waren hier Herrschaften vertreten, die zusammen etliche Jahre Knast repräsentierten. Gleichwohl ging es meistens einigermaßen gesittet zu. Dafür sorgte der strenge Wirt, Paul Bruhns, der die Kneipe im Lauf mehrerer Jahrzehnte zu einer Kultstätte auf St. Pauli gemacht hatte.
Unerklärlich war für die Stammgäste, wie Paule - so nannten ihn seine Freunde - es immer wieder fertigbrachte, die hübschesten Bedienungen zu engagieren. Paule achtete sehr darauf, dass die Mädchen nicht nur gut aussahen, sie mussten auch bereit sein, mit Kleidung äußerst sparsam umzugehen. Paule wusste genau, dass leicht bekleidete, gut gebaute Damen besonders anziehend auf seine vorwiegend männlichen Gäste wirkten. So war es nicht verwunderlich, dass seine Bude jeden Abend gerammelt voll war.
Eine „Bedienung“, die das Konzept von Paule gut verstanden hatte, war Wiebke Jansen, die seit einiger Zeit zu den Stammkräften im „Goldbarren“ zählte. In ihrem früheren Job war sie auf der Insel Amrum im „Gasthaus zum Pharisäer“ tätig, wo sie als Servicekraft den Vorzug einer Ganzjahresanstellung genoss. Die Wirtsleute Silke und Nils Hansen hatten ihr wegen ihrer Zuverlässigkeit und ihres Engagements sogar eine Personalwohnung zur Verfügung gestellt. Wiebke fühlte sich sehr wohl auf der Insel und wäre wohl nie nach Hamburg gegangen, wenn da nicht die Sache mit dem Feuer passiert wäre. Die Wirtsleute hatten plötzlich kein Gasthaus mehr und deshalb auch weder Job noch Wohnung für sie. Auch wenn sie bis zum Saisonende weiter bezahlt wurde, sie musste sehen, wie es weitergehen würde.
Seit der Schulzeit hielt Wiebke immer Kontakt zu ihrer besten Freundin Anna Schöne, die auch im Gastgewerbe tätig war, und zwar im „Goldbarren“ auf St. Pauli. Anna hatte schon öfter von den dortigen Arbeitsbedingungen und den außergewöhnlichen Verdienstmöglichkeiten geschwärmt. In ihrer Kneipe verkehre ein tolles Publikum, unter dem sehr häufig auch großzügige Herren waren, die für ein wenig „Zuwendung“, wie sie es nannte, kräftig zu zahlen bereit waren.
Anna reagierte auf den Anruf von Wiebke hoch erfreut. „Natürlich frage ich meinen Chef, ob du bei uns arbeiten kannst. Er wird dich nur vorher sehen wollen! Und wegen eines Zimmers mach dir keine Sorgen, du kannst zunächst bei mir einziehen, bis du eine für dich geeignete Bleibe gefunden hast.“
Und so kam es.
Wiebke stellte sich bei Paul Bruhns vor, der von ihrer Erscheinung sehr beeindruckt war. Sie hatte sich für das Vorstellungsgespräch sehr zurückhaltend gekleidet, eben „hanseatisch“. Gewählt hatte sie ein dunkelblaues Kostüm, dessen Rock züchtig die Knie bedeckte. Unter der Kostümjacke verlieh ihr eine hochgeschlossene Bluse ein außerordentlich seriöses Aussehen. Auf auffälligen Schmuck hatte sie verzichtet. Geschminkt war sie ebenfalls sehr dezent.
Das alles konnte Paul Bruhns nicht täuschen. Ihm war sofort aufgefallen, dass die konservative Kleidung Schätze verhüllte, die es zu heben galt. Die Frau hatte eine umwerfende Figur. Wegen ihrer phantastischen Oberweite trug sie die knapp geschnittene Kostümjacke offen. Allein dieser Anblick hätte ihn schon überzeugt.
Nur selten hatte er ein so attraktives Mädchen getroffen, das zugleich in der Gastronomie gelernt hatte. Häufig hatte er zugunsten des Aussehens auf die Qualifikation als Servicekraft oder Bardame verzichtet und viel Mühe auf sich genommen, um die „Schönheiten“ auszubilden. Die Prioritäten sahen bei ihm nun einmal anders aus als in einem normalen Gastronomiebetrieb. Er brauchte Mitarbeiterinnen mit einer sexy Ausstrahlung, die es mit den Moralbegriffen nicht allzu genau nahmen. Man war schließlich auf dem Kiez.
Mit Wiebke stand nun eine junge Frau vor ihm, die beides, Attraktivität und Qualifikation in idealer Weise verkörperte. Wiebke beeindruckte ihn wirklich: Naturblonde lange Haare, fast 1,80 Meter groß und eine Figur, bei der man schwach werden konnte. Mit Frauen, die die Ideale der Modebranche bedienten und in gewisser Weise unterernährt waren, konnte er überhaupt nichts anfangen. Bei ihm mussten Frauen wie Frauen aussehen, d.h. sie sollten ordentlich „etwas in der Bluse haben“ und auch ansonsten sehr weiblich geformt sein. Wiebke entsprach genau seinen Vorstellungen. Da passte alles. Sie beeindruckte ihn nicht nur mit ihrer Oberweite, auch ihr Hinterteil war eine Sensation. Diese Frau musste er einfach für sein Etablissement gewinnen.
„Wenn du“ - man hielt sich hier nicht lange mit dem „Sie“ auf - „dich mit dem Dresscode unseres Hauses anfreunden kannst, bist du dabei“, schlug er ihr vor.
„Was bedeutet das?“ fragte Wiebke, die von ihrer Freundin ja schon einiges über die „Arbeitsbedingungen“ im „Goldbarren“ erfahren hatte.