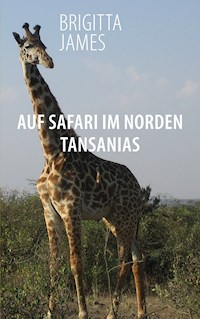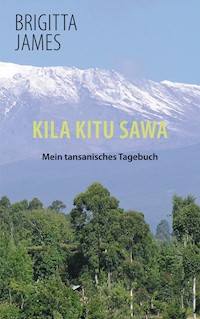
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Durch die Heirat mit einem Tansanier lebt die Autorin in Arusha, in Tansania. Ihr Buch ist ein Erfahrungsbericht über das Leben dort. Der Schwerpunkt am Beginn des Buches liegt bei ihrer afrikanischen Hochzeit. In anderen Tagebucheinträgen beschreibt sie, was ihr in dieser fremden Kultur begegnet und was sie beschäftigt. Mit dem Blick einer Noch-Außenstehenden beobachtet Mrs. James die neue Kultur und versucht heimisch zu werden. "In den Monaten, in denen ich hier lebe, merke ich, dass vieles von dem, was in Reiseführern beschrieben ist, so nicht stimmt und viel zu pauschalisiert ist. Das Land und seine Menschen sind facettenreich und differenziert zu betrachten. Ich habe nicht den Anspruch, die Wahrheit über ein ganzes, dazu noch sehr großes Land und deren Leute zu verkündigen, möchte aber mit meinen ganz persönlichen Erlebnissen einen Einblick in mein tansanisches Leben gewähren, welches nicht das Leben der Weißen Massai ist, sondern das einer tansanischen Mittelstandsfamilie." Die Autorin schreibt für Leser, die sich für das alltägliche Leben in Tansania interessieren, sich auf einen längeren Aufenthalt oder Reise dorthin vorbereiten, oder nach einer Reise mehr über den Alltag wissen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin:
Das Bremer Stadtwappen zeigt „die Schlüssel zum Tor der Welt“ und wirbt für die Weltoffenheit der Bremerinnen und Bremer.
Auf Brigitta James, geboren 1959, trifft das auf jeden Fall zu.
Nach dem Studium der Sozialarbeit arbeitet sie in ihrem Beruf mit viel Leidenschaft in verschiedenen Städten Deutschlands und der Schweiz. Ihre Neugier auf fremde Länder und Kulturen stillt sie mit Reisen. Bis eine Urlaubsreise und Safari im Jahr 2011 nach Tansania unerwartet eine Wende in ihr Leben bringt.
Im Oktober 2013 siedelt sie endgültig nach Arusha in Tansania über.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Neuauflage
Vorwort
Meine neue Familie
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Kapitel 124
Kapitel 125
Vorwort zur Neuauflage
Als ich im Jahr 2016 das Buch „Kila kitu sawa“ veröffentlichte, hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Leserinnen und Leser finden würde.
Als es endlich fertig war und ich es zum Druck abgeschickt hatte, hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Rechtschreib- und Kommafehler hatte. Das sah ich erst, als ich das fertige Buch in den Händen hielt.
Ich freue mich sehr, dass das Buch soviel Anklang findet, aber mir sind die vielen Fehler wirklich unangenehm.
Das Buch ist vor 6 Jahren bei drückender Hitze entstanden. Ich erinnere mich, wie ich schweiß überströmt in meinem Arbeitszimmer saß. Entweder ist es jetzt nicht mehr so heiß wie damals oder ich habe mich inzwischen sehr gut an die afrikanischen Temperaturen gewöhnt.
Ich habe das Buch in meinen Laptop geschrieben, der nach wenigen Stunden einen leeren Akku hatte. Da wir damals noch keinen Strom hatten, musste ich ein ganzes Stück laufen, bis ich an die „Stromgrenze“ kam. Dort konnte ich gegen ein kleines Entgelt, den Laptop in einem Laden wieder aufladen lassen.
Das Buch wurde von mir am Bildschirm korrigiert, was wirklich schwierig ist. Aber technisches Equipment wie Drucker gibt es nur in großen Büros oder in kleinen Shops, die Drucken, Scannen oder Fotokopieren als Dienstleistung anbieten.
Das Buch wurde schließlich und endlich an den Verlag abgeschickt, obwohl das Internet sehr schwach war und es sehr lange dauerte bis die Übertragung endlich klappte.
Man meint, ich rede von lange vergangenen Zeiten, nicht von 2015.
Tatsächlich haben wir hier in Tansania in den letzten 5 Jahren große technische Entwicklungssprünge erlebt. Man meint, wir könnten schon ewig über Whatsapp oder andere Messenger mit der Heimat kommunizieren, aber das ist noch gar nicht so lange her.
In Tansania gab und gibt es in den letzten Jahren große Entwicklungen, in der Technik, im Straßenbau, in der Regierungsführung, und so weiter.
Trotz allem ist mein Buch genauso wie ich es vor 6 Jahren geschrieben habe, noch aktuell und es gab inhaltlich keinen Grund zur Veränderung oder Anpassung.
Ich danke Ulrich Nilles für den Anstoß, das Buch neu aufzulegen. Er hat das Buch gewissenhaft gelesen und lektoriert.
Trotzdem bitte ich um Nachsicht, wenn sich doch wieder neue Fehler eingeschlichen haben oder alte überlesen wurden.
Ich wünsche allen meinen Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre.
Brigitta James,
im November 2021
Wer mit mir Kontakt aufnehmen möchte, kann das gene über meinen Blog tun:
https: brigittajames.wordpress.com
Vorwort
Kila kitu sawa ist Kisuaheli und bedeutet „alles ist ok“. Dies ist eine der ersten Redewendungen, die ich in Tansania gelernt habe, weil man sie häufig benutzt. Zum Beispiel schildert man ein Problem, schließt dann aber ab mit „Kila kitu sawa“, was bedeuten soll, das kriege ich schon in den Griff. Man denkt hier eben sehr positiv.
Und wenn ich im Folgenden einige für mich fremde Situationen schildere, kann ich immer wieder nur hinzufügen „Kila kitu sawa“, und meine das auch so.
Mein Buch ist ein Erfahrungsbericht über mein Leben in Tansania, das ich in Tagebuchform niedergeschrieben habe. Es umfasst den Zeitraum von genau einem Jahr.
Durch die Heirat mit einem Tansanier lebe ich seit 2013 in Arusha, der größten Stadt im Norden Tansanias.
In meinen Tagebucheinträgen beschreibe ich, was mir in dieser fremden Kultur begegnet und was mich beschäftigt. Mit dem Blick einer „Noch-Außenstehenden“ beobachte ich die neue Kultur und versuche, heimisch zu werden. Mein Mann James, ein Safariguide, kennt Deutschland und ist es gewohnt, mit Deutschen Umgang zu haben. Geduldig beantwortet er meine Fragen, erklärt mir vieles und hilft mir, meine neue Umwelt zu verstehen.
In den Monaten, in denen ich hier lebe, merke ich, dass vieles von dem was in Reiseführern beschrieben ist, so nicht stimmt und viel zu pauschalisiert ist. Das Land und seine Menschen sind facettenreich und differenziert zu betrachten.
Ich habe nicht den Anspruch, die „Wahrheit“ über ein ganzes, dazu noch sehr großes Land und deren Leute zu verkündigen, möchte aber mit meinen ganz persönlichen Erlebnissen einen Einblick in mein tansanisches Leben gewähren, welches nicht das Leben der „weißen Massai“ ist, sondern das einer tansanischen Mittelstandsfamilie. Ganz bewusst habe ich den Untertitel „MEIN tansanisches Tagebuch“ gewählt.
Ich schreibe für Leserinnen und Leser, die sich für das alltägliche Leben in Tansania interessieren, die sich auf einen längeren Aufenthalt oder eine Reise dorthin vorbereiten, oder nach einer Reise mehr über den Alltag wissen wollen.
Meine neue Familie
Vor einigen Jahren habe ich eine Safari in Tansania gemacht. Ich kam mit vielen Eindrücken von der Natur, den Tieren und den Menschen wieder nach Hause, nach Berlin, wo ich damals lebte. Aber vor allem mit einer neuen Liebe. James, unser Safariguide, und ich hatten uns in den 20 Tagen, die wir zusammen verbracht hatten, ineinander verliebt.
E- Mails und Handy machten es möglich, in Kontakt zu bleiben. Es folgten in den nächsten Jahren einige gegenseitige Besuche. Schließlich bin ich im Oktober 2013 für immer nach Arusha gereist, um James zu heiraten und mit ihm zu leben.
Ich habe in eine sehr nette Familie eingeheiratet. James hat vier Brüder und vier Schwestern, mit denen er in gutem Kontakt steht.
Aber richtig eng verbunden ist er mit seinem ein Jahr älteren Bruder John. James und John sind die beiden erstgeborenen Kinder der Familie. Obwohl sie sich weder äußerlich noch im Wesen ähnlich sind und auch kaum etwas Gemeinsames unternehmen, sind sie fast wie Zwillinge miteinander verwoben. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die Mutter kurz nach der Geburt des jüngsten Bruders starb, als die beiden 17- und 18- jährigen Jungs die Verantwortung für die ganze Familie übernahmen. Der Vater, ein heute um die 75 jähriger sehr freundlicher Mann, war den neuen Herausforderungen allerdings nicht gewachsen. Ihn schickte man bald in seine Heimatregion im Nordwesten Tansanias, um sich nach einer neuen Frau umzusehen.
James und John haben sich nie getrennt, bauten zwei kleine Häuser, die einen gemeinsamen Hof hatten, feierten vor ca. 25 Jahren eine Doppelhochzeit und bekamen ungefähr zur gleichen Zeit ihre Kinder.
James hat drei Kinder. Die Älteste ist Angela, 24 Jahre alt, seit ein paar Monaten verheiratet. Sie hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Kaum ein Jahr nach Angela kam Maziku zur Welt, der heute in Daressalam Ökonomie studiert. Und dann ist da noch der 16 jährige Emanuel, der noch fleißig zur Schule geht.
John hat nur zwei Kinder. Lemy, 23 Jahre alt. Sie macht im Süden Tansanias eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin und träumt davon, bald ihren Freund zu heiraten. Longino ist Johns 15- jähriger Sohn, der auf ein Internat geht.
Da der Vater von James und John eine recht junge Frau wieder geheiratet hat, hat er noch mal einen Schwung Kinder bekommen, die er aber – ganz nach tansanischer Art – an die älteren Kinder „verteilt“ hat. So wächst noch Gabriel mit den Kindern von James und John auf. Er ist gerade 13 Jahre alt und geht – wie hier nicht unüblich – seit ein paar Wochen auch ins Internat.
Da James Frau vor sechs Jahren gestorben ist, bin ich nun seine zweite Frau.
Johns Frau lebt noch, aber nicht mehr mit ihm zusammen.
Nun haben die beiden Brüder für mich und um ein neues Leben an einem neuen Ort von Arusha anzufangen, ein neues Haus gebaut. Es ist dieses Mal größer und komfortabler als das alte Haus von vor 25 Jahren, aber wieder ein Doppelhaus.
Das alte Haus steht in Kijenge, einem Stadtteil von Arusha, von dem im Folgenden noch ab und zu geredet wird. Kijenge ist dicht an der Innenstadt gelegen. Heutzutage leben dort viele, viele Menschen und alle Grundstücke sind dicht bebaut. Das ist einer der Gründe, warum James und John in das ruhigere, etwas weiter von der Innenstadt entfernt liegende Moshono ziehen wollten. Hier sind bisher nur wenige Grundstücke bebaut, es ist ruhig und ländlich.
James und ich leben in der einen Haushälfte, John mit den Kindern in der anderen.
Inzwischen sind von den sechs Kindern bis auf Emanuel alle „ausgeflogen“, es wird nur noch in den Semester - bzw. Schulferien voll.
Emanuel schläft zwar bei John, wird aber von James und mir versorgt und, sofern das noch möglich ist, „erzogen“.
Ich bin von allen Kindern vom ersten Tag an sehr freundlich empfangen worden. Ja, sie haben sich über ihre deutsche Stiefmutter gefreut. Tansanische Frauen sollen angeblich keine guten Stiefmütter sein, sagen die Kinder. Und das habe ich auch schon öfters gehört.
Das ist also meine Familie hier, von der ab und an in diesem Tagebuch die Rede ist.
Und nun geht es los:
18. Oktober
Gestern bin ich also endgültig in Tansania angekommen, nicht nur für Urlaub wie die Male vorher. Ich bin richtig „ausgewandert“. Aber es war gar nicht so aufregend, wie viele sich das vorstellen, eher erleichternd, dass der lange Prozess des Wohnungsauflösens, Jobverlassens und Abschiednehmens endlich vorüber ist.
Obwohl Hochsaison für Safari Guides ist, wollen James und ich so schnell wie möglich heiraten. Schon vor längerer Zeit hatten wir uns bei einem unserer Telefonate zwischen Deutschland und Tansania auf den 7. Dezember geeinigt.
Im Vorfeld war er zu seinem katholischen Priester gegangen, hatte das Anliegen vorgetragen und ein Formular zum Ausfüllen bekommen. Mein Part war es nun, einen Brief von meinem evangelischen Pastor über mich und seine Stellungnahme zu unserer beabsichtigten Hochzeit zu bringen.
Mein Pastor in Berlin ist der Bitte sofort und gerne nachgekommen und zum Glück auch gleich auf Englisch, sodass ich den Brief nicht übersetzen lassen musste.
Gleich heute Morgen, einen Tag nach meiner Ankunft in Tansania, haben wir wir uns in die Sprechstunde des katholischen Priesters begeben.
Neben der recht großen Kirche mit Wellblechdach befinden sich mehrere kleine Gebäude. Eines davon ist das Büro des Priesters, davor eine Wartebank, auf der schon zwei Personen saßen. Wir reihten uns ein. Begleitet wurden wir von Mazawe. Er ist der Leiter des wöchentlich stattfindenden Gebetstreffens. Reihum treffen sich die Gemeindeglieder in ihren Häusern am frühen Morgen, aufgeteilt in die nachbarschaftliche Umgebung, zum Gebet und zur Information aus der Kirchengemeinde. Diese Art der Organisation des kirchlichen Lebens findet man in allen Konfessionen.
Mazawe kennt James sehr gut und bekräftigt mit seiner Anwesenheit unser Anliegen.
Schließlich war es so weit. Wir wurden von einem erstaunlich jungen Priester in gutem Englisch begrüßt. James erzählt mir, dass er außerdem gut französisch spricht, da er zu einer Bruderschaft aus dem Kongo gehört, die die Priester für diese katholische Gemeinde stellen.
Er nahm das von James ausgefüllte Formular, den Brief von meinem Berliner Pastor, meine Taufurkunde und trug unsere Daten und einige Kommentare mit sorgfältiger Handschrift in sein Hochzeitsbuch ein. Ab und zu stellte er Verständnisfragen. Er fragte mich, ob ich zur katholischen Konfession übertreten will. Als ich das verneine, sagt er, dass „mixed marriages“ kein Problem seien. Damit ist diese Mal aber nicht die Eheschließung zwischen schwarz und weiß, sondern zwischen evangelisch und katholisch gemeint. Er wies uns darauf hin, dass unsere Kinder katholisch getauft werden sollten. Als ich ihm sage, dass ich zum Kinderkriegen zu alt sei und dieses nicht unser Thema ist, sieht er mich erstaunt an. Ob ich noch so jung aussehe? Ich glaube eher, dass Afrikaner schlecht das Alter von Weißen schätzen können und umgekehrt.
Nachdem das Hochzeitsdatum im Kalender des Priesters eingetragen ist und wir die Namen unserer Trauzeugen angegeben haben, unterschreibt Mazawe alle Angaben im Hochzeitsbuch und wir sind entlassen. Jetzt wird der Priester erst mal auf Dienstreise gehen und James auf Safari. Wenn beide zurück sind, treffen wir uns wieder für „instructions“, was auch immer das heißt.
Gleich im Anschluss begaben wir uns auf die Suche nach einem Saal zum Feiern. Es werden ca. 300 Gäste erwartet, da viele Leute James kennen und Feiern aller Art sehr beliebt sind. Der 7. Dezember ist ein Datum, an dem viele Hochzeiten stattfinden und man sagt uns, es sei schwierig, einen Saal zu finden. Also ist schnelles Handeln angesagt.
Zuerst gingen wir ins Casino der Bankangestellten. Ein schlichter Saal im Erdgeschoss, zentral in der Stadt gelegen, mit genügend Parkplätzen vor der Tür. Der Saal ist nicht schlecht, aber schon ausgebucht. Weiter zum Polizeikasino. Der Saal sieht genauso o.k. aus, hat auch genügend Parkmöglichkeiten, aber vor allem sind vor dem Eingang zum Saal viele Bäume mit Tischgruppen darunter. Ein schöner Eingang. Und, oh Wunder, der Saal ist noch frei und der Preis ist auch nicht zu hoch.
19. Oktober
Heute Nachmittag ging es gleich mit Hochzeitsvorbereitungen weiter.
James hatte vor ca. vier Wochen Einladungskarten für die „Gründungsversammlung des Hochzeitskomitees und Fundraising“ gedruckt. Ungefähr 80 Personen wurden für 16.00 Uhr in einen schönen Club eingeladen. Viele ließen sich entschuldigen, da an dem Tag auch die Schulentlassung der Kinder in Arusha stattfand und dieses gebührend gefeiert wird. Auch durch einige Todesfälle waren Leute verhindert. So waren wir gespannt, wer überhaupt außer den Brüdern und engsten Freunden kommt.
Kurz vor 16.00 Uhr duschen wir und ziehen uns um. James geht auch noch zum „Barber“, um sich rasieren zu lassen. Eine gute Idee. Ich habe inzwischen genügend Afrika-Erfahrung, um nicht nervös zu werden, da es inzwischen schon lange nach vier Uhr ist.
Als wir um 16.30 Uhr im Club ankommen, ist außer seinen drei Brüdern noch niemand da. Alle haben sich sehr herausgeputzt mit weißen Hemden, John sogar in rosa glänzend, und Sonnenbrillen. Ein bisschen sehen sie wie Drogenbosse aus, aber viele afrikanische Männer lieben dieses Outfit. Und ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre, mich auch besser anzuziehen. Als später die afrikanischen Frauen in den schönsten Kleidern und Schuhen kommen, fühle ich mich wie „Trudi vom Lande“. Aber James beruhigt mich. Sie kommen von den Schulentlassungsfeiern und sind deshalb so schick.
Aber erst mal sind wir noch unter uns. Wir sitzen an einer langen Tafel unter einem Schattendach zusammen mit einigen wenigen, inzwischen eingetroffenen Freunden.
Und nun geht das Telefonieren los. Jeder zückt sein Handy und ruft Leute an. Einige sagen, sie seien auf dem Weg, einige sagen sie kämen etwas später, andere, sie hätten es vergessen, würden aber sofort kommen. Von denen, die abgesagt haben, erfragt man, wie hoch die Summe sei, die sie bereit seien für unsere Hochzeit zu geben.
Gegen halb sechs werden Getränke serviert. Extra nicht früher, damit niemand die
Gelegenheit hat, auf unsere Kosten zu viel zu trinken, denn einige Stunden werden noch ins Land gehen.
Um sechs, als 15 Leute da sind, wird darüber diskutiert, wer denn der Vorsitzende des Hochzeitskomitees werden soll. Man braucht einen erfahrenen Mann, der in der Lage ist, die ganze Angelegenheit zu managen und den Überblick zu behalten. Im Vorfeld war Patriz gefragt worden und alle Anwesenden murmeln nun ihre Zustimmung. Nachdem dies nun klar ist, eröffnet er die Sitzung mit einem Gebet.
Nun wird über den Stellvertreter diskutiert. Artig erhebt sich der Redende. Mehrere Redende geben ihr Votum dafür ab, dass eine Frau dieses Amt übernehmen sollte. Dies scheitert nur daran, dass nur drei Frauen zu diesem Zeitpunkt anwesend sind. Nachdem der Stellvertreter gefunden ist, muss noch ein Schatzmeister und sein Stellvertreter gefunden werden. Dieses übernehmen nach kurzer Diskussion James Brüder Joseph und John.
Ja, und nun kommt der spannende und für mich sehr befremdliche Teil, in dem es darum geht, das Geld zusammen zubringen. Als erstes muss James aufstehen und sagen, wie viel wir für unsere Hochzeit aufbringen können. Wir hatten uns vorher auf eine Million Tansanische Schilling geeinigt, das sind 500 Euro.
Nun werden nach und nach die anderen Gäste aufgerufen, ihren Beitrag bekannt zu geben. Als erstes Bruder John. Er verspricht 250 Euro, auch eine Menge Geld. Nach und nach muss jeder aufstehen, eine kleinen oder großen Betrag nennen. Dieses wird unter Applaus in einem Buch notiert. Die telefonisch zugesagten Beträge werden außerdem laut bekannt gegeben.
Und nun wird gerechnet und gerechnet.
Inzwischen sind auch die restlichen Gäste, insbesondere die gut gekleideten Frauen, eingetroffen. Zeit, das sehr gute Abendessen zu servieren. Jeder bekommt einen Teller mit reichlich gegrilltem Hähnchen sowie Rindfleisch mit Salat und Kochbananen.
Nach dem Essen wird unter Applaus die gesammelte Summe bekannt gegeben:
7 Millionen tansanische Schilling. James meint, dass man damit rechnen kann, dass ca. dreiviertel der Leute auch die versprochene Summe bezahlen. Um die Sache verbindlicher zu machen, findet das Versprechen der Geldsumme öffentlich statt. In Deutschland undenkbar.
Nun wird das Datum der nächsten Versammlung am 2. November bekannt gegeben und nach dem Schlussgebet brechen alle auf. Inzwischen ist es 21.00 Uhr.
20. Oktober
Meine ersten Tage in meiner neuen Heimat widme ich dem Erkunden von Arusha Stadt. Jeden Winkel der Innenstadt erkunde ich zu Fuß. Und ich lerne das Dalla Dalla-Fahren.
Eine Dalla Dalla ist ein Minibus, meistens der Firma Toyota. Am Anfang waren die Fahrzeuge Ford-Minibusse und man nannte dieses Verkehrsmittel Kifordi. Doch später setzte sich der Name Dalla Dalla durch, weil die Fahrt ursprünglich mal einen Dalla kostete. Ein Dalla waren fünf Tansanische Schilling. Eine Münze, die es längst nicht mehr gibt, das Verkehrsmittel hat sich allerdings bis heute bewährt.
Nur in den beiden großen Städten Daressalam und Mwanza fahren größere Busse im öffentlichen Nahverkehr. In allen anderen Städten und Ortschaften sind die Dalla Dallas das einzige öffentliche Verkehrsmittel neben Taxis und Motorradtaxis.
Sie haben feste Routen und sind durch einen dicken farbigen Querstreifen auf dem sonst weißen Fahrzeug gekennzeichnet. Die rote Linie fährt zu uns nach Hause. Es gibt feste Haltestellen und einen einheitlichen Fahrpreis von heutzutage 400 Tansanischen Schillingen, für Schüler in Schuluniform 200.
Neben dem farbigen Streifen sind Dalla Dallas individuell mit Verzierungen und Sprüchen versehen. Gerne verwendet man religiöse Sprüche wie „der Herr ist mein Hirte“, „trust God“ oder „Allah ist groß“, aber gerne zeigt man auch, von welchem Fußballclub man Fan ist. Hauptsache bunt!
Die Dalla Dallas sind in Privatbesitz. Auch ich bin Besitzerin solch eines Fahrzeuges und verdiene mir damit mein wöchentliches Geld.
Als Besitzer muss man das Fahrzeug für eine bestimmte Fahrtroute bei der Stadt anmelden. James hat mir eine Route gesucht, bei der die gesamte Strecke eine asphaltierte Straße hat, sodass das Fahrzeug nicht so schnell abgenutzt ist.
Hat man diese „Roadlicence“ zahlt man noch Versicherung und Steuern. Dann führt man das Fahrzeug bei der Polizei vor und erhält die Beförderungserlaubnis. Dieses muss man jedes Jahr wiederholen und es wird durch Aufkleber, die sichtbar an der Fahrzeugscheibe angebracht sind, streng überprüft.
So! Ist das erledigt, sucht man einen Fahrer und macht einen Vertrag mit ihm.
Der Fahrer sucht sich nun einen Schaffner und dann kann das Geschäft losgehen. Schaffner sind meist wendige Jungens, die die meiste Zeit der Fahrt mit dem Oberkörper aus dem Fenster hängen und den Straßenrand nach Fahrgästen absuchen.
Fahrer und Schaffner kämpfen nun um Kundschaft und versuchen, ihre Dalla Dalla möglichst voll zu stopfen, und die Route möglichst häufig und zügig zu befahren. In der Regel 7 Tage die Woche von 7 – 20 Uhr.
Einmal pro Woche liefert der Fahrer mir einen festen, vorher vereinbarten Betrag ab. Dafür zahle ich ihm einmal im Monat ein festes Gehalt und alle Reparaturkosten. Ist das Fahrzeug in der Werkstatt, sodass er nicht fahren kann, mindert das meinen Wochengewinn.
Der Fahrer und der Schaffner teilen sich den Erlös, der über die Summe, die sie mir abliefern, hinausgeht. Je fleißiger sie fahren und je mehr Leute unterwegs sind, umso höher ist ihr Verdienst.
Es gibt viele Dalla Dallas und man muss nie länger als ein oder zwei Minuten warten, bis ein Fahrzeug einen an der Straße aufsammelt. Dann kann es allerdings auch vorkommen, dass man erst mal mit zur Tankstelle muss.
Der Sitzkomfort einer Dalla Dalla ist sehr bescheiden, denn die insgesamt 15 Sitze hinten und die 2 Plätze vorne neben dem Fahrer sind schmal und die meisten Menschen „wohl gebaut“. Dazu können noch mindestens 5 weitere Fahrgäste in gebückter Haltung stehen. Fährt man mit Kind oder einer größeren Tasche, gibt man sie dem nächst besten Sitzenden auf den Schoß. Alles kein Problem und ein System, das bestens und in Privatwirtschaft funktioniert.
Eine Dalla Dalla ist oft alt und wirkt sehr abgenutzt, allerdings sorgt der Fahrer dafür, dass sein Fahrzeug innen und außen immer sauber ist. Dazu bringt er das Fahrzeug zum Car Wash. Dieses sind Plätze, die riesige, gemauerte Wasserbecken haben und an denen Jungen mit Eimern auf Kundschaft warten. Man gibt Auto und Schlüssel ab und setzt sich zum Warten in eine nahe gelegene Bar. Dann machen sich ein oder zwei Jungs an die gründliche und wirklich gute Reinigung des Fahrzeuges. Auch hier funktioniert das nach dem gleichen Prinzip. Die Jungen liefern einen festen Betrag an den Betreiber des Car Wash ab, den Rest behalten sie für sich. Je fleißiger sie arbeiten und je mehr Kundschaft kommt, desto höher ist der Verdienst.
22. Oktober
Bereits am Montagabend tagte die kleine Runde der Brüder und engsten Freunde wieder. James ist auf Safari und ich war auch nicht dabei und weiß nicht wirklich, was sie besprochen haben. Ich glaube, sie haben versucht, ein erstes Budget zu machen.
Auch heute Abend traf sich der kleine Kreis, um nun in einem Heft die Namen derjenigen zusammen zutragen, die eine „Donationcard“ bekommen sollen. Mit dieser Donationcard wird die Hochzeit bekanntgegeben.
Wer dann von den Empfängern dieser Karte wirklich eingeladen werden möchte, muss ebenfalls einen kleinen Beitrag zahlen. So begrenzt man die Zahl der Gäste, die sonst ins Unermessliche steigt. Wer einen Betrag bezahlt hat, erhält später eine Einladungskarte. Auch meine Zimmermädchen und Frühstücksfrauen vom Guesthouse möchten eine Donationcard. Als ca. einhundert Namen zusammen getragen sind, ist es spät und wir beschließen, alle nach Hause zu gehen. Fortsetzung folgt.
23. Oktober
In Tansania zu leben, ist sehr kommunikativ. Viele Menschen sind zu Fuß auf der Straße unterwegs: zum Wasser holen an der öffentlichen Wasserstelle, zum Wäsche waschen im Fluss, für kleine Lebensmitteleinkäufe, da ja niemand einen Kühlschrank zuhause hat. Sobald ich mich auf der Straße sehen lasse, werde ich von Bekannten und Nachbarn freudig begrüßt.
Immerhin kenne ich James schon einige Jahre und man kennt uns schnell in seinem Stadtteil.
Einige sprechen mich sogar mit Namen an.
Ich möchte so gerne mit dem Namen des Gegenübers antworten, aber dieses Anliegen scheint unmöglich zu sein. Bis auf die engsten Familienmitglieder und Freunde von James kann ich mir die Namen nicht merken. Zusätzlich ist die Schwierigkeit bei den Frauen, dass sie mit verschiedenen Namen angesprochen werden. Sobald sie Kinder haben, nennt man sie nicht mehr mit ihrem eigenen Namen, sondern sagt Mama Victor, Mama Irene, Mama sonst was, je nachdem wie das Kind heißt. Das wäre noch merkbar, aber hat eine Frau mehrere Kinder, was ja die Regel ist, kann sie so viele verschieden Mama-Namen wie Kinder haben. Wie soll man da noch durchsteigen. Meine Schwägerin Anett hat zum Glück nur ein Kind und heißt Mama Victor. Meine Schwägerin Maria hat auch bisher nur einen Sohn und heißt Mama Einochi.
Ja, und nun sprechen mich Leute auf der Straße an. Ich habe schon Schwierigkeiten, mich überhaupt an sie zu erinnern, aber mir ihre Namen zu merken, scheint mir was für Fortgeschrittene zu sein.
Aber auch untereinander kennen sich selbst Freunde nicht mit richtigem Namen. Es werden z. B. Spaßnamen vergeben, die auch wechseln können. Man sagt zu einem Freund „Eyh Tajiri“, das heißt „Hallo Reicher“, oder „Eyh Van Damme“, weil jemand viele Muskeln hat.
Der Partner des Freundes oder der Freundin heißt einfach „shemeji“, das heißt Schwägerin. Wenn mich auf der Straße jemand mit „eyh Shemeji“ anspricht, weiß ich, das muss ein Freund von James sein, kann also kein ganz Fremder sein. Eyh ist hier eine legere oft benutzte Einleitungsformel. Zum Abschied heißt es dann nur kurz Eyhaaa. Beliebt ist auch die Anrede „Sister“ oder „Dada“, das Kisuaheli-Wort für Schwester, bzw. „Bro“, was Brother meint.
Oft spricht man die Leute mit dem Namen ihres Stammes oder ihres Heimatortes an, „eyh Massai“, „eyh Mlingi“, „eyh Sonjo“. Und ich heiße Mzungu. Mzungu ist das Kisuaheli- Wort für Weiße im Allgemeinen. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort, der, der die Welt umrundet hat. Am Anfang hat mich die Anrede „Mzungu“ sehr genervt, ich fand es irgendwie diskriminierend, wie ein Schimpfwort, bis ich begriffen habe, dass sie es untereinander auch so allgemein mit der Anrede machen und es anscheinend normal ist.
Im Gegenteil, eine Mzungu wird mit Respekt betrachtet und die Kinder werden angehalten zu grüßen. Wenn sie schon mal irgendwo Englisch aufgeschnappt haben, wird einem am Nachmittag schon mal ein „Good morning“ zugerufen, oder ein „Good after“, weil sie „Good afternoon“ nicht auf die Reihe kriegen. Ich finde es schlimm, wenn von überall nur dieses hässliche „hi“ ertönt. Gibt es hier doch so schöne Begrüßungsformeln, die einem ein bisschen mehr Kontakt als nur ein einsilbiges „hi“ ermöglichen.
Neulich trafen wir einen älteren Herrn, der den Verfall der Sprache beklagte. Dieses dahingeworfene englische „Hi“ gibt es auch in Kisuaheli Version. Statt der langen Begrüßungsform heißt es nur „Mambo?“ und die Antwort „Poa!“. Das ist Streetlanguage und heißt so was wie „Wie steht die Sache?“ – „Gut.“
Dieser Herr erklärte mir auch, dass man eigentlich nur Leute, die man gut kennt, mit Vornamen anspricht. Es ist ein Zeichen von Respekt, wenn man einen älteren Herrn nur mit „Mzee“ anspricht, einen jüngeren Herrn mit „Bwana“. Frauen spricht man generell mit „Mama“ an. Das erinnert mich an unsere deutsche Unterscheidung von „Du“ und „Sie“.
Die häufigste Frage, die mir von Freunden in Deutschland in Bezug auf unsere Hochzeit gestellt wird, ist wie ich denn dann heißen werde. Klar, in Deutschland keine einfache Entscheidung. Hier ist es einfach. Frauen und Männer führen in offiziellen Dokumenten ihre alten Namen weiter. Inoffiziell wird an meinen Vornamen der Vorname meines Mannes gehängt. Fertig. Also Birgit James.
Die Kinder bekommen einen Vornamen nach freier Wahl der Eltern, der häufig auch der Name von einem Großelternteil ist. So wird es in Deutschland ja auch oft gemacht. Der Nachname der Kinder ist dann der Vorname des Vaters. Also James Kinder mit seiner verstorbenen Ehefrau heißen: Angela James, Maziku James und Emanuel James.
James heißt mit Nachnamen Longino, denn sein Vater heißt Longino mit Vornamen. Mit Nachnamen heißt sein Vater Mende. Daraus kann man nun ableiten, dass der Großvater von James mit Vornamen Mende hieß.
Alles klar? Gut, dass man sich am unverfänglichsten mit Mama und Bwana bzw. Mzee anreden kann.
24. Oktober
Auch die jungen Frauen der Familie sind wegen unserer Hochzeit aufgeregt. James Tochter, seine jüngste Schwester und seine Schwägerin diskutieren nachmittags welche Farbe denn die „Uniform“ haben soll. Das ist die festliche Kleidung der Familienangehörigen und engsten Freunde. Es wird Stoff gekauft und den Frauen Kleider mit verschiedenen Schnitten genäht. Die Jungs und Männer müssen sich Hemden in einer passenden Farbe kaufen und es werden ihnen Krawatten genäht.
Als ich nach Wunschfarben gefragt werde, fällt mir spontan türkis und helles Blau ein. Ich trage gerade Ohrringe in der Farbe und zeige sie ihnen. Der Vorschlag findet sofort Zustimmung. Trotzdem wird noch lange auf Kisuaheli über die verschiedensten Farben palavert. Auch am nächsten Nachmittag werde ich noch mal gebeten zu kommen. Gleiches Thema, gleiches Palaver, gleiches Ergebnis. Mal sehen, ob es noch mal diskutiert wird.
Einig ist man sich, dass man bald Stoff suchen und kaufen muss, da die Stoffpreise, je näher es an Weihnachten heranrückt, steigen. In Tansania werden anstelle von Weihnachtsgeschenken alle Familienmitglieder von oben bis unten neu eingekleidet, und das bedeutet hohe Nachfrage nach Stoff und Schneidern.
26. Oktober
In Mails bekomme ich von meinen Freundinnen viele Fragen über das Leben in Tansania gestellt. Unter anderem auch über das Essen.
Es ist nicht wirklich fremd, allerdings nicht so raffiniert gekocht wie in Deutschland. Kein Wunder, kocht man ja auch meistens auf Holzfeuer draußen oder einem kleinen Holzkohleöfchen, auf dem Fußboden hockend. Ich koche auf einem einflammigen Gaskocher wie beim Camping. Und das geht erstaunlich gut.
Das heißt, dass man die verschiedenen Komponenten nacheinander kocht. Die so genannten „Hot Pots“, hübsche Thermoschüsseln mit gut verschließbarem Deckel, halten das Gekochte lange warm.
Die Hauptmahlzeit besteht aus Reis, Kartoffeln, Kochbananen, Ugali und selten mal aus Spaghetti. Andere Nudeln sind nicht so verbreitet.
Ugali ist fester Maisbrei, der weiß aussieht und nach nichts schmeckt. Man formt mit den Fingern kleine Klößchen, drückt eine kleine Vertiefung mit dem Daumen hinein und kann so prima die dazu gereichte Soße oder die Bohnen „löffeln“.
Braune Bohnen sind auch ein wichtiger und häufiger Bestandteil der Mahlzeit. Außerdem gibt es Gemüsesoße mit Fleisch oder Fischstücken. Häufig wird ein ganzer Fisch gebraten und mit etwas Soße übergossen.
Zu festlichen Angelegenheiten gibt es auch mal Chapati, ursprünglich aus Indien stammend. Dies sind dünne Fladen aus Weizenmehl, die als Beilage gegessen werden.
Gerne wird auch „Kabichi“ (vom englischen „Cabbage“) gegessen. Fein geschnittener Weißkohl mit fein geschnittenen Karotten in Zwiebeln gedünstet.
Eines meiner Lieblingsessen ist Pilau. Hierzu wird Reis und Fleisch wie Risotto langsam mit einer speziellen braunen Gewürzmischung aus Nelken, Koriander, Pfeffer, Zimt, Kardamom, Kumin und Knoblauch gegart.
Ich liebe auch Chips Mayai. Chips erinnern an unsere Pommes Frites, sind aber viel besser, da frisch von Hand gefertigt. Sie werden frittiert und dann mit Mayai, das ist das Kisuaheli-Wort für Eier, übergossen und gegart. Apropos Fett. Das wird viel benutzt. Fast alles wird in Fett gebacken, gibt es doch keine Backöfen im normalen Haushalt.
Gerne essen Tansanier in kleinen Bars Barbecue, das ist auf dem Holzkohlegrill gebratenes Rind - oder Ziegenfleisch oder Hähnchen. In speziellen Restaurants kann man auch Schweinefleisch finden. Es wird aber nie zusammen mit den anderen Fleischsorten in einer „Küche“ gebraten. Das tut man aus Respekt vor dem moslemischen Teil der Bevölkerung, die kein Schweinefleisch ißt. Hat aber ursprünglich wohl hygienische Gründe in einem Land mit heißem Klima und ohne Kühlmöglichkeiten.
Geht man zum Barbecue-Essen, sucht man sich erst mal in der Küche das rohe Stück Fleisch aus, das man haben möchte. Dieses wird dann vor den Augen abgeschnitten und gewogen und auf den Grill gelegt.
Da manche Leute das Essen scharf mögen, manche nicht, kommt die scharfe Soße aus Chilischoten, Pili Pili genannt, immer in einem Extraschüsselchen auf den Tisch.