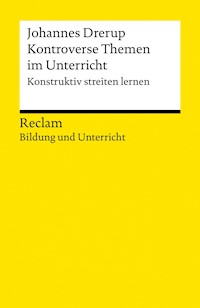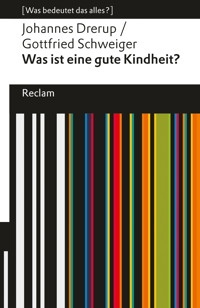Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die im Zuge der Covid-19-Pandemie getroffenen politischen Entscheidungen und ihre Folgen für Kinder und Jugendliche sind Gegenstand anhaltender, oftmals erbittert geführter politischer und pädagogischer Kontroversen. Je länger die Pandemie andauert, desto deutlicher zeichnet sich ab, dass es in vielen Fällen Kinder und Jugendliche sind, die durch sie besonders hart belastet werden. In seinem Buch zeichnet Johannes Drerup die einschneidenden Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie für Kinder und Jugendliche nach und entwickelt auf dieser Grundlage eine ethisch begründete Kritik an der deutschen Corona-Politik. Hierdurch leistet er einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Debatte darüber, wie sich die Situation junger Menschen in Deutschland – nicht nur in Zeiten der Pandemie – verbessern lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes Drerup
Kinder, Corona und die Folgen
Eine kritische Bestandsaufnahme
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Die im Zuge der Covid-19-Pandemie getroffenen politischen Entscheidungen und ihre Folgen für Kinder und Jugendliche sind Gegenstand anhaltender, oftmals erbittert geführter politischer und pädagogischer Kontroversen. Je länger die Pandemie andauert, desto deutlicher zeichnet sich ab, dass es in vielen Fällen Kinder und Jugendliche sind, die durch sie besonders hart belastet werden. In seinem Buch zeichnet Johannes Drerup die einschneidenden Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie für Kinder und Jugendliche nach und entwickelt auf dieser Grundlage eine ethisch begründete Kritik an der deutschen Corona-Politik. Hierdurch leistet er einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Debatte darüber, wie sich die Situation junger Menschen in Deutschland – nicht nur in Zeiten der Pandemie – verbessern lässt.
Vita
Johannes Drerup ist Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildungstheorie an der TU Dortmund und Gastprofessor an der Freien Universität Amsterdam. Seine Forschungsinteressen liegen u.a. in den Bereichen der Erziehungs- und Bildungsphilosophie, der Philosophie der Kindheit und der Pädagogischen Ethik.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Einleitung
1.
Kinder in der Pandemie und die Prioritäten der Politik: Ausgangspunkte und Abwägungsprobleme
2.
Bildungsgüter: ein Orientierungsrahmen
3.
Kinder, Covid-19 und die Krisen der liberalen Demokratie
4.
Demokratieerziehung und demokratische Grundbildung in Corona-Zeiten
5.
Covid-19 und die Kontroverse über Bildungsgerechtigkeit
6.
Schule und Bildung in der Corona Pandemie: Funktionen und Aufgaben – Leistungen und Probleme
7.
Leben in der Pandemie: Probleme soziale Gerechtigkeit
8.
Impfen
9.
Der Preis der Pandemie: Gesamtbewertung und was nun zu tun ist
10.
Die Zumutungen der Prognose und das Transformationspotential der Pandemie: Ein Ausblick
Literatur
Einleitung
Die Folgen der im Rahmen der Covid-19 Pandemie getroffenen politischen Entscheidungen für Kinder und Jugendliche sind Gegenstand anhaltender, oftmals erbittert geführter politischer Kontroversen. Je länger die Pandemie andauert und je mehr wir über ihre Auswirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen wissen, desto deutlicher zeichnet sich ab, dass es in vielen Fällen Kinder und Jugendliche sind, die dadurch besonders hart belastet wurden und die auch längerfristig unter diesen Belastungen leiden werden. Auch wenn die Pandemie Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersstufen und sozioökonomischer Lebenslagen in sehr unterschiedlicher Weise getroffen hat und die Möglichkeiten, die Herausforderungen der Krise zu meistern, sehr ungleich verteilt sind, kann man sich daher der generellen Diagnose des Soziologen Hartmut Rosa anschließen, wonach »die Jungen […] die größten Verlierer, die Opfer der aktuellen Coronapolitik sind«1. Für diese Diagnose sprechen u.a. die Auswirkungen gravierender Defizite allgemeiner Grundbildung infolge der Schulschließungen und die Vergrößerung bestehender Bildungsungerechtigkeiten, physische und psychische Beeinträchtigungen von Gesundheit und Wohlergehen, eingeschränkte Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung, Ungewissheiten des Übergangs in das Beschäftigungssystem und damit verbundene begründete Ängste vor Arbeitslosigkeit2 und last but not least der Anstieg häuslicher Gewalt in der Pandemie. Am Ende, so auch der Sozialisationstheoretiker Klaus Hurrelmann, lässt sich prognostizieren: »Alle Generationen sind betroffen, aber die jungen Generationen leiden besonders.«3
Die mit diesen Befunden verbundenen ethischen und politischen Fragen werden mittlerweile überall in Deutschland und der Welt diskutiert, und zwar nicht nur in der medialen Öffentlichkeit und Wissenschaft, sondern auch an Küchentischen, in Schulen und Kitas, Parks und Kneipen: Wie sollte das Schulsystem auf künftige Wellen reagieren und was lässt sich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen? Sollen wir die Schulen und Kitas offenlassen oder erneut schließen? Welche Folgen hat dies für Fragen der Bildungsgerechtigkeit und der sozialen Gerechtigkeit? Wie lassen sich Kinder und Familien aus sozial schwächeren Milieus effektiv unterstützen? Wie lassen sich die Zukunftsaussichten der am härtesten von der Pandemie betroffenen Jugendlichen verbessern? Wie soll man mit Impfverweigerern in und außerhalb pädagogischer Institutionen umgehen? Kann es überhaupt legitim sein, die Grundfreiheiten einiger Bevölkerungsgruppen – zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen – zugunsten des Gesundheitsschutzes anderer Gruppen einzuschränken?
Diese und ähnliche – mittlerweile allzu alltägliche – Fragen und Kontroversen sind das Thema dieses Buchs. Anspruch und Ziel des Buchs ist es, eine empirisch informierte, ethisch begründete Bestandsaufnahme und Kritik der Corona-Politik und ihrer Folgen für Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Lebenslagen zu entwickeln. Damit soll ein Beitrag zur öffentlichen Debatte geleistet werden, der die wichtigsten Problemlagen in der gebührenden Klarheit auf den Punkt bringt und konstruktive und realisierbare Vorschläge zur Diskussion stellt, wie die Situation von Kindern in Deutschland während und nach der Pandemie verbessert werden kann.
Eine dezidiert ethische Analyse und Kritik der Corona-Politik ist deshalb angebracht, weil systematisch ansetzende – der Pädagogischen Ethik zuzuordnende – Perspektiven in der öffentlichen Debatte bis dato kaum präsent sind, obwohl es sich bei den diskutierten normativen Problemen offensichtlich in zentraler Hinsicht um ethische Probleme und Fragen handelt. Zu Kinder und Jugendliche betreffenden ethischen Fragen äußern sich in stetiger Regelmäßigkeit auch Expert_innen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen – etwa der Psychologie, der Medizin oder der empirischen Bildungsforschung –, welche dabei in der Regel keineswegs sparsam mit normativen Bewertungen und Ratschlägen sind. Dies ist zwar grundsätzlich als Beitrag zur öffentlichen Diskussion begrüßenswert, da eine kritische und nicht bloß rezeptive Öffentlichkeit4 in liberalen Demokratien auf die Ergebnisse theoriegeleiteter Forschung für eine vernünftige Meinungs- und Willensbildung angewiesen ist. Kritikwürdig ist jedoch, dass die in diesem Kontext vorgebrachten ethischen Positionierungen in der Regel kaum angemessen theoretisch eingeordnet oder anhand nachvollziehbarer normativer Kriterien begründet und gerechtfertigt werden. Genau hierin aber besteht die Aufgabe einer Analyse aus der Sicht der Pädagogischen Ethik.5 Es gilt die impliziten oder expliziten Kriterien zu rekonstruieren, an denen sich politische Maßnahmen orientieren müssen, und deren Konsequenzen auf den Prüfstand zu stellen.
Der mit der alltäglichen Präsenz der relevanten ethischen Diskussionen über die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie verbundene Orientierungsbedarf ist offenkundig und wird von unterschiedlicher Seite in der Öffentlichkeit bedient. Das Bedürfnis nach Orientierung sollte jedoch – gerade dann, wenn es denn mit Orientierung ernst gemeint sein soll – nicht zu der Fehlannahme verleiten lassen, dass es hier einfache ethisch begründete Antworten und Lösungen geben könnte, denn dies dürfte nur eher selten der Fall sein. Im Gegenteil: Pädagogische Ethik hat vielmehr – dort wo es auf Grund des Gegenstands der Analyse angemessen und notwendig ist – die Aufgabe, die Probleme in ihrer Komplexität und mit der gebotenen Distanz in den Blick zu nehmen und damit unweigerlich auch zu »verkomplizieren«6, gerade weil sie sich nicht in jedem Fall ohne weiteres auf nur eine und zudem einfache Art und Weise theoretisch einordnen, bewerten und bearbeiten lassen.
Hieran zu erinnern scheint insbesondere mit Blick auf die öffentliche Debatte über Kinder und Kindheiten in der Pandemie geboten: Problematische Generalisierungen – »die« Kinder als homogene Gruppe gab es vor der Pandemie nicht und sie wird es auch nach der Pandemie nicht geben – und allzu simple, sloganisierte Praxisvorschläge – etwa »mehr Digitalisierung« als pädagogisch-politische Allzweckwaffe zur Bearbeitung aller Probleme dieser Welt – dürften weder in theoretischer noch in praktischer Hinsicht weiterhelfen, und zwar am allerwenigsten denjenigen Kindern und Jugendlichen, die am schlimmsten von den Folgen der Pandemie betroffen sind. Dies gilt auch für einige der Deutungen und Zeitdiagnosen zur Covid-19 Pandemie, die von Vertreter_innen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen vorgebracht wurden und über deren Geltung, Plausibilität und Halbwertszeit man trefflich streiten kann und sollte.7 Insbesondere gegenüber oftmals apokalyptisch getönten und rhetorisch überladenen Krisen- und Verfallsdiagnosen, die als Reaktion auf die Pandemie vorgebracht wurden, ist Skepsis geboten. Methodisch operieren sie in vielen Fällen mit symptomatischen Fehl- und Kurzschlüssen, wenn sie zum Beispiel allein auf Basis anekdotischer Evidenz identifizierte individuelle Problemlagen von Kindern mit hochgradig spekulativen, impressionistischen Gesellschaftsdiagnosen koppeln8, die oft mehr über die subjektive Gemütsstimmung der Theoretiker_innen verraten (nach dem tradierten Muster: Lob der Disziplin! Warum unsere Kinder Tyrannen werden, usf.) als über die Lage, die sie vorgeben zu beschreiben. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für manchmal eher hysterisch anmutende Kritiken, die Maßnahmen der Corona-Politik in kurzschlüssigen historischen Vergleichen mit Diktaturen in Verbindung bringen und so Mängel an methodisch reflektierter historisch-politischer Urteilsfähigkeit dokumentieren, die Unfähigkeit einbeschlossen, positive Leistungen von liberaler Demokratie und ihren öffentlichen Institutionen in der Krise zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen.9 Kritik muss nicht immer konstruktiv sein und darf selbstverständlich auch polemisch geraten. Wenn aber die Kriterien, von denen sie ausgeht, auf eine undemokratische und illiberale Sichtweise schließen lassen bzw. diese jenseits von abstrakten Postulaten10 überhaupt nicht expliziert, geschweige denn begründet oder zur Debatte gestellt werden, dann wird sie selbst kritikwürdig. In kulturpessimistische Großdiagnosen gefasste Dramatisierungsrhetorik – etwa: Maskenpflicht als Kindesmissbrauch und Menschenrechtsverletzung und anderer Befindlichkeits- und Empörungskitsch, der derzeit auf Schildern von dem »Widerstand« gewidmeten Protestbewegungen nicht zuletzt vor Schulen zum besten gegeben wird –, die immer wieder »die Kinder« und ihre vermeintlichen Interessen für die eigene politische Agenda in Beschlag nimmt und instrumentalisiert, hilft daher weder bei der differenzierten Beschreibung noch bei der öffentlichen Verständigung über die Herausforderungen der Pandemie weiter. Es dürfte einer Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen nicht zuträglich sein, wenn öffentliche und politische Aufmerksamkeit immer wieder auf die idiosynkratischen Spekulationen von Verschwörungstheoretiker_innen und die Gedankenwelten anderer lautstarker epistemischer Gegengemeinschaften11 gelenkt wird, statt sich mit wirklich relevanten und oftmals im Vergleich eher profanen politischen Themen, ethischen Fragen und pädagogischen Aufgaben zu befassen, die als Folgen der Pandemie die Lebensrealität und den Alltag von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Selbst für distanzierte Beobachter wie den Bildungshistoriker Heinz-Elmar Tenorth markiert die Covid-19 Pandemie schließlich »eine gravierende Zäsur, eine Situation, die in der modernen Bildungsgeschichte ohne Beispiel ist.« Einerseits setzt sie »die für die Heranwachsenden und ihre Milieus zentralen Errungenschaften der Bildung in der Moderne außer Kraft« und erzeugt zugleich »in der Allpräsenz digitalisierten Lernens die Suggestion, dass diese Regression in längst überwundene Zeiten klassenspezifisch zugeteilter Bildung sich technologisch kompensieren ließe«12. So wie man mit Tenorth nicht nur berechtigte Zweifel an diesen und anderen Wirkungserwartungen bezüglich der Kompensierbarkeit der mit der Pandemie einhergehenden Verluste anmelden kann, so kann man heute – trotz aller berechtigten Skepsis – nicht mehr ernsthaft in Frage stellen, dass Kinder und Jugendliche zu den gesellschaftlichen Gruppen gehören, die durch die Folgen der Pandemie besonders belastet wurden und werden.
Im Lichte des politischen Umgangs mit der Pandemie und mit Blick auf die Gesamtheit der Corona-Maßnahmen zeigen sich strukturelle Defizite und Ungerechtigkeiten im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die es zu benennen und zu kritisieren gilt. Wie in einem »Brennglas«13 legen die Pandemie und ihr politisches Management Probleme in den Erziehungs- und Bildungswelten und Lebenskontexten von Kindern und Jugendlichen offen, die bereits vor der Pandemie bestanden haben, und – so ist begründet zu vermuten – durch diese in Zukunft weiter verschärft werden. Diese generelle Diagnose gilt es im Folgenden genauer zu konkretisieren und ethisch einzuordnen. Dabei ist angesichts der sich immer noch teilweise dramatisch schnell ändernden wissenschaftlichen Datenlage und der politischen und epidemologischen Situation zu berücksichtigen, dass hier nur eine Zwischenbilanz und keine abschließende Bewertung der Folgen der Corona-Politik für Kinder und Jugendliche gezogen werden kann.
Zu den einzelnen Kapiteln: Im ersten Teil werden einige der zentralen Ausgangspunkte und Abwägungsprobleme skizziert, die eine faire und differenzierte ethische Bewertung der Folgen der Corona-Politik für Kinder und Jugendliche zu berücksichtigen hat. Im zweiten Kapitel wird zunächst ein normativer Orientierungsrahmen vorgestellt, der die Grundlage für die ethische Bewertung in den folgenden Teilen liefert. Im dritten Teil folgt eine Diskussion der Frage, ob und inwieweit Kinder und Jugendliche im Rahmen der Corona-Politik in angemessener Weise als politische Subjekte ernst genommen wurden und was dies über den politischen Status von Kindern und Jugendlichen in Deutschland aussagt. Im vierten Kapitel werden zentrale Herausforderungen diskutiert, die die Pandemie für Demokratieerziehung und demokratische (Grund-)Bildung in und außerhalb öffentlicher Schulen darstellt. Im fünften Kapitel werden die Folgen der Pandemie für Probleme der Bildungsgerechtigkeit analysiert und im sechsten Kapitel werden einige der zentralen Funktionen, Aufgaben und Probleme rekonstruiert, die mit der Pandemie für die Institution Schule verbunden sind. Im siebten Kapitel werden weitergehende Fragen erörtert, die das Leben und Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Schulen (u.a. Familien) und damit verbundene Probleme sozialer Gerechtigkeit betreffen. Im achten Kapitel diskutiere ich ethische Probleme im Zusammenhang mit der Diskussion über das Impfen. Im neunten Kapitel werden die Erträge meiner Analyse in einer Gesamtbewertung der Folgen der Corona-Politik für Kinder und Jugendliche zusammengefasst und einige Vorschläge zur Debatte gestellt, was nun und in Zukunft zu tun ist, um ihre Situation in und nach der Pandemie zu verbessern. Ich schließe im zehnten Kapitel mit einem kurzen Ausblick.
Herzlicher Dank für hilfreiche Gespräche und Hinweise zum Thema geht an Melanie Ehren, Anders Schinkel, Johannes Giesinger, Rolf Strietholt, Monika Betzler, Meira Levinson, Sara O’Brian, Christoph Schickhardt, Monika Platz, Christian Thein, Christian Brüggemann, Christian Quast, Moritz Sowada, Douglas Yacek, Gottfried Schweiger und Tim Isenberg, sowie an zahllose andere Menschen, mit denen ich in den letzten 2 Jahren über »Corona« diskutiert habe.
Berkeley, Februar 2022
Johannes Drerup
1.Kinder in der Pandemie und die Prioritäten der Politik: Ausgangspunkte und Abwägungsprobleme
Die Art und Weise, wie Gesellschaften praktisch auf Pandemien reagieren, sagt etwas aus über ihre grundlegenden Werte und Normen und über die Zustände und Praktiken, die in ihnen gemeinhin als wünschenswert und wichtig, als richtig und angemessen gelten.14 In Extremsituationen zeigt sich, was und wer wirklich zählt. In den Kriterien, die dabei genutzt werden, und dies gilt auch in pluralistischen Gesellschaften mit der Vielzahl der in ihnen konkurrierenden normativen Betrachtungsweisen, zeigt sich, wer »wir« sind und sein wollen. Die politischen und ethischen Entscheidungen, die im Kontext von Pandemien gefällt werden, bestimmen, in was für einer Gesellschaft wir leben. Sie werden auch Folgen haben für längerfristige individuelle und kollektive Lern- und Bildungsprozesse und die Beziehungen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Generationen. Im Lichte von entsprechenden politischen und ethischen Schwerpunktsetzungen und ihren Folgen offenbaren sich gesellschaftliche Problemlagen. Dies gilt insbesondere auch im Umgang mit schwächeren und vulnerableren Gruppen, die nur in eingeschränkter Form über eine Lobby verfügen, um ihre Interessen politisch durchzusetzen. Kinder und Jugendliche galten zum Beispiel lange Zeit als »Pandemietreiber«. Schulen, die in Deutschland auch deshalb geschlossen wurden, damit andere gesellschaftliche Bereiche weiter funktionieren konnten (während sie anderswo nur kurzzeitig geschlossen wurden15 bzw. anstelle von Schulschließungen striktere Einschränkungen für Erwachsene durchgesetzt wurden), wurden vor allem als besonders problematische potentielle Seuchenherde angesehen. Man schien sich mehr um die Sicherung des Wohlstands und den Schutz anderer gesellschaftlicher Gruppen zu sorgen als um das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen,16 die mit den negativen Folgen pandemiepolitischer Maßnahmen belastet wurden. Gleichzeitig schien man nur wenig Probleme darin zu sehen, die Homeoffice-pflicht in Unternehmen zu beenden und das Business »Profi-Fußball« wieder in Gang zu bringen. Dabei wurde viel über Grundrechte und ihre Einschränkung diskutiert, wobei kaum jemand auf die Idee kam, dass vor allem auch Kinder und Jugendliche durch die Corona-Politik in ihrem Leben und ihren Rechten eingeschränkt wurden. Kinder und Jugendliche wurden eher als eine Art biopolitische Verschiebemasse betrachtet, über deren Köpfe hinweg man guten Gewissens Entscheidungen fällen konnte, und denen man mehr oder weniger beliebig gesellschaftliche Kosten der Pandemiebekämpfung aufhalsen konnte. Erst vergleichsweise spät gelang man in der öffentlichen Debatte zu der Einsicht, dass es vor allem Kinder sind, die einen großen Teil der vielfältigen, teilweise irreversiblen Kollateralschäden der Pandemie getragen haben und auch weiter tragen werden, der ihnen advokatorisch aufgebürdet wurde, ohne dass man sie nach ihrer Meinung dazu gefragt hätte. Die Fallhöhe der politischen Rhetorik (Kinder sind unsere Zukunft! Bildung als Megathema. etc.) und der realen politischen Praxis könnte kaum größer sein. Was, so lässt sich fragen, können und sollen Kinder und Jugendliche aus diesen und anderen wertgeleiteten Deutungen und Priorisierungen über die Gesellschaft, in der sie leben, und den Platz, der ihnen in dieser zukommt, lernen? Wie ist es um die Debatten über Kinderrechte und Demokratieerziehung und -bildung bestellt, wenn man sich dem Anschein nach, wenn es darauf ankommt, kaum oder gar nicht für ihre Sichtweisen und Probleme in der liberalen Demokratie interessiert? Was lernen sie über die Gesellschaft, in der sie leben, wenn in dieser vor allem zu verbuchende Lern- und Leistungsrückstände und deren längerfristige ökonomische Folgen thematisiert werden, nicht aber darüber diskutiert wird, wie es um ihr Wohlergehen bestellt ist? Was sollen sie daraus lernen, dass auch den Berufen und Tätigkeiten, die dafür zuständig sind, dass es ihnen gut geht, dass sie etwas lernen und sich gut entwickeln, oftmals nur ein geringer gesellschaftlicher Wert17 zugeschrieben wird?18 Läuft die oftmals diagnostizierte Verachtung von Pädagogik und pädagogischer Tätigkeit19 nicht am Ende auch auf eine Missachtung von Kindern und Kindheit hinaus?
Der durch diese Fragen exemplarisch dargelegte »heimliche Lehrplan«, das heißt das Ensemble der eher impliziten Wertsetzungen und nicht intendierten Lerneffekte, die Kindern und Jugendlichen durch den gesellschaftspolitischen Umgang mit der Pandemie vermittelt wurden, zieht zurecht Kritik und Ablehnung auf sich. Bei der ethischen Einordnung der angedeuteten Defizite sind jedoch Vorsicht und Sorgfalt geboten. Im Spannungsfeld zwischen den Interessen und Rechten von Kindern und Jugendlichen und den für sie zu gewährleistenden Bildungsgütern, den Interessen, Rechten und Pflichten der Eltern, gesellschaftlicher Gruppen und Verbände, des liberalen Staates und des öffentlichen Schulsystems kommt es unweigerlich zu Wert- und Verteilungskonflikten, die immer auch eingebettet sind in Kämpfe um politische Macht und Deutungshoheit. Die gesellschaftspolitische Lage während der Pandemie war und ist unübersichtlich, die empirische Datenlage teilweise schlecht, nicht eindeutig oder oftmals nur stückwerkhaft präsent20 und die ethischen Abwägungsfragen, die sich stellen, sind in der Regel hochgradig komplex und oftmals ambivalent. In der Pandemie mussten und müssen unter enormen zeitlichen Druck, auf Basis unsicherer Empirie und Ungewissheit häufig dilemmatische Güterabwägungen vorgenommen und Entscheidungen getroffen werden.21 Damit sind vielfach tragische Entscheidungen verbunden, die auch ethische und politische Kosten nach sich ziehen, die nicht alle gesellschaftlichen Gruppen in gleicher Weise betreffen und häufig nicht-intendierte Nebeneffekte haben.22 Und Dilemmata stellen sich in einer Demokratie auch mit Bezug auf die öffentliche Kommunikation und Rechtfertigung der Corona-politischen Maßnahmen ein:
»Die öffentliche Rechtfertigung der Maßnahmen muss zugeben und einrechnen, dass es Grenzen des Wissens über den Pandemieverlauf gibt, selbst bei bester epistemischer Beratung. Je ehrlicher aber diejenigen sind, die Entscheidungen unter solchen Bedingungen der Unsicherheit treffen müssen, umso prekärer wird das Vertrauensspiel. Ehrlichkeit schafft Vertrauen, der Eindruck der Orientierungslosigkeit aber gefährdet es. Eine Tugend wandelt sich auf einem schmalen Grat der politischen Wahrnehmung in eine Untugend.«23
Insbesondere mit Bezug auf Ambitionen groß angelegter bildungspolitischer Steuerungs- und Reformversuche sei zudem nicht nur an die bekannte Trägheit des Systems Schule erinnert, sondern auch daran, dass dessen Wirkungen nicht selten »paradox« sind, »nicht den politischen Intentionen« folgen und die »Komplexität des Systems der guten Absicht« oft entgegensteht24. Nicht ausgespart werden sollte außerdem, dass die Pandemie durchaus auch positive (Neben-)Effekte für einige Kinder und Jugendliche (in der Regel, aber nicht nur, aus privilegierten Elternhäusern) hatte, etwa wenn sie mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen konnten als sonst25. Zugleich muss man selbstverständlich auch berücksichtigen, dass viele der Maßnahmen und der diesen zugrundliegenden Beurteilungsmaßstäbe und Prioritätensetzungen, die die Interessen von Kindern prima facie hintenangestellt haben, häufig direkte und indirekte Folgen für Kinder haben. Wirtschaftliche Schäden zum Beispiel, oder konkreter: arbeitslose Eltern dürften in den meisten Fällen auch dem Interesse von Kindern nicht förderlich sein. Allein auf Grund der notwendigen Differenzierung zwischen Alters- und Lebenslagen verbietet sich eine kollektive Viktimisierung von Kindern als passiven Opfern eines unzureichenden Managements der Corona-Politik. Ein übermäßiger Fokus auf eine konstruierte oder reale Konkurrenz zwischen unterschiedlichen vulnerablen Gruppen dürfte einer angemessenen ethischen Beschreibung und politischen Bearbeitung der relevanten Probleme nicht zuträglich sein. Eine differenzierte ethische Analyse sollte auch deshalb von allzu simplen Problemkonstruktionen und übermäßigen normativen Eindeutigkeiten absehen und die aus den angewandten Ethiken hinlänglich bekannten Probleme und Schwierigkeiten der Anwendung allgemeiner Prinzipien auf konkrete Problemkontexte berücksichtigen: Von der ethischen Analyse, über konkrete darauf aufbauende Vorschläge zur politischen Gestaltung bis zu deren politischer Durchsetzung und praktischer Realisierung ist es ein langer und oftmals steiniger Weg. Einfache Lösungen und Patentrezepte wird es hier nur in den seltensten Fällen geben. Moralistisch gefärbte Mantras, moralisierende Slogans und die Nutzung von zuweilen kitschigen Überredungsbegriffen, die insbesondere auch in öffentlichen pädagogischen Debatten über Kinder und Kindheit weit verbreitet sind (Das Kind im Mittelpunkt etc.), dürften für ein angemessenes Verständnis ethischer Probleme wenig hilfreich sein, da sie relevante ethische Dilemmata, die sich in der Praxis unweigerlich stellen, eher kaschieren als elaborieren und damit diskutier- und bearbeitbar machen.26
Eine global angelegte vergleichende ethische Analyse der Situation von Kindern in der Pandemie ist nicht Gegenstand dieses Buchs (etwa Fragen globaler Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit)27. Der im Folgenden ausgearbeitete und angewendete ethische Orientierungsrahmen (vgl. das Folgekapitel) beruht auf einem historisch gewachsenen und kulturspezifischen ethischen Verständnis von Kindern und Kindheit28 und von einem angemessenen Umgang mit Kindern. Dieses Verständnis ist keineswegs selbstverständlich und wäre kaum möglich ohne die in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnenden moralischen Fortschritte im Umgang mit Kindern. Hierzu zählen etwa die Kodifizierung von Kinderrechten (u.a. UN Kinderrechtskonvention), der Abbau von autoritären Interaktionsverhältnissen in Richtung demokratischerer Formen der Aushandlung29, die zunehmende Anerkennung von Kindern als Subjekten und Personen30 und der Abbau von Gewalt und pädagogischen Gewaltverhältnissen in liberalen Demokratien.31 Diese aus einer ethischen Perspektive begrüßenswerten, aber keineswegs abgeschlossenen Entwicklungen einer zunehmenden Verbesserung des Umgangs mit Kindern32 haben – im historischen Vergleich – insgesamt zu einer erhöhten Sensibilität für unterschiedliche Interessen und Besonderheiten der Verletzlichkeit von Kindern geführt. Mit Bezug auf den damit einhergehenden Wandel der Erziehungsverhältnisse stellt Jürgen Oelkers fest, dass
»sich die Stellung der Kinder in der Gesellschaft grundlegend geändert hat. Kinder sind nicht mehr einfach das Objekt der Erziehung, sondern werden als Menschen mit eigenen Bedürfnissen anerkannt. Sie werden keiner fraglosen Autorität unterworfen, der sie folgen müssen, und erhalten Spielräume für Freiheiten, die noch vor dreißig Jahren kaum vorstellbar waren. Die Institutionen der Erziehung haben sich entsprechend gewandelt. Heutige Kinder erleben keinen militärischen Drill mehr, die Kinderarbeit ist abgeschafft worden, […] das Lernen hat sich verändert.«33
Weitere ethisch bedeutsame Aspekte des Umgangs mit Kindern ließen sich anfügen. Diese normativen Entwicklungen kulminieren in der Sichtweise, dass Kinder eben auch »nur Menschen« sind, das heißt aber auch: sie sind eben selbstverständlich Menschen, die als Personen genauso Respekt verdienen wie andere Menschen auch.34 Geht man so davon aus, dass Kinder als Menschen grundsätzlich den gleichen moralischen Status haben (sollten) wie Erwachsene (was natürlich ethisch gebotene Formen der unterschiedlichen Behandlung nicht ausschließt, sofern dies durch moralisch relevante Unterschiede von Fähigkeiten begründet ist35), dürfen bei relevanten bildungs- und sozialpolitischen Entscheidungen ihre Interessen nicht höher aber eben auch nicht niedriger gewichtet und bewertet werden als die anderer Menschen. Dies anzuerkennen und positiv als Fortschritt im Umgang mit Kindern zu verbuchen schließt die Möglichkeit von regressiven Entwicklungen nicht aus und entbindet nicht von der Notwendigkeit, vorbeugend bestehende Defizite in der öffentlichen Debatte zum Gegenstand der Kritik zu machen. Um eine solche Kritik jedoch angemessen zu begründen und kriteriengeleitet zu präzisieren, bedarf es eines ethischen Orientierungsrahmens, der nunmehr vorgestellt wird.
2.Bildungsgüter: ein Orientierungsrahmen
Die Frage, wie die Folgen der Pandemie und ihrer Bearbeitung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Lebensbereichen bewertet werden sollten, ist umstritten. Dies zeigt sich schon an dem Streit darüber, wie sinnvoll etwa die tradierte politische Orientierung an epidemologischen Indikatoren ist (7 Tage Inzidenz, R-Wert).36 Kritisiert wurde zudem, dass im Kampf um Deutungshoheit über die Pandemie lange Zeit vor allem wirtschaftliche Folgen bevorzugt berücksichtigt wurden.37 Ein in seinen Auswirkungen hochgradig komplexes und disparates Phänomen nur durch die Brille einer einzigen (epistemischen und normativen) Metrik und den damit verbundenen Sets an Kriterien und einer einzigen relevanten wissenschaftlichen Disziplin zu interpretieren und zu bewerten, so die berechtigte Kritik, wird den zu verhandelnden Problemen und den Menschen, die von ihnen in sehr unterschiedlicher Weise betroffen sind, kaum angemessen gerecht werden können. Ein solcher monothematischer Fokus auf epidemologische oder wirtschaftliche Faktoren allein – so wichtig diese natürlich auch sind – führt zu normativen Blickverengungen und lässt all die oftmals nicht minder existenziellen Probleme außer Acht, die sich im Schatten der Pandemie stellen. Die Frage nach den normativen Kriterien, ihrer Begründung, Anwendung und auch politischen Durchsetzung stellt sich selbstverständlich auch im Rahmen einer ethischen Bewertung der Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche. Auch hier existieren eine Reihe von unterschiedlichen Metriken und damit verbundenen moralphilosophischen Ansätzen, die teilweise in Konkurrenz zueinander stehen und sich teilweise aber auch ergänzen (etwa Ansätze, die den primären Fokus auf die Rechte von Kindern legen; unterschiedliche Konzeptionen des guten Lebens und des Wohlergehens von Kindern).
Ausgangspunkt der folgenden Analyse ist der von einem Team von Philosophen und Sozialwissenschaftlern – Harry Brighouse, Helen Ladd, Susanna Loeb und Adam Swift – konzipierte Bildungsgüteransatz, der als normativer Orientierungsrahmen für die empirisch informierte Bewertung von bildungs- und sozialpolitischen Entscheidungen und ihren Folgen in unterschiedlichen Anwendungskontexten entwickelt wurde (zum Beispiel Fragen der Schulfinanzierung, der Schulautonomie oder auch der staatlichen Regulierung religiöser Schulen38