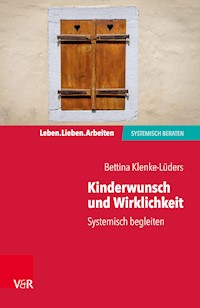
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben. Lieben. Arbeiten: systemisch beraten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Achterbahn der Gefühle im Vier-Wochen-Takt. Wenn das Natürlichste der Welt nicht klappt, kann die systemische und transgenerative Kinderwunschberatung ungewollt kinderlose Menschen ressourcenorientiert begleiten und stabilisieren. Ungewollt kinderlos – in ihren Grundfesten erschütterte Menschen spüren Scham und Ohnmacht, alte biographische Wunden brechen auf. Der Kinderwunsch als privates, politisches, ethisches und vor allem kontrovers diskutiertes Thema hinsichtlich der Reproduktionsmedizin erfordert eine eigene Haltung der Betroffenen. Die Autorin zeigt die Aktualität des Diskurses und zeigt anhand von verschiedenen Konstellationen in Praxisbeispielen, wie Singles und Paare aktiv ihre Werte, Wünsche und Vorstellungen prüfen und abwägen können. Auf diese Weise kann die Sehnsucht nach einem Kind als Ressource gesehen werden und prozesshaft als Fingerzeig für eine lebenswerte Gestaltung des Alltags genutzt werden. Ein Kind ist nicht zu ersetzen, aber auch ohne Kind gelingt ein glückliches Leben. Dieser Band richtet sich an Therapeutinnen, Berater, Coaches, alle Betroffenen und ihre Angehörigen. Systemische Methoden und eine transgenerationale Perspektive, zum Beispiel durch die Einbindung des Wunschkindes in das Familiensystem, sind gute und erfolgreiche Begleiter in der Beratung von Klientinnen und Klienten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leben.Lieben.Arbeiten
Herausgegeben von
Jochen Schweitzer und
Arist von Schlippe
Bettina Klenke-Lüders
Kinderwunsch und Wirklichkeit
Systemisch begleiten
Mit einer Tabelle
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei,
Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: André Straub/heimatlichter.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6088
ISBN 978-3-647-99427-7
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Vorwort
Einführung
I Der Kontext
1.1Der unerfüllte Kinderwunsch als Wendepunkt in der Biografie
1.2Das Nicht-Ereignis und die Trauer
1.3Das Wunschkind als Systemmitglied
•Erste Fallgeschichte: Lena – Kinderwunsch und Karriere
1.4Die Kinderwunschspirale und das System Reproduktionsmedizin
1.5Ungewollte Kinderlosigkeit und Beratung
1.6Wenn das Private politisch wird
II Die systemische Beratung
2.1Ambivalenz in der Kinderwunschzeit
•Zweite Fallgeschichte: Hanna und Stephan – Einseitiger Kinderwunsch und Paardynamik
2.2Das Innere Kind zwischen Parentifizierung und Individuation
2.3Die Sehnsucht als Fingerzeig für das Leben im Augenblick
•Dritte Fallgeschichte: Ehepaar Weiß – Kinderwunsch und Adoption
2.4Anonymität und Tabu im Rahmen der Gametenspende
2.5Perspektivenwechsel Wunschkind
• Vierte Fallgeschichte: Anna & Gülan – Kinderwunsch und Konkurrenz
2.6Kinderwunsch als System
III Am Ende
Fazit
Literatur
Nützliche Informationen und Links
Die Autorin
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe »Leben. Lieben. Arbeiten: systemisch beraten« befasst sich mit Herausforderungen menschlicher Existenz und deren Bewältigung. In ihr geht es um Themen, an denen Menschen wachsen oder zerbrechen, zueinanderfinden oder sich entzweien und bei denen Menschen sich gegenseitig unterstützen oder einander das Leben schwermachen können. Manche dieser Herausforderungen (Leben.) haben mit unserer biologischen Existenz, unserem gelebten Leben zu tun, mit Geburt und Tod, Krankheit und Gesundheit, Schicksal und Lebensführung. Andere (Lieben.) betreffen unsere intimen Beziehungen, deren Anfang und deren Ende, Liebe und Hass, Fürsorge und Vernachlässigung, Bindung und Freiheit. Wiederum andere Herausforderungen (Arbeiten.) behandeln planvolle Tätigkeiten, zumeist in Organisationen, wo es um Erwerbsarbeit und ehrenamtliche Arbeit geht, um Struktur und Chaos, um Aufstieg und Abstieg, um Freud und Leid menschlicher Zusammenarbeit in ihren vielen Facetten.
Die Bände dieser Reihe beleuchten anschaulich und kompakt derartige ausgewählte Kontexte, in denen systemische Praxis hilfreich ist. Sie richten sich an Personen, die in ihrer Beratungstätigkeit mit jeweils spezifischen Herausforderungen konfrontiert sind, können aber auch für Betroffene hilfreich sein. Sie bieten Mittel zum Verständnis von Kontexten und geben Werkzeuge zu deren Bearbeitung an die Hand. Sie sind knapp, klar und gut verständlich geschrieben, allgemeine Überlegungen werden mit konkreten Fallbeispielen veranschaulicht und mögliche Wege »vom Problem zu Lösungen« werden skizziert. Auf unter 100 Buchseiten, mit etwas Glück an einem langen Abend oder einem kurzen Wochenende zu lesen, bieten sie zu dem jeweiligen lebensweltlichen Thema einen schnellen Überblick.
Die Buchreihe schließt an unsere Lehrbücher der systemischen Therapie und Beratung an. Unsere Bücher zum systemischen Grundlagenwissen (1996/2012) und zum störungsspezifischen Wissen (2006) fanden und finden weiterhin einen großen Leserkreis. Die aktuelle Reihe erkundet nun das kontextspezifische Wissen der systemischen Beratung. Es passt zu der unendlichen Vielfalt möglicher Kontexte, in denen sich »Leben. Lieben. Arbeiten« vollzieht, dass hier praxisbezogene kritische Analysen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ebenso willkommen sind wie Anregungen für individuelle und für kollektive Lösungswege. Um klinisch relevante Störungen, um systemische Theoriekonzepte und um spezifische beraterische Techniken geht es in diesen Bänden (nur) insoweit, als sie zum Verständnis und zur Bearbeitung der jeweiligen Herausforderungen bedeutsam sind.
Wir laden Sie als Leserin und Leser ein, uns bei diesen Exkursionen zu begleiten.
Jochen Schweitzer und Arist von Schlippe
Vorwort
Wofür bekommen Menschen Kinder? Historisch scheint diese Frage nicht schon immer gestellt worden zu sein. Kinder zu zeugen, auszutragen, zu gebären und sie dann mit unterschiedlich großem Engagement in ihr Leben zu begleiten, ist über viele Jahrhunderte eine unhinterfragte und un-hinterfragbare Praxis gewesen. Erst die Moderne mit einer kinderunabhängigen wirtschaftlichen Alterssicherung durch Rentensysteme, später dann seit den Jahren 1964–1968 mit der breiten Verfügbarkeit von empfängnisverhütenden Mitteln, hat dies geändert, hat Kinder zu bekommen zu einer abwählbaren Wahlmöglichkeit gemacht.
Offensichtlich wird in den meisten reichen Industrieländern seit 1968 die Frage nach dem „Wofür Kinder?“ sehr häufig mit „Wir brauchen keine Kinder!“ beantwortet. Denn die Zahl der Geburten pro Frau liegt in diesen Ländern meist zwischen 1 und 2 Kindern, ist also unter den Wert von 2,0 gesunken, bei dem eine Gesellschaft sich auf konstantem Niveau biologisch reproduziert. Anders ist die Lage in den meisten ärmeren Ländern der Welt, in denen Kinder für die Alterssicherung ihrer Eltern eingeplant sind und in denen der Zugang zur Empfängnisverhütung schwieriger ist. Dort werden deutlich mehr als zwei Kinder pro Frau geboren. Diese beiden gegenläufigen Entwicklungen vernetzen sich im Phänomen der internationalen Migration: Menschen aus geburtenreichen, aber ökonomisch armen Ländern wandern aus in geburtenschwache, aber ökonomischreiche Länder. Und sie sorgen dort für einigermaßen ausgeglichene demographische Verhältnisse, also für ähnlich viele junge wie alte Menschen und für genügend „Nachschub“ sowohl bei den Arbeitskräften wie beim inländischen Konsum.
Damit könnte eigentlich alles gut sein. Ist es aber nicht. Zum einen fehlt es den fremdenfeindlichen Bevölkerungsgruppen in den reichen Industrieländern an der Wahrnehmung, dass auch sie ihren hohen Lebensstandard u. a. in Gastronomie, Landwirtschaft und Pflege vorwiegend jungen Migranten verdanken. Zum anderen driften in geburtenschwachen, aber ökonomisch reichen Ländern die biologische und die sozial-ökonomische Entwicklung (oder anders gesagt: das biologische und das soziale Alter) von Frauen und Männern im zeugungs- und gebärfähigen Alter zunehmend auseinander. Die Autorin dieses Buches beschreibt das im Kapitel „Wenn das Private politisch wird“: „Biografisch gesehen, liegen die fruchtbarsten Jahre der Frau zwischen 20 und 25 Jahren … Insgesamt bis zum dreißigsten Lebensjahr haben Frauen gute Aussichten, schwanger zu werden, danach sinkt die Chance, zunächst schrittweise, nach Beendigung des 38 Lebensjahres allerdings bereits rapide. Durchschnittlich mit 41 Jahren endet die natürliche Fruchtbarkeit der Frau … Die steigende Lebenserwartung verändert den Lebenszyklus, das „fruchtbare Fenster“ aber verändert sich trotz aller medizinischen Fortschritte nicht.“ Und im Kapitel „Ungewollte Kinderlosigkeit und Beratung“ schreibt sie: „In den Industrieländern sind Frauen heutzutage älter als 30 Jahre, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt bringen. Zum Vergleich: in den 1970er Jahren waren Erstgebärende im Schnitt zwischen 24 und 26 Jahren alt.
Diese Entwicklung verschärft ein Problem, das es schon immer gab, aber nicht im selbem Ausmaß wie heute: den „unerfüllten Kinderwunsch“. Frauen werden in einem zu nehmend ungünstigen (hohen) Alter Mutter – und immer häufiger wollen sie Mutter werden, werden es aber aus biologischen Gründen nicht. Für dieses Problem hat die Moderne Medizin eine Lösung entwickelt: die „assistierte Reproduktion“ oder „Reproduktionsmedizin“. Diese lindert das Problem, löst es aber maximal zu 50 %, weil viele reproduktionsmedizinische Versuche fehlschlagen. Vieles spricht insofern dafür, dass es in den Industrieländern bestenfalls halb so viel Reproduktionsmedizin gäbe, wenn Frauen und auch Männer früher Eltern würden.
Zur Reproduktionsmedizin als einem Teilgebiet der Frauenheilkunde hat sich die psychosoziale Kinderwunschberatung als ergänzende „Psycho-Disziplin“ entwickelt. Dieses Buch stellt eine außerordentlich differenzierte Einführung in die individualpsychologischen, paar- und familiendynamischen, sozialen und sozialökonomischen Aspekte des unerfüllten Kinderwunsches dar. Eine Besonderheit des Buches ist es, „das Wunschkind als Systemmitglied“ zu benennen und zu verstehen: auch ein Kind, das nicht auf die Welt kommt, obwohl es dort erwartet wird, ist psychologisch bereits zum Familienmitglied geworden. Auch ein „Nicht-Ereignis“ wie eine Schwangerschaft, die gar nicht zustande kam, kann große Trauer auslösen. Auch ein unerfüllter Wunsch wie der, ein Kind zur Welt zu bringen, kann zum Wendepunkt in einer Biografie werden. Diese Sichtweise hilft Trauer und Verzweiflung über eine Nicht-Schwangerschaft leichter zu verstehen und zu akzeptieren.
Das Buch schildert ein breites, kreatives, originelles, maßgeschneidertes Spektrum unterstützender Beratungspraktiken und beschreibt diese sehr anschaulich. Mit den vier Fallgeschichten wird es auch für Menschen, die selbst eine Kinderwunsch-Beratung suchen, zu einer wertvollen Ressource. Die Pharmareferentin Lena muss ein Schwangerschafts-Hindernis in Form des eingeschränkten Spermiogramms ihres 10 Jahre älteren Partners akzeptieren. Ihr hilft die Selbstmitgefühlsfrage: „Wenn ich es gut mit mir meine, was würde ich jetzt tun?“. Die sich ein Kind sehnlich wünschende Hanna verbindet sich ständig mit Partnern, die ihren Kinderwunsch nicht teilen; dies zu erkennen und die Absage des derzeitigen Partners an den Kinderwunsch wahrzunehmen, zu akzeptieren, und sich dann mit wenig Groll und Hader von ihm zu trennen, ist hier die bestmögliche Lösung. Das Ehepaar Weiß entscheidet sich nach vielen gescheiterten Fertilisierungs-Versuchen, nach sorgfältiger Klärung der eigenen Motivlagen schließlich für eine Adoption. Anna und Gülan, zwei Frauen aus zwei verschiedenen Herkunfts-Kulturen, die beide ihr lesbisches Coming-Out erfolgreich hinter sich gebracht haben, ringen darum, wer von ihnen beiden das Austragen einer donogenen Insemination mit vielen Hindernissen übernehmen und durchstehen darf.
Dem Buch kommt zugute, dass die Autorin von ihrer Grundausbildung her Politologin ist, die sich zugleich durch Weiterbildung und lange Beratungs-Praxis ein breites Gerüst paar- und familiendynamischer Konzepte und Methoden angeeignet und diese tief durchdrungen hat. So thematisiert sie vieles, an das die Leserin oder der Leser nicht sofort gedacht hat: die unerfüllten Erwartungen der Noch-Nicht-Großeltern; die Stigmatisierungserfahrungen von Menschen in alternativen Familienformen; die Parentifizierungen, Belastungen und Ressourcen potentieller Eltern durch eine eigene unglückliche Kindheit mit unzureichend unterstützenden Eltern; die Sehnsüchte, die enttäuscht und daher früher oder später verabschiedet werden müssen.
Eine Frage würde ich der Autorin am Ende dieses Vorwortes gerne noch stellen. Sie schreibt in ihrer Einführung: „In Deutschland wünscht sich rund ein Viertel der kinderlosen Frauen und Männer zwischen zwanzig und fünfzig ein Kind (…) In absoluten Zahlen bedeutet dies: 1,4 Millionen Menschen wünschen sich sehnlich ein Kind, doch es klappt nicht“.
Demnach wünschen sich Dreiviertel der Kinderlosen, in absoluten Zahlen 4,2 Millionen Frauen und Männer zwischen zwanzig und fünfzig Jahren kein Kind! Wie schaffen die das? Wie unterscheiden diese gewollt Kinderlosen sich in ihren Sehnsüchten, Beziehungen und Lebenslagen von jenen, die an der Kinderlosigkeit leiden? Würden sich aus solchen Erkenntnissen auch nützliche Hinweise für die psychosoziale Kinderwunschberatung ergeben? Alle anderen Fragen zum Thema hat mir das Buch bereits beantwortet.
Jochen Schweitzer
Einführung
Ungewollte Kinderlosigkeit führt zu einer tiefgreifenden Veränderung des Alltags. Es fühlt sich an wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle im vier Wochentakt. In Deutschland wünscht sich rund ein Viertel der kinderlosen Frauen und Männer im Alter zwischen zwanzig und fünfzig Jahren ein Kind – und dies teilweise schon seit Jahren. Jedes sechste bis siebte Paar hat Schwierigkeiten ohne ärztliche Unterstützung schwanger zu werden. In absoluten Zahlen bedeutet dies: 1,4 Millionen Menschen wünschen sich sehnlich ein Kind, doch es klappt nicht. Viele Menschen stürzen dann in eine Krise. Sie ringen mit einer ambivalenten Gefühlswelt aus Hoffnung und Sehnsucht auf der einen Seite und Verzweiflung und Trauer auf der anderen Seite.
Die Angst vielleicht niemals Mutter oder Vater werden zu können, wird häufig als ein massiver Kontrollverlust erlebt, individuell und im gemeinsamen Erleben als Paar. Bisher unbekannte und heftige Neidgefühle auf andere schwangere Frauen, Wut über das Versagen des eigenen Körpers und Angst vor der ungewissen Zukunft sind dabei die schwierige emotionale Gemengelage, mit denen ungewollt kinderlose Menschen kämpfen. Und dies häufig im Stillen, denn die ungewollte Kinderlosigkeit ist schambesetzt, gesellschaftlich mit vielen Vorurteilen und Fehlinformationen behaftet – das Thema ungewollte Kinderlosigkeit ist ein Tabu.
Wenn das Natürlichste der Welt nicht so einfach klappen mag, löst dies Ohnmacht aus und verändert das Leben von Grund auf. In der systemischen Beratung und Familientherapie können wir diese in ihren Grundfesten erschütterten Menschen ressourcenorientiert begleiten und stabilisieren. Eine systemische und mitunter auch transgenerative Gesamtperspektive ermöglicht neue Betrachtungsweisen: Einen Kinderwunsch hat niemand für sich allein. Die Familienplanung ist beeinflusst durch das soziale Umfeld, biografische Erlebnisse und während der eigenen Kindheit und Jugend verinnerlichten Werte. Streckenweise führt die Vorstellung eines idealen Familienlebens dann auch über alte Verletzungen und biografische Wunden. So birgt der Kinderwunschweg das Potential für ein tieferes Verständnis der eigenen Vergangenheit und ermöglicht gleichzeitig auch Veränderungsprozesse in der aktuellen Lebensgestaltung.
Der Wunsch nach einem Kind ist ein privates, sehr persönliches und auch intimes Thema. Diese Sehnsucht macht nicht Halt vor einer Geschlechtsidentität oder Konstellation der Partnerschaft, sodass ich auf eine gendersensible Sprache geachtet habe. Falls eine neutrale Form nicht möglich war, mögen sich bitte alle mitgemeint fühlen.
Jede Sehnsucht ist von Anfang an bezogen auf das Ersehnte. Das imaginierte und erwünschte Kind ist Teil eines Systems der Hoffenden; selbst wenn es noch nicht in die Welt geboren ist und seinen tatsächlichen Platz beansprucht, hat es bereits Raum eingenommen. So ist auch verständlich, warum die Trauer um ein bisher ungeborenes Kind so real ist, sich ganz so wie die Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen anfühlen kann. Diese Trauer aber bleibt in vielen Fällen unbemerkt vom sozialen Umfeld, da ungewollt kinderlose Menschen häufig aus Scham und Angst vor Stigmatisierung über ihr Leid schweigen. Bleibt aber die ersehnte Schwangerschaft aus, und ist dies nach einem Jahr noch immer so, obwohl das Paar regelmäßig und ungeschützt miteinander schläft, definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die ungewollte Kinderlosigkeit als Krankheit. Dabei ist es nicht entscheidend, ob tatsächlich eine medizinische Diagnose vorliegt oder eine sogenannte idiopathische Sterilität attestiert wird, also auch nach eingehender medizinischer Abklärung weder bei der Frau noch bei dem Mann eine medizinische Ursache für die ungewollte Kinderlosigkeit gefunden werden kann.
Die Diagnose Unfruchtbarkeit verunsichert Frauen und Männer gleichermaßen in ihrem Kern, dies unabhängig von der Frage, ob sie eine medizinische Erklärung in den Händen halten oder nicht. Krank sind viele Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch in einem chronischen Sinne bis dato noch nie gewesen und eine solche Kategorisierung als Krankheit in einem sensiblen Bereich, der auch die Sexualität tangiert, ist fatal. Insbesondere Männer setzen Fruchtbarkeit noch immer mit Potenz gleich, sodass ihr Selbstwert durch die ungewollte Kinderlosigkeit häufig mit großer Wucht getroffen wird, egal ob sie ein eingeschränktes Spermiogramm in den Händen halten, gänzlich steril sind oder keine medizinische Ursache gefunden werden kann. Gerade noch gesund, nun, ohne sich so zu fühlen, krank, seiner Intimsphäre beraubt und der Scham ausgeliefert, vielleicht kein ganzer Kerl zu sein. Frauen finden das Äquivalent dieser quälenden Gedanken in der Frage, ob sie überhaupt eine Frau sind, wenn sie keine Kinder bekommen können. Diese Gefühle entfalten eine Wucht, die den Selbstwert eines Menschen erschüttern können.





























