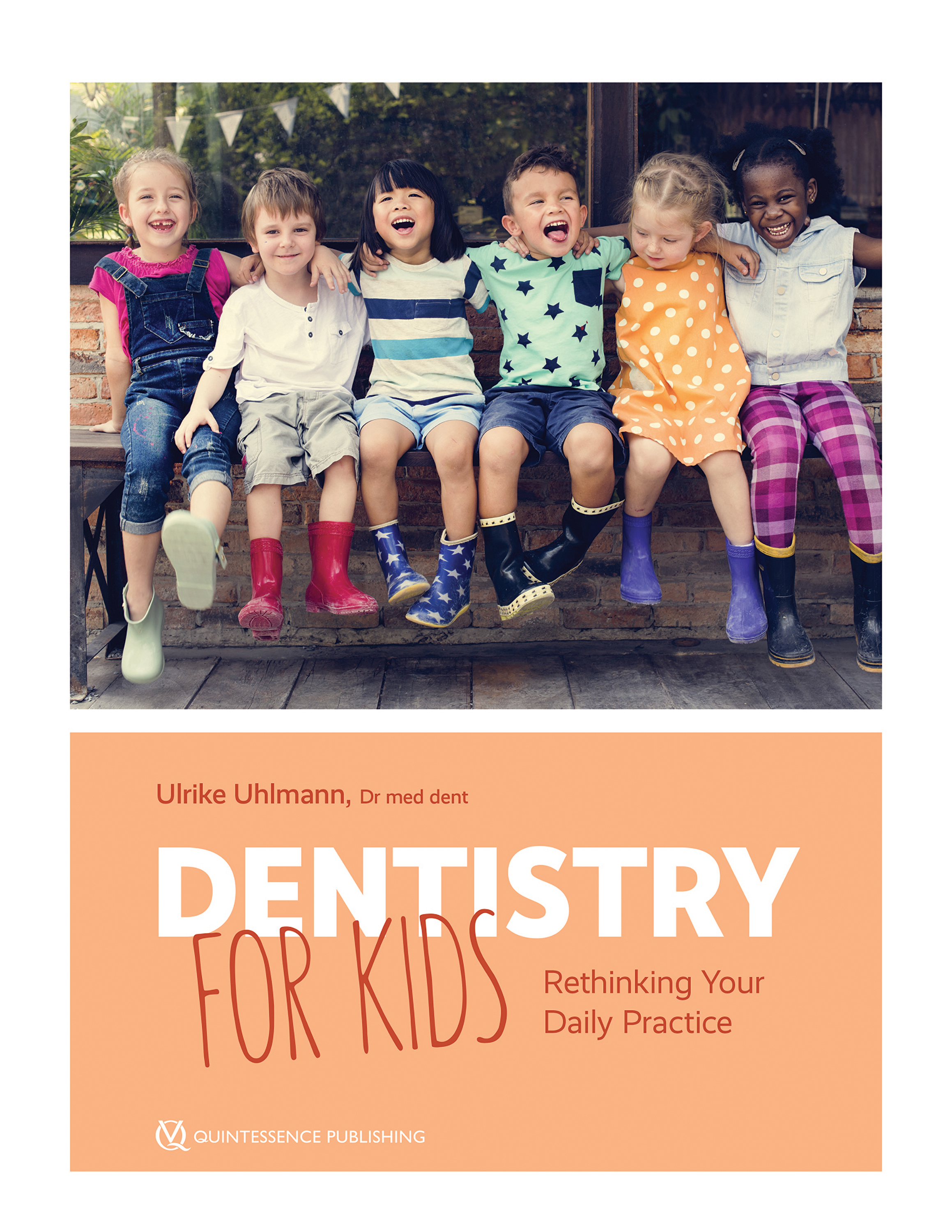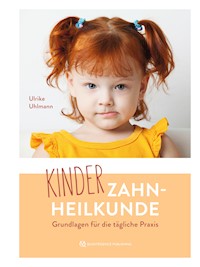
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quintessence Publishing
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit all ihren Facetten der Zahnheilkunde, der Kieferorthopädie, der Ernährungswissenschaften und nicht zuletzt auch der Psychologie vereint die Kinderzahnheilkunde eine Vielzahl von Themen in sich. Darin liegen Chance, Herausforderung und Verantwortung zugleich, um den kleinsten unter den Patienten einen optimalen Start in ein möglichst zahngesundes Leben zu ermöglichen. Dieses Buch ist als Einstieg in die Kinderzahnheilkunde gedacht und liefert dafür grundlegendes und kompakt zusammengestelltes Wissen. Es gibt zunächst Tipps für die Kommunikation mit den kleinen Patienten und deren Eltern, liefert wichtige Hinweise im Bereich Diagnostik und Befunderhebung und erläutert im umfangreichsten Kapitel die aktuellen Behandlungsmethoden in der Kinderzahnheilkunde. Zudem werden häufige Fragestellungen der Eltern besprochen und der interdisziplinäre Blick über den Mund hinaus geschärft. Damit dient das Buch allen Zahnmedizinern und besonders Berufseinsteigern als nützliches Nachschlagewerk im Praxisalltag und bei speziellen Fragestellungen in der Kinderzahnheilkunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrike Uhlmann
Kinderzahnheilkunde
Grundlagen für die tägliche Praxisa
Titelbild: © avdeev007 | iStockphoto.com
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Postfach 42 04 52; D–12064 Berlin
Ifenpfad 2–4, D–12107 Berlin
© 2019 Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Lektorat: Dr. Viola Lewandowski, Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin
Herstellung und Reproduktionen: Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-86867-629-7
Prolog
Als ich 2010, kurz nach dem Start in meine Assistenzzeit in die Kinderzahnheilkunde mehr oder weniger hineingeschubst wurde, war die erste Zeit geprägt durch eine Aneinanderreihung von kleinen Überforderungen. Natürlich hatte man im Studium gelernt, wie eine Pulpotomie funktioniert, aber kaum einer hatte auch wirklich die Chance, kleine Patienten selbst zu behandeln.
Viele Fragen tauchen erst am Horizont auf, wenn der kleine Patient bereits vor einem sitzt. Als unerfahrener Zahnarzt* ist man dann ständig mit Situationen konfrontiert, die die eigene Komfortzone sprengen. Gerade Kinder haben ein feines Gespür für ihr Gegenüber und man merkt als Behandler sehr schnell, dass sich Erfolge umso eher einstellen, je sicherer und zielstrebiger man selbst agiert. Damals habe ich vor allem von Kollegen profitiert, die ihre langjährige Erfahrung im Rahmen von Hospitationen und Weiterbildungen geteilt haben.
Dieses Buch soll als Einstieg in eines der schönsten Tätigkeitsfelder der Zahnheilkunde dienen. Es kann und soll keine Weiterbildung ersetzen, sondern einen Einblick in dieses vielfältige Fach bieten und Interesse wecken. Ich hoffe, damit eine Grundbasis an Wissen gebündelt weitergeben zu können, die einem die ersten Schritte auf dem Gebiet der Kinderzahnheilkunde erleichtern. Der Aufbau des Buches orientiert sich dabei chronologisch an einer Behandlungssitzung: Der Erfolg einer Behandlung steht und fällt mit der richtigen Kommunikation, anschließend finden Untersuchung und Diagnostik statt. Daran schließen sich verschiedene Behandlungen an und schließlich werden die Eltern umfassend aufgeklärt und die kleinen Patienten in einen erfolgreichen Recall eingebunden.
Egal ob frisch examiniert oder schon jahrelang im Job – für viele Kollegen sind Kinderpatienten ein rotes Tuch. Dabei müssen gerade Kleinkinder verstärkt in den Fokus rücken. Denn insgesamt haben wir zwar seit Jahren einen kontinuierlichen Rückgang der Karies zu verzeichnen, aber bei den Kleinkindern sieht die Lage leider anders aus. Mit den seit 2017 gültigen, rechtsverbindlichen Verweisen auf den notwendigen Zahnarztbesuch ab dem 6. Lebensmonat werden hoffentlich vermehrt kleine Kinder Zugang zur Zahnarztpraxis finden. Mit dieser, für einige Zahnärzte auch neuen Patientengruppe tauchen einige Fragen auf: Wie untersucht man ein 6 Monate altes Baby? Welche Themen spricht man bei den Eltern an? Systemische Fluoridprophylaxe oder lokal? Ab welchem Alter kann es sinnvoll sein zu röntgen? Wie gehe ich mit schwierigen oder wie Kinderzahnärzte gerne sagen „interessanten“ Kindern um? Auch die Eltern konfrontieren den Behandler mit einer Vielzahl von Fragen – vom Zeitpunkt des Zahndurchbruchs an über Zahnungsbeschwerden und Empfehlungen für Beruhigungssauger bis hin zu Tipps und Tricks für die tägliche Mundhygiene in den verschiedenen Altersgruppen.
Die Kinderzahnheilkunde vereint mit allen Facetten der Zahnheilkunde, der Kieferorthopädie, den Ernährungswissenschaften und nicht zuletzt auch mit der Psychologie eine Vielzahl von Themen in sich. Darin liegen Chance, Herausforderung und Verantwortung zugleich. Wir als Behandler müssen sicherstellen, dass die Kleinsten unter unseren Patienten einen optimalen Start in ein möglichst zahngesundes Leben bekommen. Die besondere Herausforderung liegt hierbei natürlich nicht nur in der Compliance der Kinder, sondern vor allem auch darin begründet, dass Kinder nicht allein für ihre (Mund-)Gesundheit verantwortlich sein können. Unsere Aufgabe ist es also, auch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten aufzuklären, zu motivieren und zu unseren Komplizen zu machen. Ein guter Draht zu den Eltern garantiert nicht nur eine langfristige Patientenbindung über das Kindesalter hinaus, sondern ist auch ganz entscheidend für die Mundgesundheit der Kinder. Nur wenn der Behandler es schafft, kleine Patienten richtig zu behandeln und die Eltern aufzuklären, wird es nachhaltig gelingen, zur Zahngesundheit der Kinder langfristig beizutragen. Auch im Hinblick auf die Kommunikation mit den Eltern soll dieses Buch fachliche sowie praktische Tipps liefern. Nicht zuletzt soll es auch die Verantwortung aufzeigen, die mit der Kinderbehandlung einhergeht. Vor allem aber soll der Leser Lust bekommen auf dieses vielseitige Gebiet der Zahnheilkunde.
__________
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text das generische Maskulinum verwendet. Natürlich sollen sich auch alle Leserinnen angesprochen fühlen.
Danke
An der Entstehung dieses Buches haben viele Menschen Anteil. Ein großer Dank geht an Anita Hattenbach und Dr. Viola Lewandowski für das Lektorat, die ständige Erreichbarkeit und das stets offene Ohr für Fragen oder Anregungen. Ein besonderer Dank gilt außerdem Frau PD Dr. Dr. Christiane Gleissner (Mainz), die motiviert, Zweifel ausgeräumt und aus Sicht der allgemeinzahnärztlich tätigen Kollegin das Manuskript gelesen und wichtige Anregungen beigesteuert hat.
Danke auch an all die Kolleginnen und Kollegen, die zahlreiche Bilder aus dem Praxisalltag zur Verfügung gestellt haben und dieses Buch damit in hohem Maße unterstützt haben. Dazu gehören: Dr. Gabriele Viergutz (Dresden), die nicht nur zahlreiche Bilder, sondern auch wichtige Anregungen beigesteuert hat, sowie Dr. Richard Steffen (Zürich), der völlig selbstverständlich Bildmaterial aus seinem Onlineatlas bereitgestellt hat. Ein Dank geht auch an Dr. Jorge Casián Adem (Poza Rica de Hidalgo), der mit seinen qualitativ hochwertigen Fotos tolle Dokumentationen zur Verfügung stellte; außerdem ein herzliches Dankeschön an Dr. Nicola Meißner (Salzburg) für ihre Fotoserien und Bemühungen. Danke auch an Prof. Dr. Katrin Bekes (Wien), Claudia Lippold (Halle), Dr. Juliane von Hoyningen-Huene MSc (Berlin), ZTM Peter Schaller (München), Dr. Bobby Ghaheri (Oregon), Dr. Dr. Matthias Nitsche (Leipzig) und Prof. Dr. Roswitha Heinrich-Weltzien (Jena) für ihre Fotos. Auch Sabine Fuhlbrück (Leipzig) gebührt ein großer Dank für die bereitgestellten Bilder und ihren unermüdlichen Einsatz bei der myofunktionellen Therapie. Ein weiterer Dank muss Dr. Silvia Träupmann (Leipzig) gelten, die mit ihrer Leidenschaft für die Kinderzahnheilkunde und ihrer Erfahrung immer ein offenes Ohr für junge Kollegen hat, die erste Ideensammlung gelesen und korrigiert hat und immer Ansprechpartner und Vorbild für mich war und ist. Danke auch an Manuela Richter, die als sehr erfahrene Zahnarzthelferin in der Kinderzahnheilkunde meine ersten, vorsichtigen Schritte in diesem Fachgebiet begleitet und unterstützt hat. Ein herzliches Dankeschön auch an Birgit Wolff für motivierende Worte immer dann, wenn sie gebraucht wurden.
Im Zuge der Entstehung dieses Buches hatte ich mit vielen inspirierenden Kollegen und Kolleginnen Kontakt, wodurch ich meinen Horizont beständig erweitern konnte und viel gelernt habe – auch dafür bin ich dankbar.
Last but not least Danke an meinen Mann, der dieses Projekt von Anfang an unterstützt hat, der mich immer wieder motiviert und mir den Rücken freihält. Ohne ihn würde es nicht nur dieses Buch nicht geben. Danke.
Dr. med. dent. Ulrike Uhlmann
Tätigkeitsschwerpunkt in Kinder- und Jugendzahnheilkunde
Leipzig, im Februar 2019
Autorin
Ulrike Uhlmann wurde 1986 im Vogtland geboren und hat an der Universität Leipzig von 2005 bis 2010 Zahnmedizin studiert. Schon während des Studiums zeichnete sich ein besonderes Interesse für die Kinderzahnheilkunde ab. Nach ihrem Examen 2010 arbeitete sie vier Jahre in Halle/Saale und lernte während dieser Zeit das gesamte Spektrum der Kinderzahnheilkunde kennen und lieben. Auch die interdisziplinäre Arbeit mit Hebammen, Kinderärzten und Logopäden war und ist wichtiger Bestandteil ihrer Berufsauffassung. Zurzeit ist sie als angestellte Zahnärztin in einer Familienzahnarztpraxis in Leipzig tätig. Als Referentin bildet sie außerdem Hebammen, Logopäden, Erzieher und andere verwandte Berufsgruppen im Bereich der Kinderzahnheilkunde fort. Zusammen mit einer Leipziger Hebammenpraxis hat sie außerdem einen Elternworkshop ins Leben gerufen, wo Schwangere und auch Eltern umfassend über alle relevanten Themen rund um die kindliche Mundgesundheit aufgeklärt und sensibilisiert werden. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.
Inhalt
Prolog
Danke
1 Einleitung und Basics
Aufbau von Milchzähnen
Mineralisations- und Durchbruchszeiten
Karies als multifaktorielle Erkrankung
2 Kommunikation
Nonverbale Kommunikation, individuelle Sicherheitsräume und Annäherung
Verbale Kommunikation – die richtige Wortwahl
Tell-Show-Do-Methode
Verschiedene Patiententypen
3 Die zahnärztliche Untersuchung und Tipps zur Steigerung der Compliance
Wie untersucht man ein Baby?
Auch Babys werden größer
Aufmerksamkeitsspanne, Compliancesteigerung
4 Diagnostik in der Kinderzahnheilkunde
„Ich sehe was, was Du nicht siehst“
Röntgendiagnostik
„Weichgewebe formt Hartgewebe“ oder: Warum myofunktionelle Diagnostik so wichtig ist
5 Befunde
Gesicht und Muskulatur
Befunde der Mundschleimhaut
Zähne
Kiefer-/Zahnfehlstellung
Behandlungsplan als Konsequenz der Befunde
6 Behandlung
Allgemeine Aspekte der Kinderbehandlung
Nichtinvasive Behandlungstechniken
Remineralisierung initialer Zahnhartsubstanzdefekte
Mikroinvasive Behandlungen
Kariesinfiltration
Kariesversiegelung
Fissurenversiegelung
Minimalinvasive und invasive Behandlungen von Milchzähnen
Nichtrestaurative Karieskontrolle
Füllungstherapie
Kronenversorgung im Milchgebiss
Grundsätze der Karies- und endodontischen Therapie
Chirurgische Interventionen
Besondere Herausforderungen in der alltäglichen Praxis
Antibiotika bei Kindern
Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)
Amoxicillin + Clavulansäure
Amoxicillin
Clindamycin
Doxycyclin
Andere Behandlungsformen
Möglichkeiten der Sedierung
Die Intubationsnarkose (ITN)
Behandlungshilfen
Trockenlegung
Mundöffnung
Homöopathie und Akupressur
Fälle für den Spezialisten
7 Prophylaxe: Recall und Aufklärung
Die Organisation der Kinderprophylaxe in der Zahnarztpraxis
Die Aufklärung der Eltern
8 Themen, die Eltern bewegen
„Mein Kind knirscht“
Fragen rund um den Zahndurchbruch
Schnuller oder Daumen?
Karies durch Stillen?
Die Sache mit dem Trinken …
Zähneputzen als Kampf zwischen Eltern und Kind
9 Formelles und Juristisches
Praxisbezogene Vorbereitungen
Formelle Vorbereitungen
Juristische Aspekte
10 Epilog
1
EINLEITUNG UND BASICS
„Only those who attempt the absurd can achieve the impossible.“
(Albert Einstein)
Kinder, egal welchen Alters, können alles sein: Überforderung, Bereicherung, Grund zum Schmunzeln, aber auch die Ursache für die ein oder andere Schweißperle. Besonders in der zahnärztlichen Prophylaxe und Behandlung ist es daher notwendig, sich auf die kleinen Patienten einzustellen, um zum einen optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen, eine langfristige Patientenbindung zu gewährleisten und nicht zuletzt um zu verhindern, dass unter unseren Händen die Angstpatienten von morgen heranwachsen. Schätzungen nach zu urteilen bringen etwa zwei Drittel aller erwachsenen Angstpatienten ein traumatisches Erlebnis beim Zahnarzt in ihrer Kindheit mit ihrer Angst in Verbindung1.
Während des Studiums der Zahnmedizin hat man kaum Kontakt mit den praktischen Aspekten der Kinderbehandlung. Da Theorie und Praxis gerade in der Kinderzahnheilkunde mitunter nicht kompromisslos vereinbar sind, stellt die Behandlung von kleinen Patienten oft eine Herausforderung im Praxisalltag dar. In vielen Praxen sind gestandene Zahnärzte froh, wenn die Kinderbehandlung von den angestellten Assistenzzahnärzten übernommen wird. Diese wiederrum haben oft nicht das notwendige kommunikative Know-how, um die Compliance der kleinen Patienten zu steigern, bzw. zu erhalten. Solange die Diagnostik reibungslos verläuft und keine oder nur kleine Befunde offensichtlich werden, muss keiner der Beteiligten seine Komfortzone verlassen. Was aber, wenn Maßnahmen notwendig werden, die vom Patienten und vom Behandler mehr erwarten, als die individuelle Komfortzone zulässt?
Kinder haben unheimlich feine Antennen und ein deutliches Gespür für ihr Gegenüber. Unsicherheiten übertragen sich so leicht auf den kleinen Patienten und resultieren nicht selten in Überforderung und Verweigerung. Spezialisierte Kinderzahnärzte werden oft erst zu spät hinzugezogen und müssen dann mühselig das Vertrauen der Kinder zurückgewinnen. Doch es geht auch anders! Mit einigen Tricks in der Organisation, Kommunikation und Behandlung, der umfassenden und richtigen Diagnostik und nicht zuletzt dem realistischen Erkennen der eigenen Möglichkeiten und Grenzen kann die Kinderbehandlung als erfolgreicher Bestandteil eines Praxiskonzepts etabliert werden. Das Konzept einer Familienzahnarztpraxis bringt für alle Beteiligten Vorteile: Eltern können ihre Vorsorgetermine mit denen ihrer Kinder kombinieren und sparen so Zeit, der Zahnarzt gewinnt einen ganz neuen Patientenstamm, vervielfältigt sein Behandlungsspektrum und das seines Teams, die Kinderbehandlung bringt mehr Abwechslung in den Arbeitsalltag, eröffnet neue Perspektiven und sie schafft Vertrauen – Eltern, die ihre Kinder bei einem Zahnarzt in guten Händen wissen, werden gerne Patienten werden oder bleiben.
Es gibt zahlreiche Behandlungsansätze und Techniken – die große Herausforderung ist es jedoch, diese Vielfalt zu kennen und individuell bei jedem Patienten wieder neu abzuwägen, welche Technik zum Einsatz kommt. Nicht jeder kleine Patient ist für die Durchführung einer klassischen Füllungstherapie geeignet und nicht bei jedem Kind kann man fluoridieren und abwarten. Nicht immer wird unsere Entscheidung richtig sein, aber was zählt, ist das tägliche Bemühen, unsere kleinen Patienten nach aktuellem Wissenstand optimal zu versorgen.
Wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass gerade Kinderzahnheilkunde weit mehr ist als drill and fill. Die eigentliche Kernaufgabe und tägliche Herausforderung ist die Prophylaxe und somit das Verhindern einer Karies. Anders als bei erwachsenen Patienten können Kinder nicht selbst die Verantwortung für ihre Mundgesundheit übernehmen. Es gibt keinen Grund, dass Kinder eine Milchzahnkaries entwickeln und dennoch sehen wir täglich, dass die Realität anders aussieht. Wir müssen also die Eltern genauso intensiv betreuen, denn sie sind der Schlüssel zur Mundgesundheit ihrer Kinder. Das ist manchmal eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
Ziel der ersten zahnärztlichen Untersuchungen ist es, die Eltern umfassend über alle relevanten Themen (Fluoride, Mundhygiene, Ernährung, Trinken) aufzuklären, Ängste abzubauen (z. B. verfrühter oder verspäteter Zahndurchbruch, Knirschen, Zahnungsbeschwerden) und Karies bzw. die frühkindliche Karies (ECC, early childhood caries) frühzeitig zu erkennen und besser noch zu verhindern. Des Weiteren sollen Kinder an die zahnärztliche Behandlung gewöhnt werden und einige positiv geprägte Zahnarztbesuche erlebt haben, bevor unter Umständen das erste Frontzahntrauma im Lauflernalter behandelt werden muss. Außerdem steht die langfristige Patientenbindung im Vordergrund.
In diesem einleitenden Kapitel werden die wesentlichsten anatomischen, physiologischen und morphologischen Basics von Milchzähnen, die auch praktische Relevanz besitzen, kurz besprochen. Des Weiteren soll dieses Kapitel als Nachschlageoption für Mineralisations- und Durchbruchszeiten dienen. Abschließend wird mithilfe einer Grafik die multifaktorielle Ätiologie von Karies dargestellt.
Aufbau von Milchzähnen
Der Aufbau von Milchzähnen unterscheidet sich maßgeblich von permanenten Zähnen und das hat direkten Einfluss auf die Behandlung. Zum einen müssen aufgrund der mikromorphologischen Gegebenheiten einige Besonderheiten bei der adhäsiven Befestigung von Füllungen beachtet werden, zum anderen ist die Makromorphologie dafür verantwortlich, dass eine Karies bei Milchzähnen schneller bis ins Dentin fortschreitet und auch wesentlich frühzeitiger endodontische Behandlungen notwendig sind.
Mikromorphologisch findet sich ein aprismatischer und unregelmäßiger Schmelzaufbau. Der Anteil organischer Bestandteile ist höher als bei bleibenden Zähnen, was die schlechtere Konditionierung mittels Säure-Ätz-Technik erklärt. Auch das Dentin weist im Vergleich zu permanenten Zähnen Unterschiede auf. Dentintubuli sind ungleichmäßiger verteilt, der Mineralgehalt des Dentins ist verringert und die Tubuli sind größer. Das erklärt die schnellere Kariesprogression und die verminderten Dentinhaftwerte2.
Auch makromorphologisch gibt es einige Besonderheiten. Diese können anhand der Abbildungen 1-1 bis 1-5 und der Tabelle 1-1 nachvollzogen werden.
Abb. 1-1 Morphologische Unterschiede zwischen Milch- und permanenten Zähnen.
Abb. 1-2 Querschnitt durch einen Milchzahn. Man erkennt deutlich die sehr dünne Schmelzschicht. (Quelle: ZTM Peter Schaller)
Abb. 1-3 Querschnitt durch einen bleibenden Zahn. Die Schmelzschicht ist deutlich dicker. (Quelle: ZTM Peter Schaller)
Abb. 1-4 Längsschnitt durch einen Milchzahn. Im linken Kronenteil kann man das Ausmaß des Pulpenkavums erkennen. (Quelle: ZTM Peter Schaller)
Abb. 1-5 Längsschnitt durch einen permanenten Zahn. Die Dentinstärke zwischen Schmelz und Pulpa ist um ein Vielfaches dicker. (Quelle: ZTM Peter Schaller)
Tabelle 1-1 Morphologische Besonderheiten von Milchzähnen3
Makromorphologie
Mikromorphologie
Der Schmelzmantel ist an keiner Stelle dicker als 1 mm.
Die Schmelzoberfläche ist durch eine weitgehend prismenlose Schmelzoberfläche gekennzeichnet (Schichtstärke 30–100 μm).
Die Pulpakammer der Milchzähne ist relativ größer und die Pulpahörner liegen vergleichsweise exponierter.
Die Schmelzprismen im Zervikalbereich steigen von der Schmelz-Dentingrenze kauflächenwärts an.
Die Kauflächen der Milchmolaren sind schmaler, ihre Bukkal- und Lingualflächen divergieren in Richtung auf einen deutlich ausgeprägten zervikalen bzw. basalen Schmelzwulst.
Der Mineralgehalt des Milchzahnschmelzes ist geringer als bei der bleibenden Dentition.
Die Milchmolaren haben einen breiteren und flächigen Approximalkontakt.
In Milchzähnen ist der postnatal gebildete Schmelz deutlich weniger dicht mineralisiert als der pränatale Schmelzmantel.
Die Interaktionsstruktur bei Milchzahndentin ist deutlich dicker als in der bleibenden Dentition (Dentintubuli sind größer, das peritubuläre Dentin ist deutlich ausgeprägter und der Mineralgehalt des intertubulären Dentins ist geringer als in der permanenten Dentition).
Tabelle 1-1 fasst die wichtigsten Unterschiede von Milchzähnen im Vergleich zu bleibenden Zähnen zusammen.
Mineralisations- und Durchbruchszeiten
Um Krankheitsbilder wie die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation oder auch die Dentalfluorose zu verstehen, muss man wissen, wann genau Milch- oder bleibende Zähne mineralisiert werden. Die Tabellen 1-2 bis 1-5 sollen hierfür als Nachschlageoptionen dienen. Des Weiteren kann es auch bei der Beurteilung von Röntgenbildern im Wechselgebiss hilfreich sein zu wissen, wann die Zahnkronen der bleibenden Prämolaren oder Molaren sichtbar sein müssten, um eine etwaige Nichtanlage zu diagnostizieren.
Tabelle 1-2 Mineralisationszeiten der Milchzähne4
Mineralisationsbeginn
Mineralisationsende
Wurzel fertig ausgebildet
Schneidezähne
3.–5. Monat intra utero
4.–5. Monat postnatal
1,5.–2. Jahr
Eckzähne
5. Monat intra utero
9. Monat postnatal
2,5.–3. Jahr
Erster Milchmolar
5. Monat intra utero
6. Monat postnatal
2.–2,75. Jahr
Zweiter Milchmolar
6.–7. Monat intra utero
10.–12. Monat postnatal
3. Jahr
Tabelle 1-3 Mineralisationszeiten der bleibenden Zähne im Oberkiefer4
Oberkiefer-Zahn
Mineralisationsbeginn
Krone fertig gebildet
Wurzel fertig ausgebildet
Mittlerer Schneidezahn
3.–4. Monat
4.–5. Jahr
10. Jahr
Seitlicher Schneidezahn
bis 1. Jahr
4.–5. Jahr
11. Jahr
Eckzahn
4.–5. Monat
6.–7. Jahr
13.–15. Jahr
Erster Prämolar
1,5.–1,75. Jahr
5.–6. Jahr
13.–15. Jahr
Zweiter Prämolar
2.–2,25. Jahr
6.–7. Jahr
12.–14. Jahr
Erster Molar
Geburt
2,5.–3. Jahr
9.–10. Jahr
Zweiter Molar
2,5.–3. Jahr
7.–8. Jahr
14.–16. Jahr
Dritter Molar
7.–9. Jahr
12.–16. Jahr
18.–25. Jahr
Tabelle 1-4 Mineralisationszeiten der bleibenden Zähne im Unterkiefer4
Unterkiefer-Zahn
Mineralisationsbeginn
Krone fertig gebildet
Wurzel fertig ausgebildet
Mittlerer Schneidezahn
3.–4. Monat
4.–5. Jahr
9. Jahr
Seitlicher Schneidezahn
3.–4. Monat
4.–5. Jahr
10. Jahr
Eckzahn
4.–5. Monat
6.–7. Jahr
12.–14. Jahr
Erster Prämolar
1,75.–2. Jahr
5.–6. Jahr
13. Jahr
Zweiter Prämolar
2,25.–2,50. Jahr
6.–7. Jahr
13.–14. Jahr
Erster Molar
Geburt
2,5.–3. Jahr
9.–10. Jahr
Zweiter Molar
2,5.–3. Jahr
7.–8. Jahr
14.–15. Jahr
Dritter Molar
8.–10. Jahr
12.–16. Jahr
18.–25. Jahr
Tabelle 1-5 Durchbruchszeiten der Milch- und bleibenden Zähne
Milchzähne
Durchbruchszeiten
Mittlerer Schneidezahn
6.–8. Monat
Seitlicher Schneidezahn
8.–12. Monat
1. Molar
12.–16. Monat
Eckzahn
16.–20. Monat
2. Molar
20.–30. Monat
Bleibende Zähne
1. Molar (Sechsjahrmolar)
5.–7. Jahr
Mittlerer Schneidezahn
6.–8. Jahr
Seitlicher Schneidezahn
7.–9. Jahr
Eckzahn, Prämolaren
9.–12. Jahr
2. Molar (Zwölfjahrmolar)
11.–14. Jahr
3. Molar (Weisheitszahn)
ab 16. Jahr
Tabelle 1-5 zeigt die Durchbruchszeiten der Milch- und bleibenden Zähne. Hierbei ist zu beachten, dass dabei relativ große Schwankungen möglich sind. Die Zeiten in den Tabellen sollen lediglich eine Orientierung darstellen.
Karies als multifaktorielle Erkrankung
Karies ist eine multifaktorielle Erkrankung, die weit mehr als nur ein oder zwei Einflussfaktoren hat. Es ist wichtig, sich diesen Umstand immer wieder klar zu machen, denn nur so können wir individuelle Risikofaktoren der Patienten erkennen und zielgerichtet präventiv und therapeutisch tätig werden. Gerade bei Kindern, die selbst keinen Einfluss auf ihre Ernährung und Mundhygiene haben, ist es wichtig, in Abhängigkeit von der Compliance und Zuverlässigkeit der Eltern, alle ätiologischen Faktoren zu kennen, um ggf. auch an anderen „Stellschrauben“ zu drehen, damit das Kariesrisiko nachhaltig gesenkt werden kann.
Das nachfolgende Ätiologiemodell5 der Karies nach Fejerskov und Kidd (Abb. 1-6) macht die vielen Ansatzpunkte und deren Wechselwirkungen zur erfolgreichen Kariesrisikoeinschätzung deutlich.
Abb. 1-6 Multifaktorielles Ätiologiemodell der Kariesentstehung.
Literatur
1.Müller EM, Hasslinger Y. Sprechen Sie schon Kind? Berlin: Quintessenz, 2016.
2.van Waes, Hubertus JM, et al. Farbatlanten der Zahnmedizin: Kinderzahnmedizin. Stuttgart: Thieme, 2001.
3.Ermler R. Diagnostik von Approximalkaries bei Milchmolaren mit Hilfe des Diagnodent pen. Diss. Medizinische Fakultät Charité, Universitätsmedizin Berlin 2009.
4.Mittelsdorf A. Kariesprävention mit Fluoriden – Eine Fragebogenaktion zur Fluoridverordnung in Berliner Kinderarztpraxen unter besonderer Berücksichtigung der Empfehlungen der DGZMK. Diss. Medizinische Fakultät Charité, Universitätsmedizin Berlin 2010.
5.Kühnisch J, et al. Kariesrisiko und Kariesaktivität. Quintessenz 2010;61(3):271–280.
2
KOMMUNIKATION
“The use of humor in pediatric dentistry is highly recommended. It may be used to facilitate communications with patients and parents, alleviate patient anxiety, and assist the dentist in coping with stress associated with the practice of dentistry.”
(Mostofsky und Fortune)1
Die richtige Kommunikation spielt nicht erst mit Beginn der Behandlung eine Rolle, sondern ab dem Moment, wo der kleine Patient die Praxis betritt. Kommunikation ist nicht nur reden, sondern setzt sich aus vielen Signalen zusammen. Paul Watzlawick drückte das mit seinem Zitat „Man kann nicht nicht kommunizieren“ aus. Kommunikation setzt sich zu 55 % aus dem nonverbalen Teil (Gestik und Mimik), 38 % aus der Stimmlage und nur zu 7 % aus dem inhaltlichen Teil des Gesagten zusammen2. Im folgenden Kapitel sollen die verschiedenen Ebenen der Kommunikation und ihre Bedeutung in der Zahnarztpraxis erläutert werden. Anhand verschiedener Patiententypen sollen Anregungen gegeben werden, wie (Körper-)Sprache genutzt werden kann, um die Compliance des Kindes zu erlangen, zu erhöhen oder zu erhalten.
Nonverbale Kommunikation, individuelle Sicherheitsräume und Annäherung
Vor allem Kinder sind sehr sensibel gegenüber nonverbalen Signalen der Körpersprache wie Gestik und Mimik. Dabei kann eine Gesichtsregung, wie z. B. das Lächeln, mehrere Botschaften vermitteln: Freude, Unsicherheit, Verlegenheit, Aggressivität, Kontaktaufnahme, Beschwichtigung. Erst die Beteiligung anderer mimischer Bereiche, wie z. B. der Augen, lassen uns interpretieren, um welche Botschaft es sich handelt3. Da nonverbale Kommunikation durch unsere Gedanken unbewusst gesteuert wird, ist es umso wichtiger gerade bei „interessanten“ Kindern eine positive Grundeinstellung zu haben, um authentisch und empathisch kommunizieren zu können. Kinder haben sehr feine Antennen für die Kongruenz körperlicher und verbaler Signale – passen diese nicht zusammen, wird die angestrebte Botschaft nicht oder missverstanden werden. Somit kann die Behandlung von einem „interessanten“ Kind von Anfang an zum Scheitern verurteilt sein, wenn der Behandler eine Antipathie hegt, diese aber versucht zu überspielen. Kinder sind sehr sensibel für Abweichungen zwischen Gefühltem und Gesagtem4.
Eine der größten Herausforderungen ist es, die teils oft unbewussten nonverbalen Signale, die man aussendet, so zu steuern, dass der kleine Patient einen positiven Eindruck gewinnt. Gerade wenn man mit der Kinderbehandlung startet, sollte man am Anfang immer wieder seine eigenen Bewegungen und seine Sprache kritisch reflektieren und analysieren. Wichtig als positive Signale sind ein offenes Lächeln, ruhige und keine ruckartigen Bewegungen sowie die Akzeptanz des individuellen Distanzbereiches des Kindes. Letzteres sind individuelle Räume, die wir benötigen, um uns sicher und geborgen zu fühlen. Werden diese Bereiche gegen unseren Willen gestört, kann das zu Ablehnung, Aggressivität und Angst führen. Ängstliche Kinder haben einen größeren individuellen Distanzbereich, als ihn sehr offene und mutige Kinder haben. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dieser Bereich auch nonverbal zum Beispiel mit einem Blick oder einer Geste überschritten werden kann3.
Es ist also wichtig für den Behandler und auch für die Assistenz, die Signale eines Kindes zu lesen, zu interpretieren und in ihrer Handlung zu respektieren. Gleichzeitig ist es aber notwendig, gerade in der zahnärztlichen Behandlung, diese individuellen Distanzbereiche so weit schrumpfen zu lassen, dass eine Behandlung überhaupt möglich wird. Genau darin liegt oft die große Herausforderung. Dazu benötigt es Geduld, langsame Annäherung, Akzeptanz, positive nonverbale Signale, Rituale (z. B. ähnliche Begrüßungs- oder Behandlungsabläufe) und manchmal auch Helfer, die als neutrale Mediatoren den Distanzbereich eher überschreiten dürfen. Das können zum Beispiel Kuscheltiere, Handpuppen oder auch anderes mitgebrachtes Spielzeug sein. Darüber kann oft eine neutrale Annäherung erfolgen. Kuscheltiere können auch während der Behandlung von großem Vorteil sein, indem sie genutzt werden, um zahnärztliche Handlungen zuerst am Kuscheltier zu zeigen und somit Ängste abzubauen oder auch um das kindliche Verhalten zu spiegeln und darüber das Verhalten des Kindes zu ändern3. Zum Beispiel kann der Behandler mit einer Handpuppe eine Verweigerungshaltung des Kindes („Ich mache meinen Mund nicht auf“) nachspielen (= spiegeln), um dann letztendlich die Handpuppe zu überzeugen, sich untersuchen zu lassen und am Ende zu belohnen oder zu loben. Darüber kann kindliches Verhalten beeinflusst und oft zum Positiven verändert werden. Oft kann man auch beobachten, wie die kleinen Patienten selbst das mit einem Kuscheltier vorgespielte Verhalten spiegeln (z. B. den Mund öffnen).
Wie anfangs erwähnt, kommen diese Aspekte nicht erst zum Tragen, wenn das Kind auf dem Behandlungsstuhl Platz nimmt, sondern bereits nach dem Betreten der Praxis. Ein freundliches Lächeln der Zahnarzthelferin an der Anmeldung, die Begrüßung des kleinen Patienten mit seinem Namen und auch hier die Wahrung des persönlichen Distanzbereiches stellen die Weichen für einen gelungenen Start. Für die Begrüßung bzw. das Hereinholen des Kindes aus dem Wartezimmer ist es außerdem wichtig, sich auf Augenhöhe zu begeben. Alles andere wirkt einschüchternd und bedrohlich. Zur ersten Kontaktaufnahme im Wartezimmer ist ein Distanzbereich von etwa einem Meter optimal.
Das Kind sollte vor den Eltern begrüßt werden. Persönliche Informationen, die man dem Anamnesebogen entnehmen kann (z. B. den Namen des Kuscheltieres oder die Lieblingsfarbe), erleichtern die Kontaktaufnahme und schaffen Vertrauen. Auch hier ist es wichtig authentisch und empathisch zu sein. Wenn deutlich wird, dass ein Kind sehr ängstlich oder aufgeregt ist, bringt es nichts, ihm zu versichern, dass er oder sie das nicht sein muss. Ein gut gemeintes „Es gibt überhaupt keinen Grund aufgeregt zu sein“ beruhigt ein Kind nicht. Im Gegenteil – es schafft zusätzliche Verunsicherung, da das Kind lernt, dass seine erlebten Gefühle nicht richtig sind. Besser ist es, Empathie zu zeigen: „Ich sehe, du bist ganz schön aufgeregt. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich werde dir alles genau erklären, das wird dir helfen, dich wohl zu fühlen“.
Um diese erste aufgebaute Verbindung zu halten, ist es wichtig, dass der kleine Patient auf dem Weg ins Behandlungszimmer begleitet wird. Dabei kann erklärt werden, was man auf dem Weg dahin wahrnimmt (Geräusche, Gerüche oder auch Bilder) oder der Behandler kann einen Ausblick geben, was im Behandlungszimmer passieren wird5. Sollte die Zahnarzthelferin das Kind hereinholen, muss im Behandlungszimmer eine Übergabe an den Zahnarzt stattfinden, indem die Zahnarzthelferin den Behandler vorstellt und dem Kind erklärt, was jetzt passiert.
Während der Behandlung ist ein wichtiger Teil der nonverbalen Kommunikation das Berühren der Kinder durch den Zahnarzt oder die Helferin, sobald diese eine Hand frei haben. Die Hand der Helferin an der Schulter, auf dem Bauch oder am Kopf (besonders an der Schläfe) beispielsweise vermitteln Schutz und Fürsorge6. Dabei können gleichzeitig, zum Beispiel während der Behandlung, verschiedene Akupressurpunkte massiert werden (siehe Kapitel 6 „Behandlungshilfen“). Streicheln ist dagegen oft kontraproduktiv, da es die Aufmerksamkeit für Berührungen beim Kind steigern kann.
Verbale Kommunikation – die richtige Wortwahl
Auch wenn Kinder oft schon durch Angehörige vorgeprägt werden („Wenn Du jetzt nicht ordentlich die Zähne putzt, dann musst Du zum Zahnarzt und der bohrt dann.“), so sind wir als Zahnärzte dafür verantwortlich, die positiven Erfahrungen der Kinder mit unserer Berufsgruppe zu prägen. Generell gilt im Umgang mit kleinen Patienten Voice control – das heißt unterschiedliche Phasen der Behandlung können mit unterschiedlichen Stimmlagen und/oder -lautstärken begleitet werden. Zum Beispiel: Während der Untersuchung spricht der Behandler mit einer monotonen, nicht zu lauten Stimme. Wenn das Kind zum Beispiel die Hand zur Spritze nehmen möchte, kann dem freundlich, aber mit lauterer Stimme Einhalt geboten werden. Bei Kindern, die beispielsweise ständig weinen oder wimmern, kann in leiser Flüsterstimme weiter erzählt werden – die Neugierde der Kinder über das Gesagte lässt die meisten verstummen7.
Eine weitere Grundlage der erfolgreichen Kinderbehandlung ist eine kindgerechte Sprache. Das heißt, es sollten einfache, kurze Sätze ohne Fremdwörter verwendet werden. Auch abstrakte Zeitbegriffe (nachher, dann, später usw.) sind vor dem 5. Lebensjahr für Kinder nicht greifbar und können leicht zu Frustrationen führen. Des Weiteren kann es sehr hilfreich sein, als Behandler einigermaßen sattelfest in den aktuellen Disneyfilmen bzw. Kinderserien im TV zu sein. Damit kann man das Vertrauen der kleinen Patienten gewinnen. Der Behandler muss einfühlsam sein und seine Wortwahl, gerade im Hinblick auf das Erklären von Geräten oder Behandlungsschritten, reflektieren. Wenn ein Kleinkind einen Bohrer bisher nur aus Papas Werkzeugschrank kennt, ist es verständlicherweise verängstigend, wenn das Wort im Zusammenhang mit dem eigenen Mund fällt. Kinder haben eine blühende Phantasie, die man sich ohne Weiteres zu Nutze machen kann. Auch wenn es am Anfang etwas Überwindung kosten kann, sich der kindlichen Phantasiewelt zu öffnen und die „Oma-Zahnteufel aus ihrem Schaukelstuhl zu verjagen, während der Opa-Zahnteufel im Sessel sitzt und schnarcht“, so erleichtern solche Geschichten unheimlich die Zerstreuung der kleinen Patienten und entspannen eine zahnärztliche Behandlung enorm.
Eine weitere Problematik kann die falsche Verwendung des Wortes „okay“ sein. Häufig sind wir es gewohnt, einen Satz damit zu beenden. Kinder verstehen das aber häufig als Frage. Es kann eine kleine Herausforderung werden, wenn ein Satz wie „Ich dusche jetzt deinen Zahn sauber, okay“ vom Kind bestimmt mit „Nein“ beantwortet wird5. Generell sollten Fragen vom Behandler gezielt eingesetzt werden. Vor Eintritt in das Schulalter ist es hilfreich, zum Aufbau der Unterhaltung W-Fragen zu stellen („Was spielst du am liebsten?“). Die Kinder sind gezwungen, im Satz und nicht nur mit „Ja“ oder „Nein“ zu antworten. So kann eine Kommunikation aufgebaut werden3. Ab dem Schulalter kann außerdem mit Alternativfragen gearbeitet werden, bei denen die Kinder das Gefühl haben, mitbestimmen zu können („Möchtest du alleine auf den Thron klettern oder soll Mama zuerst rauf klettern und du sitzt auf ihrem Schoß?“). Dabei sollte der Behandler beachten, dass er nur Alternativen anbietet, die gleichermaßen für den weiteren Behandlungsverlauf dienlich sind (Pseudowahlmöglichkeiten).
In Tabelle 2-1 sind Anregungen zusammengestellt, die die alternative Wortwahl für einige zahnärztliche Instrumente erleichtern sollen.
Tabelle 2-1 Anregungen zur richtigen Wortwahl
Instrument
Vorschläge für kindgerechte Begriffe
Lampe
Sonne
Sonde
Zahnteufelhäkchen; Zahnfühler
Sauger
Zauberstab, der die Spucke weg zaubert; Schnorchel; Strohhalm
Rotes Winkelstück oder Turbine (Wasser)
Blaues Winkelstück
Dusche; Wassersprüher
Krabbelbienchen
Exkavator
Löffelchen; Zahnteufelbagger
Spritze
Schlafwasser oder Schlafkügelchen
Ätzgel
Schlumpfcreme; Zahnshampoo
Polymerisationslampe
Polizeilicht; Zauberlicht
Komposit o. a. Füllungsmaterialien
Zaubercreme
Watterollen
Kopfkissen für den Zahn
Kofferdam
Regenmantel für den Zahn
Matrize
Gold- oder Silbermedaille für den Zahn (je nach Farbe der Matrize)
Holzkeil
Gartenzaun
Pinzette
Kleiner Kran
Karies
Zahnteufel; Zahnwehmännlein; Karius und Baktus
Stahlkrone
Ritter- oder Prinzessinnenzähnchen
Behandlungsstuhl
Kinderthron; Liegestuhl; Fahrstuhl, der nach oben oder unten fährt
Luftbläser
Föhn oder Wasserspritzpistole
Wasserspeier
Wasserfall
Lob und Belohnung sind wichtig in der Arbeit mit Kindern. Die kleinen Patienten sollten gezielt gelobt werden. Es bringt nichts, ein Kind, was absolut unkooperativ war, mit etwas zu belohnen. Das zeigt dem kleinen Patienten, dass sein Verhalten in Ordnung war. Hilfreicher ist es, genau zu sagen, was Ihnen gut gefallen hat und dafür zu loben. Zum Beispiel: „Du bist heute wunderbar mit ins Behandlungszimmer gekommen und ich durfte auch deine Tigerzähne vorne anschauen. Das fand ich super und dafür bekommst du eine Belohnung von mir. Das nächste Mal wünsche ich mir, dass du den Mund ganz weit aufmachst und ich alle deine Zähne mit meiner Sonne zählen darf.“ Somit kann dem Kind auch ein Ausblick und eine Erwartungshaltung für die nächste Behandlung gegeben werden5. Auch ein Lob während der Behandlung ist eine wichtige Motivationshilfe.
Problematisch am Behandlungsabschluss kann auch falsches Verhalten der Eltern oder Begleitpersonen sein. Empathie ist wichtig, aber übertriebene Mitleidsbekundungen verstärken beim Kind den Eindruck, dass die zahnärztliche Behandlung etwas Traumatisches war, was es in Zukunft zu fürchten gilt5. Um solche Situationen zu vermeiden, kann es hilfreich sein, den Eltern vor zahnärztlichen Behandlungen einen kleinen Verhaltensleitfaden auszuhändigen. Ein Beispiel für solch einen Elternbrief ist in Abbildung 2-1 wiedergegeben.
Abb. 2-1 Beispiel für einen Elternbrief als Verhaltensleitfaden (Quelle: Dr. Ulrike Uhlmann).
Tell-Show-Do-Methode
Das Wichtigste in Kürze
Grundregeln für die Kommunikation mit Kindern in der Praxis
nonverbal: Authentizität, Fokus auf dem Kind, Gefühltes und Gesagtes des Behandlers müssen kongruent sein, offenes Lächeln, ruhige Bewegungen, Distanzräume akzeptieren, Geduld, das Kind ernst nehmen, das Kind ausreden lassen, Kontakt durch Berührung während der Behandlung beispielsweise an der Schulter oder an der Schläfe, auf Augenhöhe kommunizieren, ritualisierte Abläufe.
verbal: Voice control, (keine übertriebene) Empathie, Verneinungen oder Negativsätze vermeiden, keine Fremdwörter, kein(e) Ironie/Sarkasmus, bildhafte Sprache verwenden, tiefe und ruhige Stimmlage, kurze und einfache Sätze, Vorsicht mit Fragen, Sätze nicht mit „OK“ beenden, Pseudowahlmöglichkeiten zulassen, positive Wortwahl, spezifisches Lob während und nach der Behandlung ist wichtig.
Weitere Informationen
Eine der absoluten Expertinnen hinsichtlich der Kommunikation mit Kindern ist Dr. Gisela Zehner. In ihrem Buch „Hypnose beim Kinder-Zahnarzt“ findet der interessierte Leser nicht nur Tipps zur Kommunikation auf allen Ebenen, sondern auch viele Hinweise zur Verhaltensführung. Auf ihrer Homepage6 finden sich außerdem sehr lesenswerte Fachartikel zum Thema Hypnose, Verhaltensführung und Akupressur.
Abb. 2-2 Tell-Show-Do-Methode an einer 4-jährigen Patientin. Hier wird der Rosenbohrer am Fingernagel des Mädchens demonstriert. Man kann mit einem Rosenbohrer zum Beispiel auch eine Sonne auf den Fingernagel des Kindes „malen“ und anschließend das Gleiche am Zahn wiederholen (Quelle: Dr. Ulrike Uhlmann).
Zu beachten ist, dass die verschiedenen Behandlungsschritte erst unmittelbar vor Durchführung erklärt bzw. gezeigt werden. Da Kinder eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, bringt es nichts, alle Schritte lediglich am Anfang zu erklären.
Nachfolgend sollen verschiedene Patiententypen und ihr Management dargestellt werden.
Verschiedene Patiententypen
Der „Dauerweiner“
Dieser kleine Patient weint ständig auch ohne erkennbaren Grund. Es kann helfen, extra leise mit solchen Kindern zu sprechen. Häufig regt sich dann die Neugierde und die Kinder beruhigen sich, um überhaupt verstehen zu können, was gesagt wird. Wem singen nicht unangenehm ist, kann sich auch das Überraschungsmoment zu Nutze machen und anfangen, etwas lauter als das Kind, ein Kinderlied zu singen. Manche Kinder halten dann überrascht inne. Dann kann man leise weitersingen und mit der Untersuchung starten bzw. fortfahren.
Der extrem schüchterne Patient
Der extrem schüchterne Patient versteckt sich bereits im Wartezimmer unter dem Stuhl oder hinter einer Vertrauensperson. Diese Kinder brauchen viel Raum und Zeit, um sich in die neue Situation einzufinden. Hier ist es wichtig, den individuellen Distanzbedarf des Kindes zu akzeptieren und es nicht zu bedrängen. Es kann helfen, das Kind komplett zu ignorieren und sich ausschließlich der Vertrauensperson zuzuwenden. Diese wird mittels der Tell-Show-Do-Methode untersucht. Alle Befunde werden kindgerecht der zahnärztlichen Helferin kommuniziert („Ich habe 8 Mamazähne gezählt und die glitzern ganz wunderbar.“) und kooperatives Verhalten wird für das Kind offensichtlich belobigt und belohnt. Oft tauen entsprechende Kinder schon während der Untersuchung der Eltern auf und werfen einen neugierigen Blick mit in Mamas Mund oder möchten dann auch mal den Spiegel halten (Abb. 2-3 und Abb. 2-4). Manchmal reizt auch das abschließende Geschenk und hilft der Kooperation auf die Sprünge.
Abb. 2-3 Demonstration eines Bürstchens beim Papa (Quelle: Dr. Ulrike Uhlmann).
Abb. 2-4 Die kleine Patientin darf Absaugen und durfte mit einem kleinen Spiegel die „Papazähne“ mit untersuchen (Quelle: Dr. Ulrike Uhlmann).
Wichtig ist, diesen Patiententyp nicht zu bedrängen und somit zu überfordern. Ein wenig mehr Zeit, die hier am Anfang investiert wird, zahlt sich später doppelt aus. Manchmal sind auch zwei Termine nötig, um diese Kinder zu untersuchen.
Vorsicht: Sollten die Eltern selbst Angstpatienten sein, ist es nicht ratsam, die Eltern beispielhaft zu untersuchen. Die für die Kinder oftmals offensichtliche Überforderung der ängstlichen und nervösen Vertrauensperson ist nicht zielführend, sondern schafft eher Misstrauen beim Kind.
Der kleine „Schlaumeier“
Diese kleinen Patienten wissen ihrer Meinung nach genauestens über alle Behandlungsabläufe Bescheid und teilen auch gern ihr Wissen mit dem Behandler. Mitunter kann es schwierig sein, diesen Kindern eine Spritze als „Schlafwasser“ verkaufen zu wollen. Sätze wie „Ich weiß genau, dass das eine Spritze ist und keine Zauberkugeln“ können Behandler und Helferin leicht aus dem Konzept bringen. Es hilft, das Verhalten der Kinder zu spiegeln und zum Beispiel mit einem Fremdwort aufzutrumpfen: „Du hast absolut Recht, das ist kein „Schlafwasser“, sondern eine An-ästh-esie“ kann beispielsweise eine geeignete Reaktion auf den kleinen Schlaumeier sein. Das Kind erfährt etwas, was es noch nicht wusste und der Behandler bleibt Herr der Lage.
„The King‘s Child“
„The King‘s Child8“ oder im übertragenen Sinne „der verwöhnte Trotzkopf“ ist einer der schwierigsten Patienten in der täglichen Praxis. Oft treten sie dem Behandler bockig gegenüber, werden von ihren Eltern in ihrem Verhalten in Schutz genommen und somit bestärkt. Ohne wirklich Angst vor der anstehenden Behandlung zu haben, verweigern sie die Kooperation. Hier kann man gut mit Voice control arbeiten. Der Zahnarzt sollte ruhig und etwas leiser sprechen, wenn es gut funktioniert. Kooperiert das Kind nicht, wird der Behandler lauter und bestimmter in der Tonlage. Außerdem kann ein zeitliches Ultimatum gestellt werden, währenddessen das Kind nochmals im Wartezimmer Platz nehmen muss. Wenn das Kind jegliche Kooperation verweigert, wird ein neuer Termin in zwei bis drei Wochen vergeben8. Manchmal kann es sinnvoller sein, das Kind von den Eltern für die Untersuchung oder die Behandlung zu trennen.
Oft sind es gerade die sehr antiautoritär erzogenen Kinder, die daheim vergebens ihre Grenzen suchen und dieses Verhalten auch in die Zahnarztpraxis übertragen. Das Ergebnis ist ein permanentes Testen und Herausfordern, zum Beispiel das ungefragte Drücken von Knöpfen an der Behandlungseinheit oder auch das respektlose Verhalten dem Zahnarzt oder dem Praxispersonal gegenüber („Du bist doof und ich lasse dich auf keinen Fall in meinen Mund gucken.“). Es ist wichtig, diesen Kindern klar die Regeln zu kommunizieren: „Hör mir bitte zu. Das ist meine Praxis und hier gelten meine Regeln. Ich möchte, dass du zu mir und allen, die hier arbeiten, nett bist, genau wie du es von mir erwartest. Ich werde deine Zahnteufel nicht verjagen, wenn du mich „doof“ nennst oder ungefragt an meine Instrumente greifst.“ Oft sind diese Kinder sehr dankbar, nehmen diese Grenzen gerne an und lassen sich ohne weiteres behandeln.
Exkurs
Hubschraubereltern und deren kommunikatives Management
„Hubschraubereltern“ können einem als Behandler das Leben schwer machen. Vor allem, wenn man selbst als Behandler noch sehr jung ist. Sie sind übertrieben protektiv ihren Kindern gegenüber, mischen sich ständig verbal in die Behandlung ein und stellen erst einmal alles in Frage. Das kann verhindern, dass der Behandler eine Verbindung zum Kind aufbaut, weil der kleine Patient ständig von seinen Eltern abgelenkt wird. Hier kann es helfen, dem