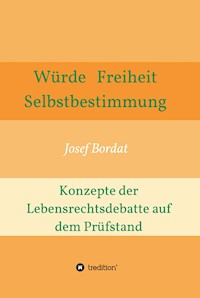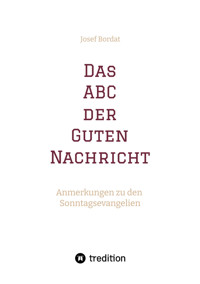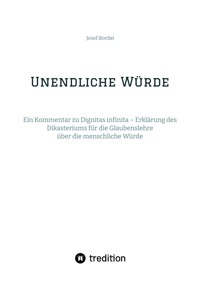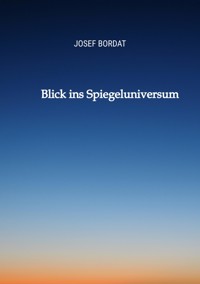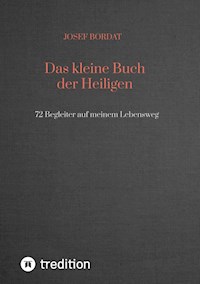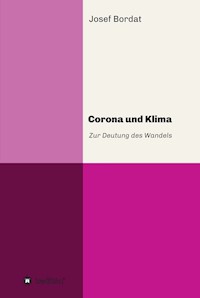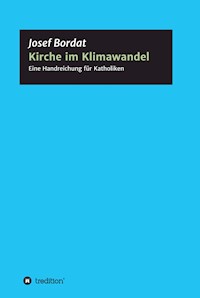
4,90 €
Mehr erfahren.
Der rapide Wandel des Klimas wird wesentlich vom Menschen mitverursacht. Unser Einfluss ist so groß, dass normative Anpassung und Verhaltensänderung sich künftig auf Klima und Wetter auswirken. Im diesem Sinne sind entsprechende Maßnahmen auf institutioneller und individueller Ebene sinnvoll. Der Mensch bleibt dabei im Mittelpunkt und ist Ziel aller Schutzstrategien zur Vermeidung der schlimmsten Folgen des Klimawandels. Er nimmt seine Rolle als "Hüter der Schöpfung" in Verantwortung an. Die Katholische Kirche als eine der größten weltweit aktiven Einrichtungen kann in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Dazu ist ihre Lehre in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes zu verbreiten und praktisch umzusetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Josef Bordat
Kirche im Klimawandel
Eine Handreichung für Katholiken
Para Renato
© 2020 Josef Bordat
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-01428-2 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-01429-9 (Hardcover)
ISBN: 978-3-347-01430-5 (E-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
„Christinnen und Christen [zeigen] eine Haltung der Wertschätzung aller Mitmenschen und Mitgeschöpfe sowie die aktive Bereitschaft zu Verantwortung und Solidarität. Der Klimaschutz ist eine neue, komplexe und zunehmend bedeutsame Bewährungsprobe für diese Haltung.“
Die deutschen Bischöfe, in: Der Klimawandel.
Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit (2006), Nr. 35.
Vorwort, oder: Warum ich meine, dieses Buch schreiben zu sollen
Ich erinnere mich daran, denn es war an meinem Geburtstag. Ich hatte einige Tage vor dem 20. April 2019 etwas Fürchterliches getan und erhielt dafür – an Geschenken statt – nun die wohlverdiente Quittung. Ich hatte einen Artikel für die englischsprachige Website Catholic365 geschrieben. Thema: Klimawandel. Ich hatte es doch tatsächlich gewagt zu behaupten, dass die drei Päpste der Gegenwart, die seit 1978 Stuhl und Katheder Petri innehatten bzw.- haben, den Klimawandel als ethisches Problem betrachten und daher der Moraltheologie zuweisen.
Voraussetzung dafür ist freilich, dass der Klimawandel vom Menschen in entscheidender Weise mitverursacht wird, sonst könnte er kein Thema dessen sein, was das menschliche Verhalten zum Gegenstand hat: die Moral und ihre theoretische Analyse in Philosophie und Theologie. Eine Ethik der Super-Nova kann es nicht geben, weil der Mensch (nach allem, was wir wissen) keinen Einfluss auf explodierende Sonnen in fernen Galaxien hat. Jemanden dafür verantwortlich machen zu wollen, ist absurd.
Belegt hatte ich meine steile These vom Glauben der Kirche an den anthropogenen Klimawandel mit Aussagen von Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus, die aus Verlautbarungen ihrer jeweiligen Amtszeiten stammen. Mein Artikel bestand zu gut zwei Dritteln aus Papst-Zitaten.
Als ich nun – an meinem Geburtstag – den Beitragshinweis auf der Facebook-Seite von Catholic365 sah (mit rund 260.000 „likes“ eine durchaus stattliche und – dachte ich – heterogene katholische Kommunität), verschlug es mir die Sprache: Ein Sturm der Entrüstung blies durch den Kommentarbereich. Ich hatte bei meinen katholischen Schwestern und Brüdern in Übersee einen Nerv getroffen. Mit Papst-Zitaten.
Erschreckend daran war nicht die Bewertung des Beitrags als „lächerlich“ und „peinlich“, sondern die Tatsache, dass mit keinem Wort auf die Papst-Zitate eingegangen wurde. Franziskus wurde kurzerhand als „Häretiker“ diskreditiert; zu Johannes Paul und Benedikt – die ich besonders berücksichtigt hatte – schwieg man sich aus. Das eigentlich Frappierende war jedoch: Die Beiträge wandten sich ausnahmslos gegen die Prämisse eines anthropogenen Klimawandels. Ausnahmslos.
Nur ein „Idiot“ (ich wähle mal die höflichste Bezeichnung) könne an der These (hier: „Wahn“) eines menschengemachten Klimas festhalten. Ein Idiot wie – ich. Gut, das sehe ich ein. Ein Idiot wie der amtierende Petrusnachfolger? Auch daran muss man sich wohl gewöhnen, wenn man mit bestimmten Kreisen innerhalb der Kirche Kontakt halten will. Ein Idiot wie der emeritierte Papst, dessen – ich glaube: 20-bändiges – Gesamtwerk gerade editiert wird? Hm. Ein Idiot wie sein mittlerweile heiliggesprochener Vorgänger? Spätestens das sollte aufhorchen lassen.
Dies und Äußerungen der Art, dass man „so was“ hier nicht mehr lesen wolle, brachten mich auf den Gedanken, eine Handreichung für Katholiken zur Beantwortung von Fragen hinsichtlich des Klimawandels zu schreiben, wissend, dass das schwierig werden würde, weil ich beileibe kein Experte bin, ahnend, dass die Kommentatoren nicht die Kirche repräsentieren, und hoffend, dass meine Ahnung bei Drucklegung des Textes immer noch wahr ist.
Freilich ist davon auszugehen, dass es auch nach der Lektüre dieses Textes Menschen gibt, die den anthropogenen Klimawandel für eine „Erfindung der Demokraten“ – gemeint ist die politische Partei in den USA – halten und jede Maßnahme zum Klimaschutz von daher als unnötig ablehnen, aber vielleicht schaffe ich es, die eine Schwester oder den anderen Bruder im Glauben zum Nachdenken zu veranlassen. Das ist Sinn, Zweck und Ziel dieses Buchs.
Bedanken möchte ich mich bei all denen, die mich zur Abfassung dieses Manuskripts in ganz unterschiedlicher Art und Weise motiviert haben. Widmen möchte ich es meinem jüngsten Neffen Renato.
Noch einige Hinweise.
Ich zitiere hauptsächlich barrierefreie Internetquellen, die jede Leserin und jeder Leser leicht selbst nachschauen kann. Das vorliegende Buch ist keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eine Handreichung für den Gebrauch in der alltäglichen Diskurspraxis, gerade auch in den Sozialen Medien. Die Verweise in den Fußnoten sind immer ausführlich; auf Standards wie „ebd.“ oder „a.a.O.“ wurde verzichtet. Das ermöglicht einen direkten Zugriff auf die Quelle, ohne langes Suchen.
Bei den Dokumenten aus dem Vatikan habe ich – soweit verfügbar – die deutsche oder die englische Fassung auf vatican.va zugrundegelegt. Sind beide Sprachversionen nicht verfügbar, wird aus der italienischen oder spanischen Fassung zitiert (mit deutscher Übersetzung).
Noch eine Bemerkung zur Schreibweise von Berufs- oder Personenbezeichnungen: Gewählt wird zu besseren Lesbarkeit gewöhnlich das generische Maskulinum, bei dem selbstverständlich Frauen und Menschen, die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, regelmäßig mitgemeint sind. Nichts liegt mir ferner, als irgendjemanden von der Debatte über den Klimawandel ausschließen zu wollen. Dafür ist das Thema einfach viel zu wichtig.
Berlin, im Februar 2020
Josef Bordat
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Kapitel 1: Wissen
1.1 Empirie
1.1.1 Es wird wärmer
1.1.2 Das hat Folgen
1.1.2.1 Eis wird weniger
1.1.2.2 Meeresspiegel steigt
1.1.2.3 Wetter wird extremer
1.1.2.4 Ernten fallen aus
1.1.2.5 Menschen erkranken
1.1.2.6 Gewalt nimmt zu
1.1.2.7 Menschen fliehen
1.1.2.8 Kultur geht unter
1.1.2.9 System könnte kippen
1.1.3 Das hat Gründe
1.2 Erklärung
1.2.1 „Änderung der Sonnenstrahlung“
1.2.2 „Änderung der Erdbahnelemente“
1.2.3 „Änderung der Zusammensetzung der Atmosphäre“
1.2.4 „Menschliche Tätigkeit“
1.2.4.1 Der Mensch und sein Anteil
1.2.4.2 Die Steigerung anthropogener CO2-Emissionen
1.2.5 Einwände
1.2.5.1 CO2 und Temperatur
1.2.5.2 Vulkane
1.2.5.3 Aerosole
1.2.5.4 CO2 als „Pflanzennahrung“
1.2.6 Zwischenfazit
1.2.7 Der Konsens über den menschengemachten Klimawandel
1.2.7.1 Die Wissenschaft hat festgestellt
1.2.7.2 Zehn kleine (Meta-)Studien
1.2.7.3 Nochmal: Sieben Einwände
1.2.8 Beweis und Vernunft
1.2.9 Klimaforschung
1.2.9.1 Geschichte, oder: Der lange Weg zum IPCC
1.2.9.2 Gegenwart, oder: Modellbildung
1.2.9.3 Kurzer Exkurs
1.2.9.4 Datenbasis
1.3 Lösungen
1.4 Zusammenfassung
Kapitel 2: Moral
2.1 Anthropologische Vorbemerkungen
2.1.1 Das christliche Menschenbild
2.1.2 Das säkularistische Menschenbild
2.2 Das Mensch-Natur-Verhältnis
2.2.1 Radikaler Anthropozentrismus
2.2.2 Pathozentrismus
2.2.3 Biozentrismus
2.2.4 Anthropozentrismus mit Augenmaß
2.3 Kurzes Zwischenfazit
2.4 Klimaethik, oder: Der Mensch hat Verantwortung
2.4.1 Klimaethik als Konsequentialismus
2.4.2 Zum Verantwortungsbegriff
2.4.2.1 Gesinnung und Verantwortung
2.4.2.2 Verantwortung als moralisches Konzept
2.4.2.3 Wer trägt wofür Verantwortung?
2.4.2.3.1 Individuum und Institution
2.4.2.3.2 Verantwortungsethik nach Hans Jonas
2.4.2.3.3 Abstufung von Verantwortung
2.4.2.4 Probleme der Verantwortungsethik
2.4.3 Spezifische Probleme der Klimaethik
2.4.4 Lösungsansätze für die Probleme der Klimaethik
2.5 Fazit: Der Mensch im Mittelpunkt
Kapitel 3: Kirche
3.1 Der Blick in die Bibel
3.1.1 Die biblische Botschaft fruchtbar machen
3.1.2 Was man bewahren will: Schöpfung im Wandel
3.1.3 Bibel und Christentum: Teil der Lösung?
3.2 Der Blick in Dokumente der Kirchengeschichte
3.2.1 Franziskus, der Öko-Heilige
3.2.2 Bischöfe und Einrichtungen weltweit
3.2.3 Umwelt- und Klimaschutz vor Papst Franziskus
3.2.3.1 Papst Johannes Paul II
3.2.3.2 Papst Benedikt XVI
3.2.4 Franziskus, der Öko-Papst
3.2.4.1 Vor Laudato Si'
3.2.4.2 Franziskus' Laudato Si' (2015)
3.2.4.3 Nach Laudato Si'
3.3 Der Blick in Dokumente der Kirche in Deutschland
3.3.1 Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)
3.3.2 Deutsche Bischofskonferenz (DBK)
3.4 Fazit: Gute Ideen und wichtige Impulse
Kapitel 4: Schutz
4.1 Haupthandlungsfelder für Klimaschutzmaßnahmen
4.1.1 Energie
4.1.2 Gebäude
4.1.3 Verkehr
4.1.4 Ernährung
4.2 Weitere Ideen für konkrete Klimaschutzmaßnahmen
4.2.1 Weniger verschwenden
4.2.2 Auf nachhaltige Unternehmen achten
4.2.3 Bio-Produkte verwenden
4.2.4 Hier und jetzt
4.2.5 Teilen und selber machen
4.3 Klimaschutzmaßnahmen im Alltag der Pfarreien
4.4 Fiskalpolitische Maßnahmen
4.4.1 CO2 bepreisen
4.4.2 CO2-Steuer versus CO2-Emissionshandel
4.5 Irrwege beim Klimaschutz
4.5.1 „Bevölkerungswachstum stoppen!“
4.5.2 „Atomenergie länger nutzen!“
4.5.3 „Geoengineering: CO2 einfach speichern!“
4.6 Klimaschutz kostet Geld
4.7 Die Rolle Deutschlands beim Klimaschutz
Schlusswort
Zum Autor
Einleitung, oder: Mein Zugang zum Klima
Die Klimakrise ist eine Vertrauenskrise, eine Moralkrise, eine Glaubenskrise.
Der Klimawandel erfüllt mich mit Sorge. Nach dem, was über die Folgen des Klimawandels gesagt wird, ist das keine irrationale Angst, sondern eine berechtigte Befürchtung. Schon zu Beginn meiner Beschäftigung mit der Thematik vor gut einem Jahrzehnt waren die Warnungen nicht zu überhören. Lange vor Greta Thunberg und „Fridays For Future“ gab es allen Grund zur ernsten Besorgnis. Dass daraus bei einigen Menschen mittlerweile „Panik“ geworden ist, liegt nicht an mangelnden Erkenntnissen der Wissenschaft, sondern an der jahrzehntelangen Untätigkeit der Politik. Zwar hat es Beschlüsse gegeben, die wichtige Ziele formulierten und auch feststellten, wie diese zu erreichen sind, allein an der beherzten Umsetzung der Maßnahmen zur Zielerreichung haperte es.
Mittlerweile ist das anders: Die Rolle des Menschen als Einflussfaktor in allen klimarelevanten Prozessen ist allgemein anerkannt und zum Gegenstand politischen Handelns geworden. Die Politik müht sich zunehmend um konkrete rechtliche Regelungen zur Etablierung von Klimaschutzmaßnahmen in der Gesellschaft – auch als Ergebnis sozialen Drucks, wie ihn „Fridays For Future“ auf die Straße gebracht hat.1
Gleichzeitig ist es allerdings so, dass mit diesen unübersehbaren sozialen und politischen Prozessen die Öffentlichkeit mit dem ehedem akademischen Thema Klimawandel mehr und mehr in Berührung kommt. Und in dieser Öffentlichkeit stehen nun die wissenschaftlichen Erkenntnisse selbst in Frage, zumindest in dem nichtfachlichen öffentlichen Diskurs, wie er insbesondere in den Sozialen Medien stattfindet. Der Aufstieg dieser Kommunikationsform in den vergangenen zehn Jahren trägt mit dazu bei, dass in der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit ein Streit tobt, der innerhalb der Wissenschaft nicht mehr stattfindet und über den die Klimawissenschaftler kollektiv den Kopf schütteln. Man versucht also, die Veränderung in der Gesellschaft dadurch zu stoppen, dass man ihre Quelle untergräbt: die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das verfängt nicht, klar. Doch es ist Teil einer Abwehrstrategie gegen Veränderung, die als solche ernst genommen werden muss. Daher ist es wichtig, den Klimaschutz und seine (kostspieligen) Maßnahmen ganz grundlegend klimawissenschaftlich zu begründen, immer wieder, immer genauer, immer besser.
Ich bin kein Klimaforscher. Ich war nie in der Antarktis, um im Eis zu bohren. Um ganz ehrlich zu sein, verlasse ich meinen Schreibtisch nur selten, wenn ich arbeite. Meine Erkenntnisse stammen aus der Lektüre dessen, was andere zu sagen haben. Klimaforscher, Klimaaktivisten, Klimaskeptiker. Ich betrachte die Dinge dann mit meinen Augen: Die Arbeiten der Klimaforscher wissenschaftstheoretisch, die Einlassungen der Klimaaktivisten und Klimaskeptiker soziologisch. Mir ist dabei aufgefallen, dass sich die Klimakrise im Diskurs als eine dreifache gesellschaftliche Krise zeigt: als Vertrauenskrise, als Moralkrise, als Glaubenskrise.
Vertrauenskrise
Menschen misstrauen einander. Und das ist auch gut so. Zumindest muss es wohl in der Evolution des Menschen Phasen gegeben haben, in denen es sinnvoll war, ständig auf der Hut zu sein. Die meiste Zeit hat der Mensch ohne Gesetze und Gerichte überleben müssen, ohne Polizei und Alarmanlage.
Heute haben wir das alles. Doch so ganz frei sind wir auch heute nicht von dieser ererbten Angst. Wenn wir etwas erfahren, das wir nicht begreifen können, weil es uns gedanklich oder räumlich entzogen ist, werden wir unruhig und skeptisch. Verschwörungstheorien, die sich auf dieses archaische Muster stützen, haben Konjunktur: Es gibt eine Gruppe, die mehr weiß als wir, und uns zu ihren bösen Zwecken benutzt.
Die Skepsis des modernen Menschen richtet sich auf Eliten. Gepaart mit – geben wir es ruhig zu – ein wenig Neid auf „die da oben“ fällt es uns schwer, Vertrauen zu entwickeln. Desto schwerer, je eher und je mehr wir den Eindruck haben, hinters Licht geführt und betrogen zu werden. Stellen nun Eliten Nachteile für uns in Aussicht, ohne dem Anschein nach selbst davon betroffen zu sein, wächst die gesunde Skepsis zu einem prinzipiellen Misstrauen, aus dem heraus es für die Eliten keinen argumentativen Ausweg gibt.
Autorität, Expertise, Befugnis – was auch immer Eliten ins Feld führen, es verstärkt nur den Eindruck, die Wahrheit verschleiern und die Ungerechtigkeit rechtfertigen zu wollen. Je mehr Argumente – auch wissenschaftliche – genannt werden, desto tiefer das Misstrauen, zumal alle, die Argumente liefern, ja selbst Teil der Elite sind. Eine für die Demokratie dramatische und für den Klimaschutz tragische Konstellation.
Ich will versuchen, das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken, indem ich den bestehenden Konsens vorstellen, die wesentlichen Erkenntnisse dieser Mehrheit aufzeigen und skeptische Einwände dagegen entkräften werde.
Moralkrise
Stellen die Eliten Ansprüche an die Moral, treffen sie auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Das Grundproblem moralischer Appelle liegt schon darin begründet, dass wir keine gemeinsame Moral haben, weil wir unterschiedlichen Ethiken folgen. Was uns zusammenhält, ist nicht die Moral, sondern das Recht. Immanuel Kant hat dies schon vor über 200 Jahren begriffen und damit – für Preußen resp. Deutschland – die philosophische Grundlage des Rechtsstaats geschaffen.
Dennoch kann man nicht alles gesetzlich regeln. Menschen brauchen Moralität und leben in den meisten Fällen auch danach. Den Nachbarn zu grüßen, „Bitte“ und „Danke“ zu sagen oder Geld für eine karitative Einrichtung zu spenden ist nirgendwo normativ verordnet. Trotzdem tun die allermeisten Menschen das.
Im Zusammenhang mit dem Klimaschutz gibt es zwei Tendenzen: Einerseits entwickelt sich eine „Hypermoral“, die alles dem Klima unterordnen will, andererseits ist die Verantwortungslosigkeit eines „Weiter so!“ zu beobachten, das sich aus mangelndem Vertrauen speist.
Ich will versuchen, aus der christlichen Anthropologie eine Ethik des Klimawandels zu entwickeln, mit der eine Moral Einzug halten kann, die beidem wehrt: Übertreibung und Gleichgültigkeit. Und die uns hilft, unserer Verantwortung gerecht zu werden.
Glaubenskrise
Religion als ein etabliertes und bedeutendes kulturelles Verständigungssystem muss auf den Klimawandel Antworten geben – und tut es auch. Gerade Christinnen und Christen sind in ganz unterschiedlicher Weise im Diskurs über das Thema Klimawandel aktiv. Kirchen- und Katholikentage finden seit Jahren „klimaneutral“ statt, es gibt seit 2010 den „Ökumenischen Tag der Schöpfung“, 2015 veröffentlichte Papst Franziskus seine Enzyklika Laudato si’.
Religion und Klimawandel stehen dennoch in einem uneindeutigen Verhältnis zueinander. Die Frage ist: Was dient hier eigentlich wem? Der Klimawandel der Religion – als neues Betätigungsfeld der Kirche (und wohl auch als Rechtfertigungsfigur) in säkularisierten Zeiten? Oder die Religion dem Klimaschutz – soweit deren machtvolle Sprachspiele helfen, das Thema im Diskurs prominent zu platzieren (und vielleicht auch immun zu machen gegen Kritik)? Entsteht mithin eine „Klimareligion“, welche die sakrale Tradition und die soziale Autorität der Kirche in die Umweltbewegung hineinträgt und sie so mit Sinngehalt auflädt, ja, unantastbar macht?
In der Tat gibt es beides in der Kirche: Zum einen wird versucht, das Engagement für Klimaschutz selbst als eine neue Religiosität zu bestimmen – selten affirmativ, zumeist, um sich dagegen zu positionieren. So wird rhetorisch eine Konkurrenz für die Kirche aufgebaut, geradezu ein katholisches „Feindbild“. Tatsächlich bietet sich der zuweilen pathetische Duktus der Klimaschutzbewegung dafür an. Zum anderen wird aber auch versucht, ein Engagement für Klimaschutz in die eigene Glaubenstradition einzubringen und dafür ebenfalls – nun aber ohne Zweifel affirmativ – religiöse Metaphern zu nutzen, die bekannt sich, aber doch in der Vergangenheit inhaltlich etwas weniger stark und höchstens unverbindlich gefüllt wurden: Bewahrung der Schöpfung, Schöpfungsverantwortung, Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung.
Ich will versuchen, eine christliche (insbesondere: katholische) Perspektive auf den Klimaschutz einzunehmen und anhand kirchlicher Verlautbarungen zu zeigen, dass der christliche Glaube katholischer Prägung Teil der Lösung des Klimaproblems sein kann.
1 „Nicht nur in der Natur, auch in der Gesellschaft gibt es Kipppunkte. Die Schülerbewegung Fridays for Future hat die gesellschaftliche Diskussion schon deutlich verändert, unterstützt von den mehr als 26.000 Wissenschaftlern von Scientists for Future und zahllosen anderen.“ (Stefan Rahmstorf,
https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/klimaforscher-stefan-rahmstorf-das-ist-alarmstufe-rot.html)
Kapitel 1: Wissen
Wir müssen uns eingangs durch einige Grundlagen durcharbeiten. Die Frage, was wir über den Klimawandel wissen, über seine beobachtbaren Folgen und seine möglichen Ursachen, legt fest, wie wir auf den Klimawandel reagieren sollten. Daher ist eine Beschäftigung mit den Phänomenen des Klimawandels und der Theorie über dessen Ursachen unerlässlich.
1.1 Empirie
Der Klimawandel ist kein neues Phänomen. Das Klima hat sich immer schon geändert. Es war auf der Erde schon viel wärmer und schon viel kälter als heute.
Der Begriff „Klima“ muss zunächst vom Begriff „Wetter“ unterschieden werden. Das ist für die Debatte über den Klimawandel nicht ganz unwichtig, weil oft genug mit konkreten Wetterbedingungen gegen Resultate der Klimaforschung Stimmung gemacht wird – etwa, wenn es an einem Sommertag mal besonders kühl ist und am virtuellen Stammtisch gleich die Erderwärmung als solche hinterfragt wird. „Wetter“ beschränkt sich auf den Zustand der Erdatmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit; „Klima“ beschreibt die Wetterbedingungen über größere Zeiträume und Regionen und stellt dabei Werte für Klimavariablen im Zeitverlauf fest, die den Zustand der Atmosphäre, des Ozeans, der Eisflächen an den Polen und der Gletscher in den Hochgebirgen charakterisieren.
Klima ist also eine statistische Größe, die langfristige Aussage über das Wetter macht, eine „Statistik vom Wetter“2. Aus statistischen Berechnungen ergibt sich für einen bestimmten Zeitraum eine Verteilung unter als konstant angenommenen externen Bedingungen (etwa Sonnen- und Vulkanaktivität). Wenn zwei aufeinanderfolgende Zeitspannen nun eine Änderung der Verteilung aufweisen, spricht man von „Klimawandel“.3
Soweit, so unbefriedigend. Denn die externen Bedingungen sind auch in kurzen Zeiträumen nicht konstant. Und auch minimale Schwankungen (etwa der Sonnenaktivität) können das Klima beeinflussen. Dem kann nun abgeholfen werden, indem die Variablen im Zeitverlauf empirisch, also durch Beobachtung und Messung von Daten, erfasst werden. Über Zeitreihen einer bestimmten Spanne (üblicherweise 30 Jahre – „30 Jahre sind lang genug, um nach den Regeln der Statistik vernünftige Trendaussagen machen zu können“4) lassen sich dann Klimaveränderungen identifizieren, bei denen die Schwankungen externer Einflüsse berücksichtigt sind.5
Allerdings ist mit Blick auf den Klimawandel in unseren Tagen auch diese Auffassung von „Klima“ noch unbrauchbar, denn dabei bleiben die Ursachen abrupter Klimaveränderungen unerkannt. Wenn inmitten einer Zeitspanne ein klimaveränderndes Ereignis eintritt (etwa ein Meteoriteneinschlag), bleibt es in seiner Bedeutung für das Klima unentdeckt bzw. wird bei der Modellbildung nicht hinreichend genau berücksichtigt, wenn man nur die Durchschnittswerte der Zeitspannen miteinander vergleicht, um Veränderungen zu erkennen. Um diese Schwäche zu beheben und externe Einflüsse auch hinsichtlich plötzlicher Veränderungen angemessen zu würdigen, kann Klima als „System“ aufgefasst und mit Charlotte Werndl6 definiert werden als „Verteilung der Klimavariablen über die Zeit, die unter bestimmten Regimen von variierenden externen Bedingungen auftreten“7. Die deutsche Version der Wikipedia definiert das Klima als „Durchschnitt der dynamischen Prozesse in der Atmosphäre […] basierend auf einer Vielzahl von Klimaelementen“8.
Es geht also um ein dynamisches System mit Variablen und Elementen, das statistisch („Verteilung“, „Durchschnitt“) erfasst wird. Ausgehend von dieser Definition lässt sich nun feststellen, dass sich das Klima in den letzten Jahrzehnten besonders rasch und drastisch hat, in einer Weise, die Anlass gibt zur Sorge, vor allem aber zur Ursachenforschung und zur Strategieentwicklung im Blick auf die erwartbaren Folgen des Klimawandels. Also: Das Klima hat sich immer schon gewandelt – aber noch nie so plötzlich, so abrupt, so heftig wie momentan.
Um dabei eine Orientierung zu erhalten, ist ein Blick in die Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) unabdingbar. Das IPCC ist keine eigene wissenschaftliche Einrichtung im engeren Sinne, aber auch kein politischer Debattierclub,9 sondern ein Gremium, in dem Wissenschaftler für die Politik in ziemlich regelmäßigen zeitlichen Abständen den Sachstand der Klimaforschung kurz und verständlich darlegen, um den Verantwortlichen eine Entscheidungsgrundlage zu geben. Es hat also eine politische Funktion, unterliegt jedoch bei seiner Arbeit – anders als etwa der Meinungsstreit in einem Parlament – (natur)wissenschaftlichen Standards. Das IPCC übernimmt damit die wichtige Rolle einer Vermittlungsinstanz zwischen den Systemen „Wissenschaft“ und „Politik“, es bietet seriöse Übersetzungsleistungen und begründet Handlungsempfehlungen (an die kein Staat und kein Gremium gebunden ist) mit Forschungsresultaten – es „macht“ damit (indirekt) Politik. Nur: Das machen alle, die Politikerinnen und Politiker aus Expertensicht beraten. Und ohne Beratung fehlte den meisten Abgeordneten bei den meisten Fragen die Kompetenz, zu einer fundierten Entscheidung zu kommen.10 Ich werde im Verlaufe des Gedankengangs ab und an auf das IPCC und seine Sachstandsberichte zurückkommen. Doch zunächst zu den beobachtbaren Fakten.
1.1.1 Es wird wärmer
Die globale Mitteltemperatur11 war in den letzten 2000 Jahren noch nie so hoch wie heute.12 Schaut man sich den Temperaturverlauf genauer an, ergibt sich ein deutliches Bild, das des berühmten „Hockeyschlägers“13. Die eindrucksvolle Kurve ist weder eine „Fälschung“14, noch ist ihre Aussage „vor Gericht widerlegt“15 worden. Sie basiert auf validen direkten und indirekten Klimadaten (neben Temperaturmessungen auch „Proxys“16 wie Daten aus Bohrkern-Untersuchungen des Polareises) sowie anerkannten statistischen Methoden: „Das Hockeyschläger-Diagramm wurde von verschiedenen Seiten mehrfach auf Fehler überprüft. Die Ergebnisse von Mann et al. wurden damit mehrfach bestätigt“17. Die globale Durchschnittstemperatur ist heute wahrscheinlich sogar höher als in den letzten 120.000 Jahren.18 Und auch die vor über 20 Jahren vorgenommene Extrapolation bis zum Jahr 2100 kann in ihrem Verlauf bis heute, also: bis zum Jahr 2020, als „Treffer“ gewertet werden: Die Projektion sieht im Mittel eine Erhöhung um etwa ein Grad vor – genau das ist eingetreten.19
Direkt feststellen – also: messen – lässt sich ein Anstieg der globalen Mitteltemperatur in den vergangenen 170 Jahren um etwa ein Grad.20 Lag die globale Mitteltemperatur um 1850 bei etwa 13,8 Grad Celsius, so liegt sie heute (2019) bei rund 14,8 Grad Celsius.21
Das scheint zunächst in Ordnung zu sein, denn: Ist nicht 15 Grad das „Ideal“22? Dann hätten wir sogar noch ein wenig „Luft nach oben“. Nein, nicht ganz. Entscheidend ist nämlich nicht die absolute Temperatur, sondern die Temperaturerhöhung.23 Und die liegt bei einem Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, Tendenz steigend, so dass mittlerweile selbst gegenüber dem bereits wärmeren 20. Jahrhundert ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen ist: „The average temperature across the globe in 2019 was 1.71 degrees F (0.95 of a degree C) above the 20th-century average“24. Die 1-Grad-Steigerung lässt sich also für immer kürzere Perioden nachweisen – es reicht ein Blick auf die letzten 50 Jahre.
Auch das scheint zunächst wenig spektakulär zu sein, doch ein Grad mehr ist bereits bedrohlich, zumal der Trend einen weiteren Anstieg erwarten lässt. Ein Beispiel: Wenn der Mensch eine Körpertemperatur von 37 Grad hat, geht es im gut. Bei 38 Grad hat er Fieber – ein Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht stimmt. Steigt die Temperatur weiter an, ist mit schweren gesundheitlichen Schäden zu rechnen, auch dauerhaften. Am Ende (bei 42 Grad, also plus fünf Grad) ist sogar das Leben des Menschen in Gefahr. Ähnlich sensibel reagiert auch die Erde. Daher soll der Anstieg Temperatur auf maximal zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Setzt man dafür den Wert von 1850 als Referenzgröße, hätten wir die Hälfte des maximalen Anstiegs bereits erreicht, vor allem durch den extrem rasanten Temperaturanstieg der letzten 50 Jahre, der sich in den vergangenen 25 Jahren noch einmal beschleunigt hat.25 Auch die Dynamik spricht also für weitere Temperaturerhöhungen: Das letzte Jahrzehnt war das „heißeste der Geschichte“, d.h. seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA und der NOAA, die US-amerikanische Behörde für Ozeanforschung feststellten.26 Hält der Trend der letzten fünfzig Jahre an, würde das „Zwei-Grad-Ziel“ bereits Mitte des 21. Jahrhunderts – also in einer Generation – erreicht.
Der Temperaturanstieg lässt sich weltweit, also überall, beobachten.27 Nicht überall in gleicher Stärke, aber doch überall. Das ist verhältnismäßig neu; vor der Industrialisierung gab es diese Synchronität der Temperaturveränderung nicht.28 Man spricht daher von „global warming“. Es scheint also ein Phänomen zu geben, dass die Wärme über die Oberfläche der Erde verteilt, bei dem etwas eine zentrale Rolle spielt, dass überall in ähnlicher Weise vorhanden ist, unabhängig davon, ob wir uns auf Landflächen oder auf dem Meer befinden, unabhängig davon, ob wir von Städten oder Dörfern, von Bergen oder Tälern, von Industriegebieten oder Agrarzonen, von Wüsten oder Wäldern sprechen. Darauf werden wir zurückkommen müssen (Kapitel 1.2.3 und 1.2.4).
Die Häufung von Hitzewellen in den letzten zehn Jahren belegt den Temperaturanstieg deutlich.29 Besonders dramatisch waren die beiden marinen Hitzewellen 2014 und 2019, die schwere Schäden an Flora und Fauna verursachten, aber auch für die Menschen Folgen haben: „Die Veränderungen in den Ozeanen sind sehr ernst und werden direkte Konsequenzen für die Menschheit haben“30, so der Klimatologe Nicholas Bond von der University of Washington. Bestätigt wurden diese Befunde durch eine Studie des Instituts für atmosphärische Physik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, die Anfang 2020 veröffentlicht wurde.31
Auch bei uns lässt sich ein zuletzt besonders drastischer Temperaturanstieg nachweisen.32 In Deutschland ereigneten sich sechs der elf extremsten Hitzewellen zwischen 1950 und 2015 nach dem Jahr 2000 – obwohl bei statistischer Gleichverteilung nur zwei bis drei „Treffer“ in diesem Zeitraum zu erwarten gewesen wären.33 Der Sommer 2018 war der zweitheißeste seit Beginn der hiesigen Wetteraufzeichnungen im Jahre 1881, der Sommer 2003 war der heißeste.34 Sieben Winter seit dem Ende der 1980er Jahre (in absteigender Reihenfolge: 2006/2007, 2015/2016, 1989/1990, 1988/1989, 2007/2008, 1997/1998, 1994/1995, 1987/1988) gehörten zu den zehn wärmsten Wintern seit Beginn der Aufzeichnungen.35
Das Jahr 2018 war insgesamt das viertwärmste,36 das Jahr 2019 ist das drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen, so der Deutsche Wetterdienst nach Auswertung der Daten seiner rund 2000 Messstationen.37 Weiteres Ergebnis der Analyse: Es gab vergleichsweise wenig Niederschlag bei überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden.38
Haben vielleicht – so ein naheliegender Einwand – die Messstationen bzw. ihre Lage, ihre Standorte die Temperaturmessungen beeinflusst? Sind die Messreihen zur Erdtemperatur, auf deren Basis der Temperaturanstieg (und damit letztlich auch der Klimawandel) diagnostiziert wurden, durch menschliche Einflüsse verzerrt? Also: Haben wir vielleicht einfach falsch gemessen?39 So etwas kommt vor – Messfehler sind immer möglich. Die Seite klimafakten.de sagt jedoch: Nein, wir haben nicht falsch gemessen. Denn: „Der Trend der Erderwärmung kann mit unzähligen Daten von Wetterstationen und anderen Quellen belegt werden“40. So gibt es neben den Daten der erdgebundenen Stationen auch Daten aus Messungen mit Wetterballons und Satelliten. Die Einflussfaktoren auf die Messung sind freilich auch den Klimaforschern bekannt und werden entsprechend berücksichtigt. Es findet ein Abgleich der Messdaten aus Städten mit denen auf dem Land statt, um eine Verfälschung durch urbane „Wärmeinseln“ auszuschließen. Alle diese Daten zusammen ergeben ein unmissverständliches Bild: Es wird wärmer. Und zwar deutlich: In den letzten 50 Jahren um etwa 0,2 Grad Celsius pro Dekade.41 Geht alles so weiter wie bisher, wird die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 verglichen mit dem vorindustriellen Stand um 3,7 bis 4,8 Grad Celsius steigen.42 Zur Erinnerung: Ein Menschenleben wäre bei diesem hohen Fieber gefährdet – hochgradig.
1.1.2 Das hat Folgen
Der globale, aber auch der regionale Temperaturanstieg hat beobachtbare Folgen. Die sind vornehmlich negativ. Geradezu zynisch anmutende Einschätzungen zu den angeblichen Vorzügen der Erderwärmung, wie sie etwa in einem Beitrag der Zeitschrift Focus aus dem Jahr 2010 zum Ausdruck kommen („Es wird wärmer – gut so!“43), sind längst vielfach widerlegt. Der Tenor der Wissenschaft ist: Zwar können sich lokal und regional Vorteile ergeben, global betrachtet ist der Klimawandel allerdings von großem Nachteil für die Natur (Biodiversität44) und viele Lebensbereiche des Menschen (Gesundheit, Ernährung, Sicherheit) – vor allem in Regionen mit geringer Resilienz, also in den Ländern, „die am wenigsten in der Lage sind, sich sozial oder wirtschaftlich darauf einzustellen“45.
Zu den negativen Folgen einige Beispiele.
1.1.2.1 Eis wird weniger
Die große Mehrzahl der weltweit rund 160.000 Gletscher geht zurück. Seit etwa 50 Jahre beschleunigt sich diese Entwicklung. Das hat dazu geführt, dass den Menschen in vielen Bergregionen wie dem Himalaja in den letzten Jahrzehnten mehr Wasser zur Verfügung stand, was die Produktivität der Landwirtschaft erhöhte. Doch diese Wasserquelle droht zu versiegen, möglicherweise sogar schon bis zum Ende des 21. Jahrhunderts.46
Tatsächlich ist an einigen Gletschern ein Massewachstum zu beobachten – doch das sind Einzelfälle. Kurzfristige oder punktuelle Beobachtungen sagen wenig aus über den allgemeinen Trend. Der ist eindeutig: die Gletscher gehen zurück. Weiterhin ist ein allmähliches Auftauen der tundrischen und alpinen Permafrostböden zu beobachten sowie insgesamt eine Verringerung der Permafrostgebiete in der Nordhemisphäre zu erwarten.47 Diese könnten bis 2080 um etwa ein Viertel zurückgehen.48Zudem: Das Festlandeis an den Polkappen schmilzt.49 Auch das ist in dieser Form für die letzten Jahrtausende neu. Berichte über ein ehedem bewaldetes Grönland („Grünland“) dürfen nicht dahingehend missverstanden werden, das ganze Gebiet sei vor 1000 Jahren eisfrei gewesen. Das wäre eine historischphilologische Fehlleistung, gemessen am Aussagegehalt der zugrundegelegten Texte, vor allem aber an den wissenschaftlichen Befunden zur Naturgeschichte dieser Region; eisfrei war (und ist) Grönland nur an den Küsten.50
1.1.2.2 Meeresspiegel steigt
Daraus folgt: Der Meeresspiegel steigt, um etwa 3,3 Millimeter pro Jahr.51 Das sind in 100 Jahren 33 Zentimeter. Auch hier ist die Tendenz steigend. Für das Jahr 2018 wurde der Rekordwert von 3,7 Millimeter gemessen.52 Die Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs seit Mitte des 19. Jahrhunderts – also seit dem vorindustriellen Zeitalter – war größer als die mittlere Geschwindigkeit in den vorangegangenen zwei Jahrtausenden.53 Dabei ist der Anstieg nicht gleichmäßig, sondern „überall ein bisschen anders“54, was die Lage nicht besser macht.
Zudem wird das Meer wärmer. Wärmeres Wasser dehnt sich aus, der Meeresspiegel steigt aufgrund dessen noch mehr an. Mit der Umwandlung von Eis in Wasser wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt, der mit der Albedo (der „Weißheit“ der Erdoberfläche)55 zu tun hat: Eis ist hell, Wasser ist dunkel. Die Wärmestrahlung wird von hellen Flächen stärker reflektiert als von dunklen. Eine kleinere Eisfläche (hell), eine größere Wasserfläche (dunkel) – das heißt im Ergebnis eben auch: eine geringe Reflexivität der Erdoberfläche insgesamt; umgekehrt: eine höhere Absorption von Wärmestrahlung. Das wiederum bedeutet: Temperaturanstieg, noch mehr abschmelzendes Eis, eine Verstärkung des beschriebenen Effekts, was erneut zu Temperaturanstieg führt. Wie gesagt: Ein Teufelskreis. Das Schlimmste in Sachen Meeresspiegelanstieg steht uns nach Meinung von Stefan Rahmstorf56 ohnehin noch bevor:„Bei weiterer Klimaerwärmung wird der Anstieg sich weiter beschleunigen. Der Meeresspiegel reagiert sehr langsam, deshalb liegt der größte Anstieg noch vor uns, selbst wenn wir ab jetzt nichts mehr emittieren.“57
Wie hoch das Meer dabei noch ansteigen wird, dazu gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Das IPCC ging 2007 noch von einem Anstieg von 0,18 bis 0,59 Meter bis zum Jahr 2100 aus, im Bericht von 2014 dann korrigiert auf 0,26 bis 0,82 Meter.58 Das National Research Council der Vereinigten Staaten hielt im Jahr 2010 einen Meeresspiegelanstieg von 0,56 bis 2,00 Meter für möglich.59 Vor allem für asiatische, aber auch für die deutschen Küstenregionen werden negative Auswirkungen erwartet.60
1.1.2.3 Wetter wird extremer
Eine Häufung von Extremwetterereignissen lässt sich ebenfalls mit dem Klimawandel verbinden:61 Stürme,62 Starkregenfälle, Dürren63, Hitzewellen – all das häuft sich.64 Der Klimawandel befördert damit Naturkatastrophen. Zuletzt war von einer „Verdopplung der Naturkatastrophen“65 zu lesen; 2018 meldete das UN-Büro für Katastrophenvorsorge (UNISDR) in Genf, die Zahl der klimabedingten Katastrophen sei „von durchschnittlich 165 auf 329 pro Jahr gestiegen“66.
Hier muss man allerdings sehen, dass man den Klimawandel mit Wetteränderungen weder widerlegen noch beweisen67 kann. Nicht jede Änderung von Wetterbedingungen hat mit dem Klimawandel zu tun. Wie kann man aber Klima auf der einen Seite und Wetter auf der anderen Seite zusammenbringen? Nur über den Begriff der Wahrscheinlichkeit: „Eine wärmere Atmosphäre enthält über einen höheren Wasserdampfgehalt mehr Energie als eine kühlere Luftmasse und somit auch ein größeres Unwetterpotenzial“68.
Aus dem Unterschied von „Klima“ und „Wetter“, den Sven Plöger und Frank Böttcher wie folgt auf den Punkt bringen: „Wetter ist jetzt und hier, Klima ist immer und überall“69, ergeben sich unterschiedliche Ansprüche an die Prognosegenauigkeit hinsichtlich Zeit und Ort von Ereignissen: Bei der Wettervorhersage will man genaue punktuelle Angaben, mit den Klimamodellen erhält man nur ungefähre, tendenzielle Angaben. Aber dennoch liefert uns das in beiden Fällen handlungsrelevante Informationen. Wenn die Wettervorhersage für heute 16 bis 18 Uhr prognostiziert „Regenwahrscheinlichkeit in Berlin: 90 Prozent“, dann nehme ich einen Schirm mit. Wenn die Klimamodelle prognostizieren, dass die Regenverteilung in Berlin künftig extremer sein wird als zuvor (mehr Dürreperioden, mehr Starkregenfälle), dann muss ich mich, müssen wir uns (als Gesellschaft) dazu auch etwas überlegen: Wie können wir das Schlimmste verhindern?
Ein schönes Bild für diesen Unterschied in der Prognostik hat der Klimaforscher Mojib Latif geprägt: das Bild vom Würfelspiel.70 Die Wettervorhersage gibt an, die der Fall der Würfel für die nächsten zehn Spiele ist (also z.B.: 1, 2, 3, 4, 5 ‚ 6, 1, 2, 3, 4). Das Klimamodell sagt uns etwas über die Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse 1 bis 6 auf den Spieleabenden der nächsten 10 Jahre. Also, es sagt etwas darüber aus, wie sich die ideale theoretische Verteilung (1/6 mal die „1“, 1/6 mal die „2“ usw.) ändert, wenn der Würfel gezinkt ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine „6“ wird, wenn der Würfel entsprechend präpariert wurde (etwa durch Bleiauflagen unterschiedlicher Dicke an der Mulde der „1“, oder Einlassen eines Bleikügelchens in diesem Bereich o.ä.). Dabei bleibt offen, wann und wo genau die „6“ tatsächlich fällt, es wird lediglich gesagt (nur das kann angegeben werden), dass die „6“ in ihrer Häufigkeit – je nach Methode – mehr oder weniger stark zunimmt, z.B. um 20 Prozent bei 5mg Blei, um 30 Prozent bei 8mg Blei usw.; diese Angaben sind sicher nicht korrekt – es geht ums Prinzip.
Wenn nun bei einem bestimmten Spieleabend die „6“ signifikant häufiger fällt als statistisch zu erwarten, dann kann das ein Hinweis auf eine solche Manipulation sein. Wenn sich das an den Spieleabenden der nächste Monate und Jahre immer wieder zeigt, verdichten sich die Hinweise. Ein Beweis ist das freilich noch nicht – und man sollte nicht voreilig vom Wetter auf das Klima schließen. Umgekehrt – so zeigt das Würfelbeispiel ebenfalls – geht das auch nur tendenziell. Globale Erwärmung heißt nicht, dass wir bis 2070 in Deutschland fünfzig heiße, trockene Sommer haben werden, sondern nur, dass wir in diesem Zeitraum mehr heiße, trockene Sommer haben werden als ohne Klimawandel. Wann diese im einzelnen sind, kann uns kein Klimamodell verraten. Wohl aber, dass es zu den erwartbaren heißen, trockenen Sommern einen Aufschlag geben wird – entsprechend dem Grad der Klimaveränderung – also: der Manipulation, die geschieht.
Eine Änderung des Klimas hat also das Potenzial, Wetteränderungen herbeizuführen, eine extreme Änderung des Klimas führt vermehrt zu Extremwetter – ohne, dass damit ein Determinismus Einzug hielte. Auch in einer Plus-fünf-Grad-Welt kann es zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort für eine bestimmte Dauer unangenehm kalt sein, bloß wird dieses Wetter unter jenem Klima immer unwahrscheinlicher.
1.1.2.4 Ernten fallen aus
Ernten fallen – auch in Europa –71 in Folge der Klimaerwärmung und der damit einhergehenden Wetterbedingungen niedriger aus als üblich, global sind langfristig vor allem Getreide wie Weizen betroffen,72 Grundlage der Broterzeugung.73 Die Zuwachsraten der letzten Jahre sind allein größeren Anbauflächen, besseren Düngemitteln, veredelten Saatgutsorten und effektiverer Bewässerung geschuldet, für die Zukunft gilt weiterhin: „The driving factor has to be the fertilizers, the seed varieties, the irrigation“74 – doch das Ende der Fahnenstange ist allmählich erreicht. Gerade die Landwirtschaft in den ärmeren Regionen der Welt wird unter den Folgen des Klimawandels leiden.
1.1.2.5 Menschen erkranken
Neue Krankheiten entstehen,75 Krankheiten breiten sich aus, zum Teil in direkter Folge der Erwärmung,76 zum Teil auch, weil diese die Verbreitung von Krankheitserregern fördert77. Einen guten Überblick dazu gibt das Umweltbundesamt.78 Gerade die kommenden Generationen werden das spüren.79 Auch die Forschung interessiert sich mittlerweile gezielt für den Zusammenhang von Klima und Krankheit.80
Ein besonders prägnantes Beispiel ist die Zunahme von Fällen der Frühsommer-Meningoenzephalitis im Winter, der einzigen Jahreszeit, in der man (früher) von Zecken verschont blieb, denn: „Zecken benötigen für ihre Aktivität eine gewisse Mindesttemperatur. Eine Erwärmung könnte dazu führen, dass sich diese Mindest-Temperatur in nördlicheren Regionen und in höheren Höhen einstellt und damit eine Zeckenaktivität möglich macht“81. Wenn Die Zeit feststellt: „2018 erkrankten überdurchschnittlich viele Menschen an der von Zecken übertragenen Krankheit. Erstmals wurde ein FSME-Risikogebiet in Norddeutschland ausgewiesen“ und diese „Zunahme von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“ mit „Vermutlich habe der gute Sommer 2018 günstige Bedingungen für die Übertragung von FSME-Viren geschaffen“ erklärt wird,82 dann ist das trotz der in diesem Kontext etwas sarkastischen Wortwahl („gut“ und „günstig“) ein Hinweis darauf, dass der Klimawandel auch indirekt Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann.
Auf globaler Ebene wird eine „klimaresiliente Gesundheitspolitik“83 nötig. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert dazu vier Handlungsfelder: Aufbau von Partnerschaften, Bewusstseinsbildung, Stärkung der wissenschaftlichen Forschung und Unterstützung der Reaktionsfähigkeit des Gesundheitswesens auf die Klimaveränderung.84 Vor allem der Bildung über klimabedingte Gesundheitsrisiken kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: „Der Mangel an Bewusstsein über die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit ist größtenteils verantwortlich für eine höhere Verwundbarkeit der Gesellschaft. Aus diesem Grund muss eine umfassende Aufklärung über diese Zusammenhänge geschaffen werden, um die Widerstandsfähigkeit und Selbstkompetenz der Bevölkerung und der Gesundheitssysteme zu stärken“85.
1.1.2.6 Gewalt nimmt zu
Klimawandel und Krieg – es gibt einen Zusammenhang. Der Klimawandel ist eine Frage der globalen Sicherheit, und dabei mindestens genauso wichtig wie beispielsweise das Problem des Terrorismus‘. Der Soziologe Harald Welzer geht sogar so weit, von „Klimakriegen“ zu sprechen, auch wenn es „vorstellungswidrig“ zu sein scheint, dass „ein naturwissenschaftlich beschriebenes Phänomen wie die Klimaerwärmung soziale Katastrophen wie Systemzusammenbrüche, Bürgerkriege, Völkermorde bereithalten könnte“, doch „viel vorauseilende Phantasie ist gar nicht nötig, um sich das vorzustellen, lassen sich doch bereits für die Gegenwart umweltbedingte soziale Gewaltkonflikte und Sicherungsmaßnahmen beschreiben“86. Gwynne Dyer meint in diesem Sinne, die „Wahrscheinlichkeit von Kriegen bis hin zu Atomkriegen wächst mit dem Anstieg der Temperatur um 2-3 ° C bereits erheblich“87.
John Podesta und Peter Ogden kommen nach regional fokussierten Analysen zu Afrika, Südasien und China sowie zur Rolle von UNO, EU und USA, die sie im Rahmen der Klimawandelfolgen geopolitisch in der Pflicht sehen, zu einem differenzierten Urteil: Zwar stünden keine durch Dürren provozierte „Wasser-Kriege“ unmittelbar bevor, aber dennoch sei der Klimawandel eine Frage der Sicherheit, weil sich durch dessen Folgen (also Naturkatastrophen und in weiterer Folge Knappheit und Seuchen) zum einen das Problem des Staatszerfalls in verschärfter Form stelle, was zum Souveränitäts- und damit Sicherheitsvakuum vor Ort führe (die Autoren nennen Ost-Afrika und Nigeria), zum anderen dieses Problem über Flüchtlingsströme nach Europa getragen werde (vgl. Kapitel 1.1.2.7), wo sich im Zuge einer mittelbaren Betroffenheit nicht nur die demographische Situation und die Sozialstruktur ändere, sondern gleichfalls die Sicherheitslage sich verschlechtere; die Autoren verweisen auf die wachsende Gefahr ethnisch und religiös motivierter Konflikte.88 Podesta / Ogden sind der Meinung, dass in der globalen Sicherheitsfrage zwar de jure die Vereinten Nationen zuständig, de facto aber die USA gefordert sind, weil sie den Betroffenen als erster Ansprechpartner gelten: „Although some of the emergencies created or worsened by climate change may ultimately be managed by the UN, nations will look to the United States as a first responder in the immediate aftermath of a major natural disaster or humanitarian emergency“89. Interessant ist dabei die Tatsache (und sie offenbart eine gewisse Ironie), dass die USA, die bislang präventiv kaum engagiert sind, reaktiv in die Pflicht genommen werden und sich zudem die US-Doktrin des Anti-Terror-Kriegs („If the UN will not act, the U.S. will“, Georg W. Bush) als normative Forderung im Rahmen der Klimawandel-Problematik positiv wenden lässt: „Wenn die Vereinten Nationen nicht können, dann müssen die USA“.
Und das kann schon bald der Fall sein. Durch den Klimawandel nehmen Landkonflikte zu, bestehende ethnische bzw. religiöse Spannung brechen in offene Konflikte aus. „Der Klimawandel verstärkt den Wettstreit um die Ressourcen – Wasser, Nahrungsmittel, Weideland – und daraus können sich Konflikte entwickeln“, meint auch UN-Generalsekretär António Guterres.90 Sein Amtsvorgänger, Ban Ki-moon, riet bereits 2014 dazu, die Vulnerabilität angesichts der Klimawandelfolgen als einen Aspekt der komplexen Ursachen bewaffneter Konflikte zu betrachten: „Armed conflicts are becoming ever more complex and require solutions that address the root causes. Issues of poverty, vulnerability to climate shocks, ethnic marginalization and the transparent, sustainable and equitable management of natural resources must be considered within and alongside peace agreements if we are to build more resilient and prosperous societies“91. Diese Konflikte haben ihrerseits Folgen, eine davon: Flucht.92
1.1.2.7 Menschen fliehen
Weltweit sind derzeit über 70 Millionen Menschen auf der Flucht.93 Frage: Wie viele davon wegen des Klimas? Antwort: Wir wissen es nicht. Die Zahlen, die gehandelt werden, sind alarmierend, bisweilen auch alarmistisch. So ging die Umweltorganisation Greenpeace 2010 davon aus, es könnten „200 Millionen Klimaflüchtlinge [..] weltweit in den nächsten 30 Jahren drohen, wenn sich der menschengemachte Klimawandel so wie bisher fortsetzt“94, eine Zahl, die bereits Mitte der 1990er Jahre aufkam und seitdem oft genannt wird, die aber wohl zu hoch liegen dürfte.95
Einer Studie zufolge sollen allein im ersten Halbjahr 2019 rund sieben Millionen Menschen vor „extremen Wettersituationen und Naturkatastrophen geflohen“ sein,96 das wäre also jeder zehnte Flüchtling. Doch nicht jede Naturkatastrophe ist notwendig klimawandelbedingt. Erdbeben und Vulkanausbrüche etwa zwingen viele dazu, ihre zerstörten Häuser zu verlassen, Erdbeben97 und Vulkanausbrüche98 haben aber – nach allem, was wir wissen – mit dem Klimawandel nicht so gesichert etwas zu tun, dass man sie nun unter allen Umständen darunter subsumieren müsste. Umgekehrt muss es nicht bis zur Naturkatastrophe gekommen sein – ein handfester Landkonflikt wegen Missernten reicht aus, um die Heimat wegen mangelnder Perspektiven verlassen zu müssen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat 2012 ein Arbeitspapier zur Klimamigration herausgegeben,99 das auf 80 Seiten den Stand der Dinge darlegt. Darin wird festgehalten, dass es schwierig ist, die Zahl der wegen des Klimas geflüchteten Menschen zu nennen, weil oft andere Gründe unmittelbar zur Flucht motivierten, diese aber (auch) klimawandelbedingt sind oder sein können. Missernten und Landkonflikte führen zu Armut und Perspektivlosigkeit und dieser Zustand zur Migrationsentscheidung – hinter Missernten und Landkonflikten verbirgt sich dann aber wiederum oft der Klimawandel, der als Fluchtgrund zwar nicht wahrgenommen wird, auch nicht von den Betroffenen selbst, gleichwohl er die eigentliche Ursache ist. Man muss einzelnen Fluchtgeschichten auf den Grund gehen, um das zu erkennen. Das ist mühsam. Trotz der zugestandenen Unsicherheiten hinsichtlich der Zahlen „werden jedoch komplexe Zusammenhänge deutlich, die Handlungsbedarf nach sich ziehen“, so das BAMF.
Zur Vorsicht im Umgang mit dem Konzept des „Klimaflüchtlings“ rät unterdessen Benjamin Schraven vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik: Zwar hätte auch der Klimawandel Einfluss auf Migration und Flucht, aber viele weitere Faktoren spielten eine sehr große Rolle – es gebe auf keinen Fall einen Automatismus.100 Auch wenn es den nicht gibt und Migrationsentscheidungen nicht monokausal, sondern äußerst komplex sind, spielt der Klimawandel mittelbar eine Rolle, weil er sich negativ auf Pushfaktoren wie Armut und Gewalt auswirkt. Gerade Menschen aus der Subsahararegion werden im Zuge der Klimawandelfolgen ihre Heimat verlassen – müssen.101 Harald Welzer stellt dazu fest: „Da die härtesten Klimafolgen die Gesellschaften mit den geringsten Bewältigungsmöglichkeiten treffen, wird die weltweite Migration im Laufe des 21. Jahrhunderts zunehmen und jene Gesellschaften zu radikalen Problemlösungen veranlassen, in denen der Migrationsdruck als Bedrohung empfunden wird“102. Das wiederum schließt Gewalt als „Problemlösung“ ein, wodurch weiterer Migrationsdruck erzeugt wird. Der Klimawandel könnte nach einer Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses künftig als Asylgrund anerkannt werden.103
1.1.2.8 Kultur geht unter
Viele Kulturstätten sind angesichts der Klimawandelfolgen in ihrem Bestand gefährdet, etwa der Tempel des Epikureer Apollon und das antike Olympia in Griechenland.104 Ganz buchstäblich droht auch eine besonders häufig besuchte Kulturstätte unterzugehen: wie der Markusplatz in Venedig.105 Das wäre eine Katastrophe106 – nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Menschheit. Insgesamt sind „Dutzende Welterbe-Stätten bedroht“107, darunter die Basilika von Aquileia und der Dom von Ferrara (beide in Italien) sowie die Kathedrale St. Jakob von Sibenik und die Inselstadt Trogir (beide in Kroatien). Auch immaterielle Kulturgüter wie traditionelles Wissen und besondere Sozialstrukturen sind von Klimawandel bedroht.108
1.1.2.9 System könnte kippen
Das Klimasystem könnte insgesamt „kippen“: So genannte „tipping points“ („Punkte des Umkippens“ oder „Kipppunkte“) könnten erreicht werden, wodurch „schlagartig extreme Auswirkungen auf das gesamte globale Klima“109 einträten.110
„Es gibt inzwischen starke Belege dafür, dass das Golfstromsystem sich bereits so, wie von den Klimamodellen vorhergesagt, abgeschwächt hat – um rund 15 Prozent. Die dadurch verursachte Kälteblase liegt draußen über dem Atlantik und betrifft bislang keine Landgebiete. Es besteht aber ein schwer kalkulierbares Risiko, dass das System kippen könnte.“111 Nach Ansicht von Tim Staeger aus der ARD-Wetterredaktion „ist nicht auszuschließen, dass bei einem Überschreiten einer noch unbekannten Temperaturschwelle im Zuge der globalen Erwärmung noch unerforschte Prozesse in Gang kommen, die dann innerhalb weniger Jahrzehnte ebenfalls heftige Reaktionen im Klimasystem hervorrufen könnten“112.
Vor einem schnelleren Erreichen von „tipping points“ warnte im November 2019 ein Kommentar in Nature113. Klimaforscher betonten darin, es gebe „Belege für einen planetaren Not-fall“114. Einer der Autoren des Kommentars, Hans Joachim Schellnhuber (von 1991 bis 2018 Leiter des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK), warnt daher, wir seien „mitten im Klimanotstand“115.
1.1.3 Das hat Gründe
Wie gesagt: Der Klimawandel ist kein neues Phänomen. Neu ist jedoch, dass er schneller abläuft als je zuvor, und dass zur Erklärung dieser Dynamik die üblichen Ansätze nicht mehr ausreichen. Woran liegt aber diese Entwicklung nun? Was ist in den letzten 150 Jahren anders gewesen als zuvor? Welches Phänomen umfasst die Erde als ganze? Mögliche erste Antworten lauten: die Industrialisierung und die Atmosphäre. Bringen wir die beiden Dinge zusammen, dann könnte sich eine Erklärung ergeben. Zunächst ist es ein Verdacht: Die Veränderung des Klimas könnte eine Manipulation sein, die mit der Industrialisierung und der Atmosphäre zu tun hat. Es könnte also eine technisch-ökonomisch begründete und mit einer Einwirkung auf die Beschaffenheit der Atmosphäre einhergehende Manipulation durch den Menschen sein, mit der wir es zu tun haben, und die uns das, was wir beobachten, hinreichend gut erklären lässt. Der Verdacht lautet also: Wir manipulieren das Klima, wir zinken den Würfel.
Gehen wir diesem Verdacht nach. Denn: Sollte der Mensch daran irgendwie beteiligt sein, wäre der Klimawandel ein Thema der Ethik, ein Thema der Politik, ein Thema der Religion. Umgekehrt gilt: Eine Diskussion über Methoden des Klimaschutzes (Vermeidung oder Anpassung) ist sinnvoll nur dann möglich, wenn man dessen Notwendigkeit grundsätzlich anerkennt. Und das geht nur unter der Voraussetzung, dass der Mensch überhaupt in der Lage ist, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Geht es um Mitigationsmaßnahmen, muss man dafür schließlich notwendig voraussetzen, dass der Mensch in einem relevanten Maße Ursache des Klimawandels ist. Die These vom menschengemachten oder anthropogenen Klimawandel ist also notwendig für jede Vermeidungsstrategie beim Klimaschutz.
1.2 Erklärung
Schauen wir zunächst einmal, was die Lexika meiner Eltern dazu sagen. Wenn man in alten Lexika der 1950er oder 60er Jahre schmökert, kann man in den Definitionen lesen, wie der natürliche Klimawandel erklärt wird. In Herders Neues Volkslexikon (1974) findet man unter dem Schlagwort „Klimaschwankungen“ als Definition: „in größeren Zeitabschnitten der Erdgeschichte wiederkehrende Änderungen des Großklimas“. Als Gründe für diese Änderungen werden genannt: „period. Änderung der Erdbahnelemente“, „sich ändernde Verteilung v. Land u. Meer“ und „kosmische Einflüsse (z.B. interplanetare Materie zwischen Sonne u. Erde)“. Im Bertelsmann Volkslexikon