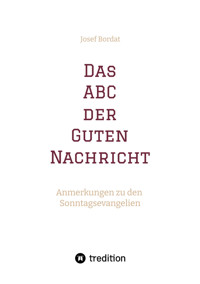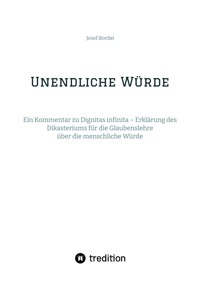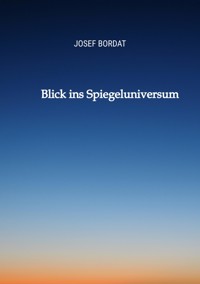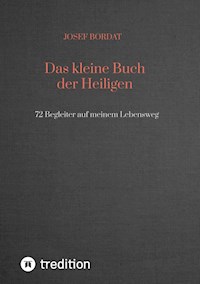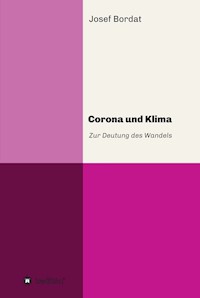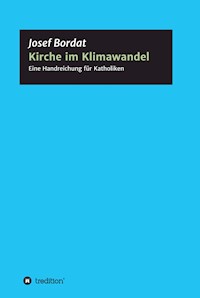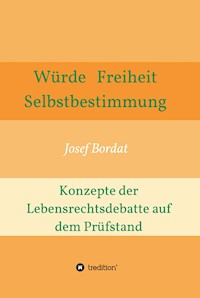
Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand E-Book
Josef Bordat
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frei und selbstbestimmt leben, das wollen wir alle. Unsere Würde geachtet und geschützt wissen, auch das wollen wir. Nur: Was bedeutet das? Schrankenlose Möglichkeitsräume oder ein Leben unter Bedingungen? - Der katholische Philosoph und Publizist Josef Bordat betrachtet die zentralen Begriffe der Lebensrechtsdebatte aus philosophischer, theologischer und biblischer Sicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Josef Bordat
Würde, Freiheit, Selbstbestimmung
Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand
Für
Claudia Sperlich
* * *
In dankbarem Gedenken an
Eberhard Schockenhoff,
der am 18. Juli 2020 verstarb.
© 2020 Josef Bordat
Verlag & Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-08420-9 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-08421-6 (Hardcover)
ISBN: 978-3-347-08422-3 (E-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Würde des Menschen kommt jedem Menschen unbedingt zu. Sie wird dem Menschen nicht von anderen Menschen zuerkannt, sie ist unmittelbar Ausdruck seines Menschseins. Für Christen ist dieses Menschsein Geschöpflichkeit: Der Mensch erhält als Abbild Gottes seine Würde vom Schöpfer.
***
Die Freiheit des Menschen ist keine absolute, sie ist gebunden an die moralische Pflicht zum Guten, an die Verantwortung vor dem Menschen und – für Christen – auch und insbesondere vor Gott. Nur in dieser Bindung ist Freiheit vernünftig realisierbar.
***
Für Christen ist das Leben heilig und unbedingt schützenswert. Die Autonomie des Menschen endet an der Grenze dieser Heiligkeit – auch im Hinblick auf das eigene Leben. Selbstbestimmung in Fragen des Lebens und Sterbens droht zur Fremdbestimmung zu werden – der Druck auf kranke und alte Menschen nimmt zu.
Vorwort
Seit einigen Jahren beschäftige ich mich aus bioethischer Perspektive mit Fragen des Lebensschutzes. Das sollte nicht überraschen. Die Themen Abtreibung und Sterbehilfe, die Frage des moralischen Status des Embryo, Vorstellungen des richtigen Umgangs mit Kranken, Behinderten, Alten, Dementen, Sterbenden und Ungeborenen sind grundlegend für Philosophie und Theologie gleichermaßen. Der richtige Umgang mit dem Menschen ist die zentrale ethische Fragestellung; Moral ist eine menschliche Umgangsform.
Die Anthropologie geht der Ethik voraus, weil sie Vorentscheidungen trifft hinsichtlich des Gegenstands, zu dem sich moralisch verhalten werden soll. Wenn ich nicht über das Leben und den Menschen nachdenke, hat es auch keinen Zweck, über Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft und Arbeit, Politik und Publizistik, Kultur und Kunst nachzudenken. Immanuel Kant hat die Frage „Was ist der Mensch?“ als die Synthese aller philosophischen Bemühung betrachtet, als Ausgangs- und Fluchtpunkt zugleich für Epistemologie, Ethik und Ästhetik. Grund genug, Lebensrechtsfragen in den Mittelpunkt zu stellen.
Es waren schließlich zwei Gerichtsbeschlüsse, die mich ganz konkret motiviert haben, zum Thema Lebensschutz bzw. Lebensrecht einige Gedanken in Buchform zusammenzutragen. Denn es waren zwei bahnbrechende Beschlüsse, Entscheidungen, die nicht nur Rechtsverhältnisse ändern, sondern auch moralische Grundeinsichten ins Wanken bringen, die bislang unhinterfragt das Fundament unser christlich-humanistischen Axiologie bildeten:
Erstens, dass man Menschen aus Liebe und wohlverstandener medizinisch-pflegerischer Professionalität im natürlichen Prozess ihres Sterbens hilft, statt ihnen – gegen Gebühr – beim Sterben zu helfen, indem man ihnen zu sterben hilft. Anders sieht es das deutsche Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 26. Februar 2020 (Aschermittwoch).
Und zweitens, dass man immer zunächst im Sinne des Lebens agieren soll, wenn man die Wahl hat, und alles so auszulegen ist, dass es dem Leben und dessen Erhalt bestmöglich dient. Anders sieht es der niederländische Hoge Raad im Beschluss vom 21. April 2020.
Höchstrichterliche Urteile gilt es im Rechtsstaat zu akzeptieren; das ist eine Grundbedingung für dessen funktionieren. Doch auch gegen Urteile höchster Gerichte kann sich das Gewissen sträuben – und in meinem Fall tat es dies. So sehr, dass ich mich fast genötigt sah, meine Position darzulegen.
Ich wähle dabei den Ansatz, die sachlichen Themen Abtreibung und Sterbehilfe den Begriffen ein- und unterzuordnen, die die Debatte um diese Themen wesentlich prägen: Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Eine Analyse dieser Konzepte und ihrer Beziehung zueinander fördert die Irrtümer zutage, mit denen ihre wohlfeile Verwendung heute oft behaftet ist – Irrtümer aus Sicht des christlichen Glaubens, aber auch aus Sicht der philosophischen und theologischen Tradition.
Noch ein philologischer Hinweis: Es handelt sich bei dem Text um einen Essay, bei dessen Abfassung ich meinen Gedanken relativ freien Lauf ließ. Ich habe nicht jeden dieser Gedanken hergeleitet, obgleich mir bewusst ist, wie voraussetzungsreich einige Argumentationsfiguren sind. Auf vertiefende Darlegungen habe ich zugunsten eines schlanken Umfangs verzichtet, obgleich an der einen oder anderen Stelle ein Exkurs der Erläuterung dienen soll. Dazu gehört auch, dass vieles „aus dem Kopf“ zitiert wurde und Nachweise nur oberflächlich erfolgen, weil ich ohne Fußnoten auskommen wollte und eine wissenschaftlich korrekte Zitation im Fließtext störend gewesen wäre.
Es kostete Sie, liebe Leserin, lieber Leser, insofern einige Mühe, die Zitate im Original aufzufinden. Sollten Sie zu einem Zitat die exakte Stelle in den im Literaturverzeichnis genannten Werken nicht finden, helfe ich Ihnen gerne mit genaueren Angaben weiter.
Ein Blick in meine Bücher zur Ethik (2009), zum Gewissen (2013) und zum Grundgesetz (2019) kann hilfreich sein, die Hintergründe meiner Gedankengänge auszuleuchten.
Berlin, im Juli 2020 Josef Bordat
Inhalt
Vorwort * Einleitung
Würde
Würdezuschreibung und Würdevorstellung * Die Würde im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts * Exkurs: Dilemmata im Kontext der Menschenwürde * Das jüdisch-christliche Menschenbild * Lebensschutz im Geiste der Schöpfungstheologie * Exkurs: Todesstrafe aus Sicht der Menschenwürde * Das säkular-philosophische Menschenbild * Exkurs: Menschenwürde und der Begriff der Person * Tiedemanns „Identitätstheorie der Menschenwürde“ * Kants „Humanitas-Formel“ des kategorischen Imperativ * Würde des Menschen und Wert des Lebens * Exkurs: Was kostet der Mensch? * Zusammenfassung
Freiheit
Würde und Freiheit im Christentum * Exkurs: Freiheit und das Lehramt der Katholischen Kirche im 19. Jahrhundert * Freiheit als Thema der Philosophie * Freiheit des Willens * Exkurs: Das Libet-Experiment * Freiheit der Handlung * Exkurs: Das Ich und das Selbstbewusstsein * Freiheit ist relativ * Freiheit und Bindung: Christliche Konzeption * Exkurs: Aufklärung, Sklaverei und Rassismus * Weinstock und Reben * Gewissensfreiheit * Freiheit und Suizidalität * Zusammenfassung
Selbstbestimmung
Würde und Selbstbestimmung * Selbstbestimmung – und ihre Grenzen * Selbstbestimmung und Gewissen * Selbstbestimmung – und doch nicht so ganz * Gleiches Recht für alle? – Gefährliche Weiterungen * Welche Selbstbestimmung soll zählen? * Selbstbestimmung in einer Welt der Beziehungen * Exkurs: Die Menschheit als Netzwerk * Selbstbestimmung und Fremdbestimmung * Mitleidensdruck * Zusammenfassung
Schlussbemerkung * Nachwort
Literatur * Zum Autor
Einleitung
Wer im Internet nach „Hilfe“ im Kontext von „Selbstmord“ bzw. „Suizid“ sucht, bekommt neben der Telefonseelsorge und Psychotests zunehmend auch die Angebote von kommerziellen Sterbehilfeorganisationen angezeigt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum § 217 StGB hat diese Art der „Hilfe“ für suizidale Menschen grundsätzlich möglich gemacht.
Auch wenn das Thema Sterbehilfe vor allem im Kontext schwerer Erkrankungen und älterer Menschen diskutiert wird, zeigt sich doch hier eine gewisse Entgrenzung. Dahinter steht die Normalisierung des Suizids (als „Freitod“ verklärt bzw. missverstanden) unter dem Paradigma der Würde und Selbstbestimmung.
Würde, Freiheit, Selbstbestimmung – mit diesem Dreiklang bewerben die Sterbehilfeorganisationen ihr Angebot. Es geht – das zur Erinnerung – immer noch darum, Menschen auf Wunsch und Verlangen zu Tode zu bringen. Dieses Handwerk entspreche dem Wesen seiner Würde, verwirkliche ein Maximum an Freiheit, sei gleichsam höchster Ausdruck der Selbstbestimmung. So die Befürworter der Sterbehilfe.
Auch bei der Frage der Abtreibung spielen diese Konzepte eine Schlüsselrolle: „Mein Bauch [und alles, was da drin ist] gehört mir!“ Die Würde des Menschen wird auch in diesem Fall angeführt: die Würde der Frau, zu der es gehöre, über ihren Körper selbstbestimmt entscheiden zu dürfen. Wer wollte da widersprechen. Dass Zeitpunkt und Ausmaß der Entscheidung die Abtreibung zum moralischen Problem werden lassen, wird dabei gerne übersehen.
Festzuhalten ist: Die Menschenwürde wird in beiden Fällen zum Gegenstand der Freiheit und Selbstbestimmung; sowohl die eigene Würde (Suizid) als auch die Würde des Kindes (Abtreibung) – lassen sich daran bemessen, wie frei und selbstbestimmt der Mensch entscheidet. Soweit die heute fast ausnahmslos anzutreffende Interpretation der Begriffe Würde, Freiheit, Selbstbestimmung.
Es geht dabei ideengeschichtlich um die Befreiung von alten (und daher: „falschen“) Moralvorstellungen als Akt der Selbstbestimmung zur Erlangung dessen, was diese Vorstellungen nur verheißen, nicht aber verwirklichen: Menschenwürde. Ist dieser Gedankengang vom philosophischen Gehalt der benutzten Konzepte gedeckt? Was lässt sich aus Sicht der christlichen Anthropologie und Ethik erwidern? Prüfen wir die Begriffe – vor dem Hintergrund ihres lebensrechtlichen Verwendungskontexts in den Debatten über Abtreibung und Sterbehilfe.
Die Begriffe Würde, Freiheit und Selbstbestimmung sind so eng miteinander verzahnt (ohne ineinander aufzugehen!), dass die Gliederung der Abhandlung nur pragmatische Gründe hat. Dass ich die Würde voranstelle, ist ihrer Bedeutung geschuldet: Das Thema Würde spielt für die Sicht auf Freiheit und Selbstbestimmung eine überragende Rolle.
Würde
„Ich möchte in Würde sterben, – und zwar, wann ich will.“ – „Ich möchte selbst entscheiden, wann ich gehe – das ist Ausdruck meiner Würde.“ – „Ich möchte niemandem zur Last fallen, der Gedanke daran beschämt mich.“ – „Ich möchte nicht entwürdigend behandelt werden, von Pflegern unter Zeitdruck.“ – „Es nähme mir meine Würde, wenn man mich in Windeln packen müsste.“
Äußerungen, die so oder ähnlich im Kontext der Sterbehilfedebatte zu hören und zu lesen sind. Sie sind verständlich und nachvollziehbar – und widersprechen doch dem Begriff der Würde diametral. Denn es verfehlt die Grammatik der Würde, sie unter bestimmten Umständen zu verneinen oder auch nur als negierbar anzunehmen.
Würdezuschreibung und Würdevorstellung
Es ist gerade die Voraussetzungslosigkeit der Würdezuschreibung, die das Konzept Menschenwürde so wertvoll macht. Auch, wenn man nichts mehr „machen“ kann, ja, wenn man sich seiner selbst nicht mal mehr bewusst ist, bleibt man Mensch – mit Würde. Diese Würde kann einem niemand nehmen. Weil sie einem niemand gegeben hat. Damit hat die Würde eine Ausnahmestellung im Konzert der Rechte inne: sie ist keine konventionalistische Zuschreibung zum Mensch-Sein (wie etwa Freiheitsrechte), sondern qua Mensch-Sein ohne weiteres gegeben. Was Mensch ist, hat Würde. Punkt.
Dagegen setzen nun die Sterbehilfeapologeten: „Was Mensch ist, bestimmt seine Würde.“ Hier wird die Würde über Selbstbestimmung definiert. Würde unterliegt dem Selbstbestimmungsvorbehalt: Würde? – Gerne! Wenn und solange ich es für Würde halte. Ohne die Selbstzuschreibung der Würde, ergo: die Macht, sich selbst Würde zu- oder abzuerkennen, wäre es gerade umgekehrt: Würde begrenzte Selbstbestimmung. Davor will man sich hüten. Ich bestimme immer noch selbst, was Würde ist. Würde ist also nichts dem Menschen unbedingt Eigenes, seinem Willen damit Entzogenes, sondern etwas, das der Mensch selbst bestimmt – ganz individuell.
Würde ist aus dieser Sicht ein autonom bestimmtes Phänomen, wie es auch der Philosoph Dieter Birnbacher in seinem Testimonial für die Seite „Letzte Hilfe“ ausdrückt: „Würdiges Sterben – ja, aber gemäß meinen persönlichen Würdevorstellungen“. Ganz persönliche Würdevorstellungen sollen es sein. Was Würde ist, bestimme immer noch ich! Im Facebook wirbt eine Seite namens „Pro Sterbehilfe“, mit knapp 800 Likes eher wenig rezipiert, um neue Fans mit dem Slogan: „Zeige, dass auch Du Respekt vor der Menschenwürde hast“. Gemeint ist: vor dieser Menschenwürde, also vor einer Würde, deren Bedeutung man selbst gestaltet, die man selbst bestimmt, deren Verwendung damit gerade der Selbstbehauptung gegen als „überkommen“ betrachtete Heteronormativität staatlicher oder religiöser Verbindlichkeit (also: „Bevormundung“) dient – und damit wiederum der autonomen Selbstbestimmung. Würde und Selbstbestimmung sind in einem Wechselverhältnis angelegt, aus dem es kein Entrinnen gibt – nicht mit der Würde, sondern mit der Selbstbestimmung als Dreh- und Angelpunkt.
Wohlgemerkt: Es geht freilich immer nur um das Bestimmen des Würdebegriffs im Hinblick auf die eigene Person, also die eigene Würde wird selbst definiert, nur die eigene Würde. Autonomie-Apologeten betonen immer, dass man es auch anders sehen könne (alles andere wäre ja auch ein offener Widerspruch zur postulierten Absolutheit der Selbstbestimmung, die die Absolutheit der Würde ablösen soll). So viel Fairness muss sein. Dass hier der Begriff trotzdem falsch verstanden wird, ist offensichtlich, denn er steht und fällt ja gerade damit, dass die Würde etwas sein muss, das unbedingt, ungeachtet meiner Präferenzen und Gefühle gilt. Welchen Wert hätte sie sonst? Wie könnte man sonst den Staat auf Achtung und Schutz der Würde des Menschen verpflichten (an ganz prominenter Stelle im Grundgesetz), wenn jeder Bürger nicht nur faktisch etwas anderes darunter versteht (das gilt grundsätzlich, auch für „Freiheit“, „Gerechtigkeit“ etc.), sondern auch normativ etwas anderes darunter verstehen soll, kann, darf?
Umgekehrt: Wenn der Staat selbst keinen Definitionsansatz bietet, wenn auch die Kirche auf jede Interpretation verzichtet (oder beide – Staat und Kirche – auch bloß als „Subjekte“ wahrgenommen werden, die eben ihre unverbindliche Meinung äußern, so wie Herr Birnbacher), sondern wenn man es völlig ins Gutdünken des Bürgers stellt, was denn nach Artikel 1, Absatz 1 Grundgesetz geachtet und geschützt werden soll, wenn der Begriff also deutungsoffen gehalten wird und keine heteronomen Vorgaben (weltliche des Staates, geistliche der Kirche) das freie Spiel der Selbstbestimmung des – in Bezug auf seine Würdekonzeption – über allem (insoweit auch über Kirche und Staat) thronenden Subjekts überschatten soll – wie soll man dann noch einen Würdebegriff aufrecht erhalten, der nicht komplett in Selbstbestimmung aufgeht und damit überflüssig wird?
Die Würde im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist am 26. Februar 2020 diesen Weg nachgegangen. Eberhard Schockenhoff analysiert die damit eingeschlagene Richtung in einem Aufsatz für die Zeitschrift Communio. Nachdem er dargelegt hat, warum die Menschenwürde im weltanschaulich neutralen Staat juristisch nicht auf eine bestimmte Deutung bzw. Auslegung reduziert werden darf (ohne dass der Staat dabei gänzlich wertneutral bleiben muss oder dies überhaupt nur kann), hält er dem Gericht vor, sich auf „geradezu handstreichartige Weise“ dieser auferlegten Abstinenzpflicht „entzogen“ zu haben, „indem es eine neue Letztbegründung der Freiheit zum Suizid proklamierte“. Die selbstbestimmte Verfügung über das eigene Leben sei für das BVerfG, zitiert Schockenhoff den Beschluss, „unmittelbarer Ausdruck der der Menschenwürde innewohnenden Idee autonomer Persönlichkeitsentfaltung; sie ist, wenngleich letzter, Ausdruck von Würde“. Daraus folge: „Das BVerfG verlässt damit einen Standpunkt oberhalb unterschiedlicher inhaltlicher Festlegungen der Menschenwürde und macht sich ein weltanschauliches Verständnis zu eigen, das diese mit prinzipiell unbeschränkter individueller Selbstbestimmung gleichsetzt. Durch diese Auslegung der Menschenwürde-Garantie im Sinne schrankenloser Autonomie und Selbstverfügung verwirft das oberste Gericht zugleich die Konkordanzformel, die dem Anfang 2015 vom deutschen Parlament beschlossenen Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung zugrunde lag“.
Schockenhoff betont im Anschluss die Bedeutung der Differenz von privater und geschäftsmäßiger (und damit „öffentlichgesellschaftlicher“) Suizidbeihilfe, die man politisch nachvollziehen, vom Standpunkt einer konsequenten Lebensschutzethik her aber durchaus kritisieren kann. Auch im privaten Umfeld kann eben jener „Druck“ entstehen, der einer wirklichen und insoweit achtenswerten Autonomie querliegt. Wie lässt sich das denn auch verhindern? Im Privaten geht es doch manchmal ebenso um nackte wirtschaftliche Interessen. Wo liegt im Hinblick auf eine anti-autonomistische Druckkulisse der Unterschied zwischen einer Sterbehilfeorganisation, die für ihren „Dienst“ x Euro verlangt und ihre Leistung mit Euphemismus vermarktet, und einem Angehörigen, der verhindern will, dass x Euro aus seinem potentiellen Erbe für einen Platz im Pflegeheim aufgewendet werden und daher den Sterbenden subtil bedrängt? Wo ist die Differenz zwischen dem Werben der Organisation für ihre „Dienstleistung“ am künftigen „Kunden“ und dem Werben des Angehörigen um ein „freiwilliges“ Ende des künftigen Erblassers – etwa durch andauernde zielgerichtete Bemerkungen zum eigenen Finanzbedarf? Ja, ist nicht der alte Mensch viel eher bereit, darauf zu reagieren, und ein letztes „gutes Werk“ für den Angehörigen zu tun – auch, wenn er das eigentlich gar nicht will –, als auf eine Zeitungsanzeige oder einen Internetwerbespot einer Sterbehilfeorganisation hin dieser einen Auftrag zu erteilen?
Das BVerfG lässt in seinem Beschluss die Differenz aus einem ganz anderen Grund nicht gelten: Nicht jeder Sterbewillige habe Angehörige, die ihm helfen können, daher brauche es die Sterbehilfe als vermarktete Dienstleistung für alle. Konsequenterweise müsste man dann allerdings auch dafür sorgen, dass diese auch wirklich für jede und jeden erschwinglich ist, was letztlich bedeutet: Sterbehilfe als Kassenleistung.
Auch das BVerfG erkennt an, dass es das „gesellschaftliche und familiäre Umfeld“ gleichermaßen sein könne, das Menschen in die missliche Lage bringe, „sich gegen ihren Willen mit der Frage der Selbsttötung auseinandersetzen zu müssen“, und diese Menschen infolgedessen „mit Verweis auf Nützlichkeiten unter Erwartungsdruck geraten“.
Wie man es auch wendet: Das Problem liegt für mich viel tiefer. Das Einfallstor ist bereits die Überbetonung der Autonomie im Kontext des Würdebegriffs. Das darf ich sagen – ich muss die Würde nicht „weltanschaulich neutral“ begreifen. Offenbar ist das ohnehin eine Illusion – ein bestimmtes Vorverständnis braucht es wohl immer. Das BVerfG hat sich für die autonomistische Deutung der Würde und damit für eine säkularistische Sicht entschieden.
Ich hingegen bleibe dabei: Was Mensch ist, hat Würde, nicht als Ausdruck seiner Selbstbestimmung, sondern qua Sein. Das lässt sich am besten im Kontext des jüdisch-christlichen Menschenbildes verstehen, aber auch einige säkulare Ansätze können diese Voraussetzungslosigkeit aufzeigen – und damit die Grenzen des subjektiv-individuell bemessenen Deutungsraums über den Begriff der Menschenwürde.
Durch den historischen und systematischen Begründungsdiskurs zum Würdebegriff müssen wir uns durcharbeiten, denn welchen Grund man dafür sieht, von einer „Würde des Menschen“ zu sprechen, legt fest, was man unter der Würde des Menschen versteht und damit zugleich, in welchen Fällen man meint, die Würde des Menschen sei verletzt: „Die Tatsächlichkeit ihrer Verletzung hängt in hohem Maße davon ab, welche Bedeutung ihr aus dem umfangreichen Spektrum ihrer Semantik zugewiesen wird“, resümiert Jean-Pierre Wils in seinem Artikel „Würde“ im Handbuch Ethik,