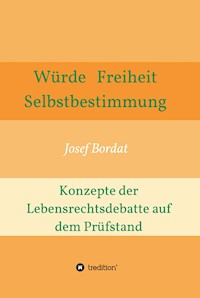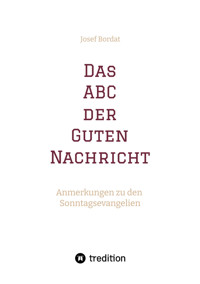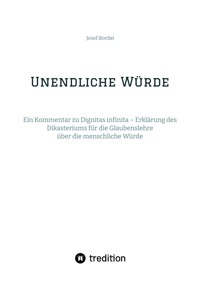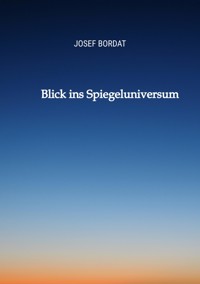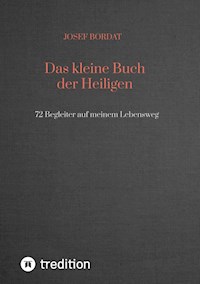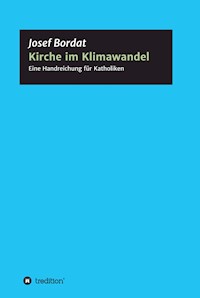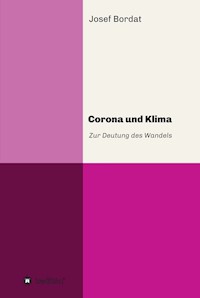
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie gehen wir mit Krisen und Katastrophen um? Was hilft uns dabei, sie zu deuten? Unser Glaube? Die Wissenschaft? Die Politik? Die Denkformen, in denen die Deutung des Wandels geschieht, unterliegen selbst einem Wan-del. - Der Philosoph Josef Bordat spürt dem Deutungsmusterwandel der letzten drei Jahrhunderte nach, beschreibt die strukturellen Analogien zwischen der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts der Übel in der Welt (Theodizee) und der Frage nach der Rechtfertigung wissenschaft-lich-technischer Systeme (Technodizee), um schließlich die Verantwortung des Menschen als zentral für die Bewältigung der aktuellen Corona-Krise, vor allem aber des Klimawandels als der Mega-Krise des 21. Jahrhunderts zu begründen (Anthropodizee).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Josef Bordat
Corona und Klima. Zur Deutung des Wandels
Für die Angehörigen der Opferder Corona-Pandemie
und
im Gedenken an meinen VaterJozef Bordat (1932-2021)
© 2021 Josef Bordat
Verlag & Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22 359 Hamburg
978-3-347-28 206-3 (Paperback)
978-3-347-28 207-0 (Hardcover)
978-3-347-28 208-7 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
Als ich mich zur Abfassung des Manuskripts für das vorliegende Buch entschloss, fühlte ich die globale Dimension der Corona-Pandemie besonders stark, weil zeitgleich sowohl in Deutschland als auch in Peru, der Heimat meiner Frau, viele Menschen, die uns nahe stehen, in der einen oder anderen Weise schwer betroffen waren. Erkrankungen, soziale Notlagen, Todesfälle. Eine echte Krise.
Wie damit umgehen? Die Frage nach dem Warum begleitete mich über Wochen und Monate. Als gläubiger Mensch richtete ich diese Frage an Gott, als Staatsbürger aber auch an das Gesundheitssystem, an die Politik, an Menschen. Mit der Warum-Frage bin ich nicht allein in dieser Zeit. Es ist dies vielmehr die klassische Frage angesichts der Krise.
Etwas darüber hinausgeblickt, entdeckte ich den Wandel, der von uns gedeutet werden will. Die Krise beschränkt sich nicht auf die Corona-Pandemie, deren Ende absehbar ist. Der Klimawandel und die damit einhergehende globale Erwärmung bilden eine weitere Ausdrucksform der Krise in unserer Zeit. Nur kurz überlagerte das Virus diesen Topos.
Corona, Klima – Wie den Wandel deuten? Mit dieser Frage habe ich mich auseinandergesetzt und dabei auch auf Texte zurückgegriffen, die im Zusammenhang mit meiner wissenschaftlichen Arbeit zum Deutungsmusterwandel entstanden sind, eine Arbeit, die seinerzeit den Kern meiner Post Doc-Forschungsstelle an der Freien Universität Berlin (2011-2014) bildete und – eigentlich – in eine Habilitation einmünden sollte. Dazu kam es – aus unterschiedlichen Gründen – nicht.
Ich hoffe, dass die vorliegende Abhandlung Hilfe leisten kann, bei dem Versuch, den Wandel und seine Konsequenzen besser zu verstehen, die missliche Lage besser in den Griff zu bekommen, besser mit Veränderungen umzugehen. Einen Trost wird sie nicht bieten können, auch mir bietet sie keinen Trost im Schmerz des Verlustes lieber Menschen. Das Schreiben selbst hat jedoch eine gewisse Abwechslung in meinen stupiden Corona-Alltag bringen können. Wenigstens das.
Berlin, im Juli 2021 Josef Bordat
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
„Und dann kam Corona…“
1. Warum, Gott?! - Teodizee
1.1 Schuld und Strafe
1.2 Leibniz, der Qerdenker
1.3 Leibnizens Monadologie
1.4 Leibnizens Teodizee
1.4.1 Worauf Leibniz bauen konnte
1.4.2 Die Unvollkommenheit als Schlüsselmoment
1.4.3 Determinismus? Deismus? - Eine kurze Apologie
1.5 Das Erdbeben von Lissabon
1.5.1 „Verwüstet solches bis zum Grunde“
1.5.2 Teologische Versuche, philosophische Kritik
1.5.3 Kants Paradigmenwechsel
2. Warum, Professort? - Technodizee
2.1 Neue Wege. Kants naturphilosophische Katastrophendeutung
2.1.1 Drei Schriften zum Erdbeben
2.1.2 Zusammenfassung
2.2 Technik, die (nicht immer) begeistert
2.3 Hans Posers Technodizee
2.4 Corona und Klimawandel
2.4.1 Corona. Zur Vertretbarkeit einer Impfung
2.4.2 Klimawandel. Zur Energieerzeugung mit Atomkraft
2.5 Natur und Technik. Der Mensch im Mittelpunkt
3. Warum, Menscht? - Anthropodizee
3.1 Freiheit und Verantwortung
3.2 Verantwortung als moralisches Konzept
3.3 Wer trägt wofür Verantwortung?
3.3.1 Wer – Individuum und Institution
3.3.2 Wofür – Stufen der Verantwortung
3.4 Verantwortungsethik nach Hans Jonas
3.5 Wie Verantwortungsübernahme gelingt
4. Nur gemeinsam!
4.1 Corona und Klima – kontroverse Diskurse
4.2 Religion und Wissenschaft – ein Widerspruch?
4.3 Religion: Neue Antworten auf die alte Teodizeefrage
4.3.1 Kants authentische Teodizee
4.3.2 Der Wandel in neueren Antworten auf die Teodizeefrage
4.3.3 Jonas‘ Gott: Verstehbar, aber nicht allmächtig
4.3.4 Jesu Kreuzestod als Antwort auf die Teodizee-Frage?
4.3.5 Corona und Co.: Strafen Gottes?
4.3.6 Was bleibt?
4.4 Wissenschaft: Keine übertriebene Skepsis, bitte!
4.4.1 Auch nur ein Glaubenssystem?
4.4.2 Was leistet die Klimaforschung?
4.4.3 Was können wir wissen?
4.5 Kurzer Schlussappell
Zum Autor
„Und dann kam Corona…“
Eine ganz kurze Einführung ins Krisengeschäft
1. Seit gut einem Jahr hat sie uns im Griff, die Corona-Pandemie.1 Corona – Sie werden es nicht mehr hören können, ich kann es auch nicht mehr hören. Aber die Pandemie ist Teil unserer neuen Realität. Sie gesellt sich als Krisengestalt zu einem Phänomen, dass uns schon vor Corona beschäftigte und das uns noch länger beschäftigen wird als die Pandemie, deren Ende absehbar ist. Ich meine den Klimawandel. Und als sei das nicht genug, geht der „ganz normale Wahnsinn“ weiter: Kriege, Terrorismus, Naturkatastrophen.
Seit gut einem Jahr gibt es aber nur noch ein beherrschendes Tema: Corona oder COVID-19. Die Corona-/COVID-19-Pandemie ist nach der Russischen Grippe (1889-1890), der Beulenpest (1894-1912), der Spanischen Grippe (1918-20), der Asiatischen Grippe (1957-1958), der Siebten Cholera-Pandemie (1961-1990), der Hongkong-Grippe (1968-1970), der neuen Russischen Grippe (1977-1978), AIDS (seit 1980) und diversen weltweiten Virusgrippewellen (1995-1996, 2004-2005, 2009-2010, 2017-2018, 2019-2020), die mehr oder weniger glimpflich verliefen, eine besonders schlimme globale Pandemie, mit einem hochansteckenden, aggressiven Erreger aus der Familie der Corona-Viren (SARS-CoV-2), der schwere Erkrankungen der Atemwege, der Bronchien und der Lunge hervorrufen kann, die in etwa jedem fünfzigsten Krankheitsfall tödlich verlaufen.
Es ist die erste globale Pandemie des 21. Jahrhunderts mit mehr als einer Million Todesfällen2, bei mittlerweile wohl mehr als 100 Millionen Infizierten3. Die Corona-Pandemie stürzte die Weltwirtschaft und die westlichen Gesellschaften in eine tiefe soziale und politische Krise. Von daher ist auch oft von der Corona-Krise die Rede. Es ist nicht die erste Krise und sicher auch nicht die letzte, die wir gemeinsam durchleben müssen. Ohnehin scheinen wir uns von einer (vermeintlichen) zur nächsten (tatsächlichen) Krise zu hangeln. Finanz-, Flüchtlings-, Klima-, Bildungs-, Kirchen-, Corona-Krise. Der Krisenmodus ist das neue Normal im 21. Jahrhundert.
Und eins steht – wie schon angedeutet – fest: Nach der Corona-Krise kommt die Klima-Krise mit voller Wucht zurück. Es ist dies wohl auch die einzige Krise, die das 21. Jahrhundert komplett begleiten wird – alle anderen Krisen sind temporäre Erscheinungen. Die Klimakrise spitzt sich zu. 2020 lag die Durchschnittstemperatur zwei Grad über dem Normalwert der letzten 200 Jahre. Die Klimaziele konnten zwar eingehalten werden, weil alles, was sonst viel CO2 ausstößt (der Flugverkehr etwa), deutlich heruntergefahren wurde, aber nachhaltige Veränderungen lassen immer noch auf sich warten. 2020 war auch das Jahr, in dem der Berliner Großflughafen BER eröffnet wurde (mit mehr als acht Jahren Verspätung).
Was für den Moment in der Rückschau der letzten Monate bleibt, ist eine tiefgreifende Ambivalenzserfahrung angesichts der Gleichzeitigkeit von Egoismus und Solidarität, Zerrüttung und Zusammenhalt. Klopapier- und Nudelhamster, junge Menschen, die den älteren Nachbarn ihre Hilfe beim Einkaufen anbieten, Corona-Demos, die alle Regeln mit Füßen treten, Forscher im 24/7-Modus auf der Suche nach einem Impfstoff – all das geschah gleichzeitig. Nun setzt sich unter diesen gesellschaftlichen Vorzeichen die Klima-Krise fort. Wir werden uns ändern (müssen). Bereits geschehene Anpassung (wegen Corona) müssen fortgesetzt werden (wegen des Klimas): Arbeit, Mobilität, Freizeit – viele Gewohnheiten müssen auf den Prüfstand. Kein leichter Weg, der vor uns liegt.
2. Passieren Dinge, die uns negativ betreffen, sind wir zunächst irritiert. Nach Lösung der Schockstarre müssen wir darauf reagieren. Jede Krise sei eine Chance, hört man oft. Doch was, wenn die Ereignisse eine Schwere annehmen, die ohne Zynismus kaum als Chance (noch nicht mal als Bewährungschance) angesehen werden kann? Wir werden durcheinandergeschüttelt und auch die Dinge des Lebens, die nicht direkt mit dem Geschehen verbunden sind, ändern sich dramatisch. Eine schwere Diagnose, ein Verlusterlebnis, ein Unfall – das hat Auswirkungen auf den Alltag. Wir müssen uns auf die damit verbundenen Veränderungen einstellen. Sie wenden unser Leben, oft ganz plötzlich, Tendenz abwärts. Eine plötzliche Abwärtswendung – das heißt auf Griechisch „καταστροφή“, Katastrophe. In der Antike wurde „Katastrophe“ noch wertneutral verwendet, etwa, um die Kehre in der Dramaturgie eines Teaterstücks zu bezeichnen. Heute ist das, was mit „Katastrophe“ bezeichnet wird, eindeutig negativ: Eine Katastrophe ist die Wendung bzw. der Wandel zum Schlechten.
Von einigen Katastrophen ist nicht nur der Einzelne oder sind nicht nur einige wenige Menschen (etwa eine Familie) betroffen, sondern eine ganze Gesellschaft. Erdbeben, Überschwemmungen, Missernten. Manchmal ist auch die ganze Welt betroffen. Wenn etwa ein riesiger Meteorit einschlägt, wie vor 60 Millionen Jahren, und dem Leben auf Erden für Jahre das Licht ausknipst. Oder, wenn ein winziges Virus sich ausbreitet, überall. Oder, wenn das Klima aus den Fugen gerät. Corona und der Klimawandel – es ist dieses katastrophische Paar, das uns im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts beschäftigt. Mich auch, daher dieses Buch.
3. Folgt man dem FAKKEL-Modell aus der Katastrophensoziologie, so blüht uns in Sachen Corona noch einiges; das Problem, das demnach ursächlich zur sozialen Katastrophe führt, nämlich die Kommunikationsprobleme zwischen Experten und Laien, hat sich hier bisher nur angedeutet.4 Voll entfaltet, dürfte es die Katastrophe vertiefen. Besonders beängstigend, dass in ähnlicher Weise auch das schleichende katastrophische Megaereignis des 21. Jahrhunderts in den Strudel missglückter Kommunikation zu geraten droht: der Klimawandel. Das wäre der Fall, wenn die Rolle des Menschen verharmlost oder gar bestritten und damit der anthropogene Klimawandel grundsätzlich in Zweifel gezogen wird würde. Bisweilen ist das der Fall. Dabei wird ein tiefes Misstrauen in die Wissenschaft und die darauf fußenden Politikoptionen spürbar. Als Skepsis getarnt, ist es oft nur die schroffe Zurückweisung von Expertise durch Laien, die mit ihrem ebenso ängstlichen wie aggressiven Abstreiten des Katastrophischen die Katastrophe nur verstetigen oder gar verschlimmern.
Katastrophengeschichte ist (auch) Kommunikationsgeschichte, die Pandemie geht mit der Infodemie Hand in Hand. Impfstoffe, Herdenimmunität, Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Test, Sieben-Tage-Inzidenz und so weiter. Wir sind mittlerweile zu Experten geworden, möchte man meinen. Doch diese „Expertise“ zeigt im Grunde nur die Ambivalenz der Informations- und Wissensgesellschaft besonders deutlich. Einerseits: Es gibt immer mehr Information. Andererseits: Es gibt immer weniger Respekt vor dem Unterschied zwischen Information und Wissen. Wissenschaftskritische bis -feindliche Positionen entwickeln sich inmitten der größten Informationsdichte, die es je gab (man nennt dieses Füllhorn „Internet“). Das ist die Tragik unserer Tage.
4. Leben im Krisenmodus. Wie lässt sich damit umgehen? Wie lassen sich die Einschnitte deuten, die unser Leben belasten? Welche Deutungsmuster stehen uns zur Verfügung – jedem Einzelnen für sich selbst und der Gesellschaft im Ganzen? In der vorliegenden Schrift möchte ich eine historische und systematische Klärung hinsichtlich der Transformation des Rechtfertigungsdrucks angesichts von Krisen und Katastrophen vornehmen. Dargelegt wird dabei, wie sich das vorherrschende Deutungsmuster wandelte: von der „Teodizee“ (Gerechtigkeit Gottes) über die „Technodizee“ (Glaube an die Heils- und Erlösungswirkung technologischer Systeme) zur „Anthropodizee“ (Verantwortlichkeit des Menschen). Dabei soll deutlich werden, unter welchen kulturellen Rahmenbedingungen es zu Ablösungsprozessen kam. Abschließend möchte ich einen Vorschlag wagen, wie Religion und Wissenschaft zusammenwirken können, um Menschen angesichts der aktuellen Corona-Krise und der zu erwartenden Klima-Krise Orientierung und Halt zu geben.
Dabei können wir aus der Vergangenheit lernen. Der Blick in die Geschichte (und in die Ideengeschichte, also: die Philosophiegeschichte) lohnt sich, auch wenn wir heute einige Deutungsmuster und Handlungsstrategie transformieren und säkularisieren. Ich möchte – wie bereits bemerkt – diesen Weg nachgehen: Von der Teodizee über die Technodizee zur Anthropologie. Dabei greife ich auf Überlegungen und Vorarbeiten zurück, die ich in den Jahren 2005 bis 2015 in diversen Projekten angestrengt habe, unter anderem auf meiner Post Doc-Forschungsstelle an der Freien Universität Berlin (2011-2014). Ich thematisiere damit auch die Idee des Zweitgutachters meiner Dissertation, Hans Poser, der den Begriff der „Technodizee“ geprägt hat.
5. Die Bewältigung von Krisen besteht aus Deutung und Handlung. Mir geht es nicht so sehr um konkrete praktische Handlungsempfehlungen,5 sondern vielmehr um die dahinterstehenden Deutungsmuster, die unsere Handlungsstrategien bei der Bewältigung von Krisen motivieren. Gebetsinitiativen, Forschungsprojekte, Verhaltensüberprüfung – wie wir auf Krisen reagieren, hängt davon ab, wie wir sie interpretieren, als was wir sie begreifen: Zeichen Gottes, Versagen der Technik, Schuld des Menschen. Es geht mir nachfolgenden nicht in erster Linie um die Darstellung und Bewertung solcher konkreten Maßnahmen, sondern um den Aufbau eines Grundgerüsts zur Erklärung von Mentalitäten vor dem Hintergrund typischer Denkformen der europäischen Kulturgeschichte, die Umgangsmöglichkeiten schaffen und Handlungsspielräume eröffnen können. Es geht mir also um ein Verständnis dessen, was immer im Hintergrund mitschwingt, aber selten explizit gemacht wird.
Warum ist es wichtig, sich dieses Hintergrunds bewusst zu werden? Die eher abstrakten Überlegungen stellen die kulturellen Vorverständnisse und Prägungen in den Mittelpunkt, die ihrerseits Ausgangspunkte dafür bilden, ganz konkret mit in Krisen erfahrenem Leid umzugehen – als Einzelner und als Gesellschaft. Ob die Mittel für eine bestimmte Forschung aufgestockt werden oder besondere Gottesdienste stattfinden, wer in welcher Funktion in TV-Talkrunden eingeladen wird, was über eine Katastrophe öffentlich gesagt werden darf und was nicht, all das ist Teil von Bewältigungsstrategien, hinter denen Deutungsmuster stehen, die religiös oder säkular, wissenschaftlich-technisch oder moralisch grundiert sind.
6. Was sind Deutungsmuster? Deutungsmuster, Denkformen, Paradigmata (Tomas Kuhn), Vorverständnisse (Hans-Georg Gadamer), Vorurteile (Martin Heidegger), Prägungen religiöser, kultureller und sozialer Art – man kann diese Ausdrücke synonym verwenden, auch wenn sie nicht exakt das gleiche bedeuten; ich nutze vornehmlich den Begriff Deutungsmuster.
Deutungsmuster ermöglichen die Rückführung des Unbekannten auf Bekanntes. Das Neue will begriffen, auf den Begriff gebracht werden. Dazu braucht es einen Rahmen, in dem es kontextualisiert und verstanden werden kann. Das gilt für Corona, das gilt auch für den Klimawandel. Das fällt schwer, wie man sieht, wenn man besagte Gesprächsrunden im Fernsehen schaut, Social Media-Kanäle frequentiert oder auch nur mit offenen Augen durch die Welt geht. Das wiederum liegt daran, dass unserer Gesellschaft heute gemeinschaftlich geteilte Deutungsmuster fehlen. Es ist nicht mehr klar, wie „man“ über eine Sache zu denken hat. Es gibt keine übergreifenden Ordnungssysteme mehr, die – von der Kirche etwa, oder auch von der Politik – vorgegeben und unhinterfragt übernommen werden, im Gegenteil: Solche Vorgaben werden als übergriffig empfunden und es wird ihnen misstraut. Das ist für den liberalen Rechtsstaat prinzipiell auch gut so, denn das ist Ausdruck einer modernen, freien Gesellschaft, die in der Autonomie des Einzelnen einen hohen – manche meinen gar: den höchsten –6 Wert annimmt.
Also: Deutungsmuster – irgendwann funktionieren sie nicht mehr. Nicht mehr für alle – alle Menschen, alle Krisen. Tradierte, aber überkommene Deutungsmuster werden durch neue abgelöst, die jedoch nicht so neu sind, dass sie mit den alten nichts mehr zu tun hätten. Die Ablösung geschieht durch den Prozess ideenhistorischer Entwicklung (Wir können nicht mehr glauben, dass…), sie kann aber auch bestärkt werden durch das bewusste Schaffen neuer Denkformen in Gestalt der politischen Willensbildung (Wir wollen glauben, dass…). Wenn man kaum noch etwas gemein hat – nicht den Glauben, nicht die Kultur, nicht die Lebensweise –, fällt der Aufbau von Denkformen bzw. die Akzeptanz der von Wissenschaft und Politik (bisweilen auch von der Kirche) bereitgestellten Verständnishilfen schwer.
7. Für die Deutungsmuster angesichts des Übels in Form von Katastrophen, Kalamitäten und Krisen hat es zwei große Ablösungsprozesse gegeben, den Übergang von der religiösen auf die wissenschaftlich-technische Sicht im 18. Jahrhundert und den Übergang von der engen wissenschaftlich-technischen Sicht auf die ganzheitliche humane Perspektive, den wir derzeit erleben. Die ideenhistorische Entwicklung ist ereignisgetrieben, hat also konkrete realgeschichtliche Hintergründe. Man kann sie als Resultat kollektiver Erfahrungen der Zerrüttung betrachten und sie mit dem erwachenden Bewusstsein identifizieren, diesen Erfahrungen kollektiv entgegenwirken zu müssen. Das führt zu konkreten Daten: dem 1. November 1755 und dem 3. Juni 1992.
Am 1. November 1755 bebte in Lissabon die Erde und erschütterte die bis dato konkurrenzlosen religiösen Denkformen, am 3. Juni 1992 wurde in Rio de Janeiro die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung eröffnet; sie markierte den Beginn einer Zeit, in der nicht allein auf abstrakte Ideen und komplexe Technologie gesetzt werden sollte, sondern auf das konkrete, einfache Handeln von Menschen: Global denken, lokal handeln.
Bis 1755 war es Gott, der für alles herhalten musste. Die europäische Gesellschaft war durch und durch christlich geprägt, Gott in aller Munde. Angesichts der Übel, die es dennoch gab, stellte sich die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, die Teodizee-Frage. Ironischerweise war es ein (echter) Qerdenker, der hierauf die epochale Antwort gab: Gottfried Wilhelm Leibniz.
Wissenschaft und Technik sind ab Mitte des 18. Jahrhunderts bei der Krisenbewältigung immer wichtigere Ratgeber für Handlungsstrategien geworden, die zuvor jedoch selbst zu wirkmächtigen Deutungsmustern wurden, mit ganz ähnlichem Anspruch, uns die Welt (einschließlich all ihrer Übel) verstehen zu lassen. Sie sind folglich auch mit ähnlicher Begründungsnotwendigkeit behaftet. Dass die Rechtfertigung der Technik durchaus in Analogie zur Rechtfertigung Gottes geschehen kann, dafür steht die Arbeit Hans Posers zur Technodizee.
Gott und Technik – das reicht heute nicht mehr. Daher kommt – von der Rio-Konferenz 1992 ins globale Bewusstsein gehoben – ein Drittes hinzu: der Mensch. Nicht (nur) als an Gott glaubender homo religiosus, nicht (nur) als Technik schaffender homo faber, sondern in der Gesamtheit seines Verhaltens. Wir sprechen von der Anthropodizee.
In gewisser Hinsicht hallt in diesem Deutungsmuster die ideengeschichtliche Entwicklung nach: Bis heute wird die Teodizee als Problem zum Gegenstand ernster Debatten um die Selbstvergewisserung des Menschen – die Frage nach Gott angesichts von Corona-Pandemie und Klimawandel ist auch in unserer säkularisierten Gesellschaft keine rein akademische, sondern für viele Menschen eine existenzielle. Bis heute spielt die Technodizee eine Rolle in den Debatten zu Katastrophen, Kalamitäten und Krisen, sowie technische Systeme daran beteiligt sind – zumeist sind sie es in der einen oder anderen Weise.
Es geht mir mit dem vorliegenden Buch also darum, Gott, Technik und Mensch zusammenzudenken, um zu einer vernünftigen, zugleich humanen Bewältigungsform der Krisen unserer Zeit zu gelangen, die alle Dimensionen des Menschseins anspricht: das nackte Überleben ebenso wie die Sehnsucht nach Trost und Transzendenz.
1 Die Niederschrift des Manuskripts erfolgte im April und Mai 2021.
2 Am 20. Mai 2021 wurden etwa 3,42 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit Erkrankungen, die durch das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst wurden, berichtet.
3 Am 20. Mai 2021 wurde gemeldet, das sich seit Beginn der Pandemie etwa 165 Millionen Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben.
4 Die Kieler Schule der Katastrophensoziologie um Lars Clausen entwickelte bereits in den 1980er Jahren ein Modell, dass den Ausgangspunkt für Katastrophen in der mangelnden Kommunikation zwischen Experten und Laien sieht. Diese Kommunikationsstörungen lösen die Phasen der sozialen Katastrophe aus bzw. wirken verstärkend auf sie: „Friedensstiftung“, „Alltagsbildung“, „Klassenformation“, „Katastropheneintritt“, „Ende aller Sicherheit“ („die sozialen Netze brechen zusammen, das Vertrauen in die Experten ist gänzlich verloren gegangen, die Laien werden notgedrungen zu kurzsichtig fortwurstelnden ‚Katastrophenrealisten‘“, Wikipedia), „Liquidation der Werte“. Zusammen ergibt sich die FAKKEL, die eine Gesellschaft in Brand stecken, die uns beim Gegensteuern aber auch erleuchten kann.
5 Diese gebe ich – bezogen auf die Klima-Krise – in meinem Buch Kirche im Klimawandel – Eine Handreichung für Katholiken, erschienen 2020 bei Tredition (Hamburg); dort insbesondere in Kapitel 4.
6 Zur Problematik der Selbstbestimmung als neue „unantastbare“ Leitkategorie aller Lebensvollzüge – unbedingt zu achten und zu schützen von Recht und Politik (mithin: aller staatlichen Gewalt) – vgl. mein Buch Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand, ebenfalls 2020 bei Tredition (Hamburg) erschienen.
1. Warum, Gott?! - Theodizee
Das Zeitalter des religiösen Deutungsmusters (bis 1755)
1.1 Schuld und Strafe
Lange – sehr lange – beherrschte das religiöse Deutungsmuster die Gesellschaft. Was auch geschah, es wurde mit dem Wirken Gottes (oder eines Gottes, aus einer Vielzahl von Göttern) zu erklären versucht. Das hieß dann für Ereignisse mit negativem Einschlag, für Katastrophen, Kalamitäten, Kriege und anderes Übel, dass die Menschen in irgendeiner Form den Zorn Gottes (oder der Götter) heraufbeschworen und nun unter dessen Folgen zu leiden hatten. Auf Sünde folgt Sühne – so ist das eben.
Diese Logik des Tun-Ergehen-Zusammenhangs (ein Begriff des Teologen Klaus Koch) galt auch für das Judentum, das damit das Christentum imprägnierte, trotz des Perspektivenwechsels beim Blick auf das Leid, den Jesus vornimmt – durch seinen Umgang mit Leidenden und durch sein eigenes Leid (vgl. Kapitel 4.3). Das religiöse Reaktionsspektrum sah Buße und Umkehr vor, oft in Verbindung mit Opferriten und Fasten. Einiges davon kennen (und schätzen) wir heute noch (zumindest soweit wir an Gott glauben), allerdings unterstellen wir heute – nach Jahrhunderten aufgeklärter Teologie und theologischer Aufklärung – mehrheitlich keinen direkten Wirkungszusammenhang mehr, weder Gottes auf die Welt, noch des Menschen auf Gott.7 Doch wir halten im christlichen Glauben daran fest, dass Gott und Welt bzw. Gott und Mensch etwas miteinander zu tun haben, ein Etwas, das von beiden Seiten her gestaltet wird. Dieses Etwas zu bestimmen, ist eine recht komplizierte Angelegenheit.
Ehedem war das einfacher: Gott stellt Regeln auf, der Mensch verstößt dagegen, Gott straft den Menschen, der Mensch büßt, Gott beendet die Strafe – solange, bis ein erneuter Verstoß vorliegt. In religiös homogenen Gesellschaften richtete sich die Notwendigkeit der Buße auf die eigene Gemeinschaft, gab es religiöse Minderheiten, wurden diese regelmäßig zur Verantwortung gezogen. Man suchte sich einen „Sündenbock“, den man beladen und vertreiben oder gar vernichten konnte. Das galt auch hierzulande, vor allem in Zeiten von Pandemie und Klimawandel. Bevor man allerdings dafür die Religion (hierzulande also das Christentum oder auch – des griffigen und angreifbaren Feindbildes willen – die Kirche) in Gänze haftbar macht, muss man genauer hinschauen, um zwischen der Lehre der Kirche und dem Leben des Volkes unterscheiden zu können (wenn man das denn will).
Als im 14. Jahrhundert die Pest in Mitteleuropa wütete, machte das geplagte Volk die Juden verantwortlich: Sie vergifteten angeblich die Brunnen. Eine Pogromwelle rollte Mitte des 14. Jahrhunderts durch Europa. Diese Pogrome fanden gegen den entschiedenen Widerstand der Kirche statt. Papst Clemens VI. verfasste zwei Bullen gegen die Judenjagd, die jedoch im Volk ohne Wirkung blieben. Mit der Bulle Quamvis perfìdiam (1348) spricht Clemens die Juden vom Vorwurf der Brunnenvergiftung frei. Clemens argumentierte gegen diesen Aberglauben mit Hinweis auf die Tatsache, dass auch die Juden selbst Opfer der Pest seien. Allerdings wurde dagegen argumentiert, Juden seien unterproportional von der Pest betroffen. Das ist wahr, lag aber – wie wir heute wissen – an den besonderen Hygiene- und Speisevorschriften der Juden, die das Infektionsrisiko hemmten. Wer gegen die Weisung der Bulle weiterhin Juden verfolge, so Clemens, werde exkommuniziert. Die Flagellanten, die sich bei den Judenpogromen besonders hervorgetan hatten, erklärte er zu Häretikern. Das Engagement des Papst war jedoch vergeblich. Noch im selben Jahr kam es zu Pogromen gegen Juden in Toulon und in Zürich, 1349 in Freiburg im Breisgau, Speyer, Straßburg und Erfurt. In Erfurt kam es im März 1349 sogar zu einem „prophylaktischen“ Pogrom: Obgleich die Pest die Stadt noch gar nicht erreicht hatte, meinte man, vorsorglich die etwa 500 jüdischen Bürger vertreiben zu müssen. Die Pest kam wenig später trotzdem.
Als im 17. Jahrhundert die „Kleine Eiszeit“ zu Missernten führte, machte das geplagte Volk Hexen und Zauberer verantwortlich: Sie schadeten angeblich der Landwirtschaft durch ihre Zauberei. Die Macht für diese negativen Interventionen käme direkt vom Teufel, so der Aberglaube im Volk, das zum Schutz vor diesen schädlichen Umtrieben die Verfolgung von angeblichen Hexen und Zauberern verlangte, wenn sie nicht gleich Selbstjustiz betrieb. Die katholische Teologie hat den Volksglauben an Hexerei als Einbildung charakterisiert. Bereits im 10. Jahrhundert missbilligt der Canon episcopi den Hexenglauben. Der „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum, 1487), der oft genannt wird, um die Verantwortung der Katholischen Kirche auf den Punkt zu bringen, war zwar ein in der Praxis beachtetes „Handbuch der Hexenverfolgung“, das bis 1520 in einer Gesamtauflage von 10.000 Exemplaren erschien, das Buch ist aber weder von der Kirche in Auftrag gegeben noch nach dessen Veröffentlichung in irgendeiner Weise autorisiert worden. Wolfgang Behringer und Günter Jerouschek kommen zu dem Ergebnis, dass die Schrift zwar „das Empfinden großer Teile der Bevölkerung widerspiegelte, aber in krassem Widerspruch zur theologischen Tradition stand“8, so dass man sich mit Arnold Angenendt „am Ende fragt“, ob es „überhaupt als kirchliches oder gar katholisches Buch zu bezeichnen ist“9. Die Hexenverfolgung endete im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung. Aber nicht durch die Aufklärungsphilosophie, sondern vor allem durch das Wirken kritischer Teologen beider Konfession im 17. Jahrhundert. Einer von ihnen war der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld. 1631 erscheint sein Hauptwerk, die Cautio criminalis seu de processibus contra Sagas Liber („Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse“). In seinem epochalen Werk entlarvt Spee die Hexenprozesse als Farce und die Vollstreckung der Urteile als Mord, während nur einige Jahrzehnte zuvor der religionskritische Jurist und Staatstheoretiker Jean Bodin – nicht zuletzt im Regress auf den „Hexenhammer“ – die Verfolgung befürwortet hatte.
Die Beispiele zeigen, dass es nicht die Katholische Kirche als religiöse Institution und Hüterin des Glaubens war, die Pogrome und Verfolgung initiierte, sondern dass diese vom Volk ausgingen und dessen Aberglauben geschuldet waren, gegen den auch die zeitgenössische Teologie argumentierte und beherzte Kirchenmänner einschritten. Doch sie zeigen auch, dass und wie sehr das religiöse Deutungsmuster (im weitesten, den Aberglauben einschließenden, Sinne) die Denkform prägte.