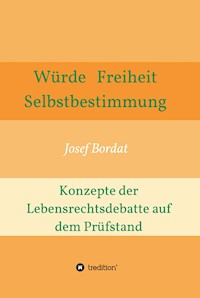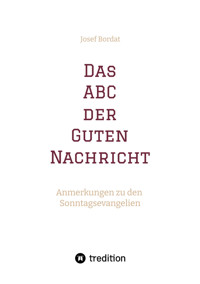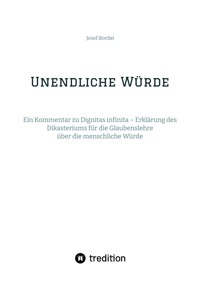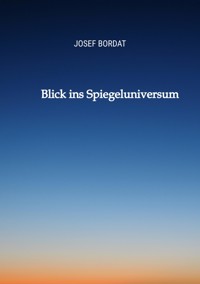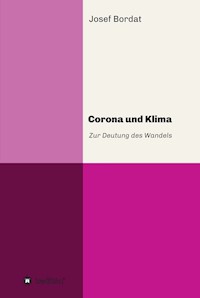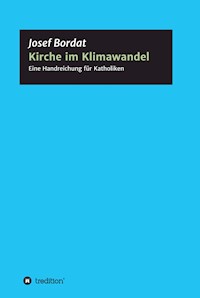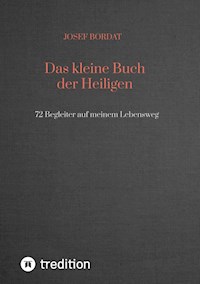
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2022 bin ich 50 Jahre alt geworden. Ich nutze die Gelegenheit, in Dankbarkeit auf mein bisheriges Leben zurückzuschauen. Ich tue dies, indem ich 72 Begleiter auf meinem Lebensweg vorstelle – Heilige, Selige und solche, die es noch werden könnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Josef Bordat
Das kleine Buch der Heiligen
72 Begleiter auf meinem Lebensweg
In großer Dankbarkeit widme ich dieses Buch meiner lieben Frau Roxana, mit der ich im Jahr 2022 auf 20 Ehejahre zurückblicken durfte.
Und meinen Eltern, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Ehejubiläum begangen hätten.
Die tiefe Bedeutung der Heiligen liegt darin, dass mit dem lebendigen Glauben der Toten der tote Glaube der Lebenden erneuert wird.
© 2022 Josef Bordat
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
978-3-347-75526-0
(Paperback)
978-3-347-75527-7
(Hardcover)
978-3-347-75528-4
(e-Book)
978-3-347-75529-1
(Großdruck)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
In diesem Jahr bin ich 50 geworden. Mein Vater wäre 90 geworden, er verstarb 2021. Seit 20 Jahren bin ich verheiratet mit meiner lieben Frau Roxana, meine Eltern hätten in diesem Jahr ihre Diamantene Hochzeit (60 Jahre Ehe) gefeiert. Gute Gründe, um innezuhalten und zurückzuschauen, in großer Dankbarkeit.
Statt einer klassischen Autobiographie als Zwischenbilanz in der „Mitte des Lebens“, möchte ich etwas mitteilen, das mein Leben betrifft, zugleich aber davon weg auf etwas hinweist, das mein Leben übersteigt und doch zugleich ausmacht, weil ich an Gott glaube: Heiligkeit. Das Leben der Heiligen, die mich prägten, soll also im Mittelpunkt stehen, auch bei der Betrachtung des eigenen Lebens.
Was möchte ich mit diesem Buch? Zunächst: Was möchte ich nicht?
Ich möchte keine weitere Biographisch-Bibliogaphische Zusammenstellung von Heiligen und Märtyrern der Kirche anfertigen, die den Anspruch erhebt, mehr oder minder vollständig zu sein; das ginge gar nicht. Im übrigen liegen solche Listen längst vor. Die erste einschlägige Gesamtschau der damals noch recht übersichtlichen Heiligenschar leistete Jacobus de Voragine mit seiner Legenda Aurea bereits im 13. Jahrhundert. Die wohl aktuellste Zusammenstellung findet man bei Wikipedia, deren Macherinnen und Macher – zumindest, was Listen und Tabellen betrifft – immer wieder gute enzyklopädische Arbeit leisten. An dieser Stelle sei für Recherchezwecke die „Liste der Seligen und Heiligen“ empfohlen.
Dort findet man auch den schönen Satz „Die genaue Anzahl aller Heiligen und Seligen ist unbekannt“. Das ist wohl wahr, obgleich es eine „offizielle“ Statistik der Kirche über „ihre“ Heiligen gibt, das Martyrologium Romanum. Hier sind in der aktuellen Ausgabe 6650 Selige und Heilige sowie etwa 7400 Märtyrer aufgeführt, die bei Christenverfolgungen getötet wurden – rund 14.000 Personen also, die namentlich aufgeführt werden und gemeinsam eine Kleinstadt bilden könnten.
Ich möchte ferner kein nationales Martyrologium für zeitgenössische Selige und Heilige unserer Breiten anfertigen, das gibt es nämlich auch schon. Prälat Helmut Moll publiziert seit 1999 das Deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz; die siebte, überarbeitete und aktualisierte Auflage stammt aus 2019. Ich möchte schließlich auch kein regionales Martyrologium schaffen, auch das hat Professor Moll schon in hervorragender Manier besorgt, zumindest für das Erzbistum Köln, dem „mein“ Heimatbistum Münster als Suffragandiözese zugewiesen ist, Titel: Wenn wir heute nicht unser Leben einsetzen. Martyrer des Erzbistums Köln aus der Zeit des Nationalsozialismus. Die achte, erweiterte Auflage erschien 2020. Über die wichtige Arbeit, die Helmut Moll leistet, informiert die Seite deutsches-martyrologium.de.
Auch, wenn mir die Heiligen und Märtyrer aus unserer deutschen und meiner niederrheinischen Heimat besonders am Herzen liegen, vor allem dann, wenn sie meinem Leben auch noch zeitlich nahe kommen, also Menschen aus der Gegenwart sind, d.h. aus dem 20. Jahrhundert stammen, möchte ich den Blick heben und auch über den Tellerand schauen. Die Reduktion nach den Kriterien Raum und Zeit würde nämlich eine Reihe interessanter Heiliger, Seliger und Märtyrer übergehen, die mir auf meinem Lebensweg auch sehr wichtig geworden sind.
Also, was möchte ich mit diesem Buch?
Ich möchte heilige Menschen vorstellen, die für mich in meinem ersten halben Jahrhundert auf Erden eine ganz besondere Bedeutung hatten und haben. Menschen, mit denen mich etwas verbindet. Diese Heiligen haben mich geprägt, biographisch, theologisch, in meinem persönlichen Glauben. Ich habe Feste zu ihren Ehren gefeiert (Peter und Paul, Konrad von Parzam, Felix von Girona), ich habe ihre Texte studiert (Thomas von Aquin, Edith Stein, Thomas Morus), mich verbindet der Name (Josef), der Beruf (Katharina von Alexandria – Patronin der Philosophen, Maximilian Maria Kolbe – Patron der Journalisten), die Heimat meiner Frau (Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres) oder auch ein ganz profanes Hobby wie das Fernsehen (Klara von Assisi) mit diesen heiligen Frauen und Männern. Viele von ihnen sind hochaktuell, haben uns heute in der Dreifachkrise (Corona, Krieg und Klima) einiges zu sagen.
So ergibt sich eine zwar subjektive, aber nicht ganz unbegründete Zusammenstellung einiger weniger Heiliger und Märtyrer, insgesamt sind es 72 (vgl. das Heiligenverzeichnis), die aber durchaus die Breite des Konzepts von Heiligkeit im Sinne der Kirche aufzeigen. Einige werden Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, bekannt sein, andere nicht. Viele dieser Heiligen – es klang ja schon an – haben das Martyrium erlitten. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, versuche ich vorab in der Einleitung zu klären.
Noch ein Hinweis: Nicht alle Menschen, von denen ich erzählen werde, sind heilig, einige sind „nur“ selig. Der Unterschied besteht vor allem in der Reichweite der Verehrungspraxis: regional, also auf diözesaner Ebene (Selige), oder weltkirchlich, auch in der ganzen Kirche (Heilige). Auch dazu einige Hinweise in der Einleitung. Andere wiederum sind weder das eine noch das andere (Meister Eckhart etwa), weil ihr Seligbzw. Heiligsprechungsprozess (durchaus auch mehrfach) scheiterte (bei Thomas von Kempen war das der Fall) oder auch, weil sie bisher „übersehen“ wurden (Bartolomé de Las Casas, Friedrich Spee von Langenfeld). Mir sind sie dennoch so wichtig, dass ich sie in das „Heiligenbuch“ aufnehme – freilich, ohne einer kirchlichen Entscheidung in irgendeiner Weise vorgreifen zu wollen.
Berlin, im Oktober 2022 Josef Bordat
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Heilige – was sind das für Menschen?
2 Am Anfang – und schon davor
Agnes von Rom
Katharina von Alexandrien
Maria
Josef.
Cornelius
3 Kindheitserinnerungen
Peter und Paul
Martin von Tours
Nikolaus von Myra
Drei Könige
4 Jugend am Niederrhein
Friedrich Spee von Langenfeld
Adelheid von Vilich
Franz von Assisi
Johannes Paul II
Mutter Teresa
Karl Leisner
Clemens August Graf von Galen
Thomas von Kempen
Norbert von Xanten
Michael Pro
5 Studienjahre in Berlin
Augustinus
Thomas von Aquin
Hedwig von Schlesien
Matthias
Bernhard Lichtenberg
Nikolaus Groß
Bernhard von Clairvaux
Dominikus
Thomas Morus
Edith Stein
Johannes vom Kreuz
Anselm von Canterbury
Justin
Bonaventura
Bartolomé de Las Casas
Meister Eckhart
6 Meine peruanische Familie
Martin von Porres
Rosa von Lima
Hubertus
Johannes der Täufer
Stephanus
Andreas
Ignatius von Loyola
7 Unsere Friedenauer Jahre
Benedikt von Nursia
Konrad von Parzam
Adolph Kolping
8 Arbeitswelten
Maximilian Maria Kolbe
Klara von Assisi
Elisabeth von Thüringen
Isidor von Sevilla
9 Reisebekanntschaften
Paul Chong Hasang und Andreas Kim Taegon
Felix von Girona
Georg
Josep Samsó i Elías
Januarius
Giuseppe Moscati
10 Freundeskreise
Benno von Meißen
Peter Truong Van Thi und Andreas Dung-Lac
Daniel Comboni
Johannes Bosco
11 In Glaubenskrisen und Schwierigkeiten
Thomas
Bonifatius
Judas Thaddäus
Erzengel
12 Im Angesicht von Krankheit und Tod
Corona
Teresa von Ávila
Heiligenverzeichnis
Mein Leben in Ereignissen und Werken
1 Heilige – was sind das für Menschen?
Eine ganz kurze Einführung ins Thema Heiligkeit
Eigentlich sind wir alle heilig – Sie und ich. Zumindest, soweit wir getauft sind. Dementsprechend bezeichnet Paulus die Mitglieder der ersten christlichen Gemeinden als „Heilige“, etwa die Schwestern und Brüder in Rom: „An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus“ (Röm 1,7) und in Ephesus: „Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi“ (Eph 4,11-12); die „Heiligen“ sind hier schlicht die Getauften, die Christen, die Gemeindemitglieder. Auch der Evangelist Matthäus spricht von der Heiligkeit, zu der wir berufen sind, wenn er schreibt: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist“ (Mt 5,48). Also: Wir sind alle potenziell heilig, wir können heilig werden. Jeder Mensch kann heilig werden.
Einige haben es in den Augen der Kirche bereits geschafft. Wir sind noch unterwegs, sie sind schon am Ziel. Und die Kirche feiert die Heiligen, verehrt sie in Dankbarkeit für die göttliche Gnade, die durch sie erfahrbar wird. An ihnen, an ihrem – oft beschwerlichen – Lebensweg lässt sich erkennen, was Nachfolge Christi bedeutet.
Doch die Kirche geht mit ihrer Erinnerungs- und Verehrungskultur noch weiter: Sie erhebt die Heiligen zur „Ehre der Altäre“ (in jedem Altar gibt es eine Reliquie), benennt Kirchengebäude und andere Einrichtungen nach Heiligen, führt sie in einem liturgischen Kalender, so dass sie – zusätzlich zum 1. November, dem Festtag aller Heiligen – noch an ihrem persönlichen Gedenktag in den Gottesdiensten Erwähnung finden, und proklamiert, dass sich die Heiligen bei Gott als Fürsprecherinnen und Fürsprecher für die Menschen einsetzen, die sie im Gebet um diese Fürsprache bitten.
Weil gerade diese Funktion als Brücke in die Transzendenz eine Dimension an Vollendung voraussetzt, die in tiefste Schichten des Glaubens eindringt, ist sich die Kirche bewusst, dass der Titel „heilig“ nicht leichtfertig vergeben werden darf. Sie hat darum ein Verfahren entwickelt, in dem genau geprüft wird, ob ein Mensch den Titel „heilig“ tragen darf, ob sie oder er als Heilige oder Heiliger verehrt werden soll.
Also: Wer oder was sind Heilige? Zunächst: Was sind sie nicht? Heilige sind keine menschlichen Halb-Götter. Sie sind vielmehr ganzheitliche Vorbilder für den Menschen auf dem Weg zu Gott. Heilige werden im christlichen Glauben verehrt, nicht angebetet. Der Personenkult mag in Show und Sport eine Rolle spielen, in der Kirche tut er es nicht. Jedenfalls nicht als Ausdruck der Lehre.
Wenn wir Menschen heilig nennen, so wollen wir damit sagen, dass sie in der „Ausstrahlung Gottes“ (Jörg Zink) leben, erkennbar daran, dass es ihnen besonders gut gelungen ist, sich den Willen Gottes zu eigen zu machen und danach zu handeln. So werden sie zu Vorbildern. Die tiefe Bedeutung der Heiligen liegt denn auch darin, dass mit dem lebendigen Glauben der Toten der tote Glaube der Lebenden erneuert wird. Wir sollten uns die Heiligen dabei nicht als besonders fromme, sondern vor allem als frohe und glückliche Menschen vorstellen. Das mag in einer Zeit, in welcher der Gute nur noch als der „Dumme“ erscheint und Cleverness die neue Weisheit ist, fremd wirken. Die Antike jedoch wusste, dass es einem genau dann und nur dann gut geht, wenn man Gutes tut. Im Laufe der letzten 2000 Jahre haben das einige Menschen verstanden. So unterschiedlich sie sein mögen, so eint sie doch der Wille, Gottes Willen zu tun und damit dem Menschen zu dienen.
Doch wie kommt die Kirche zu ihrem Urteil über die Heiligkeit von Menschen? Das ist etwas kompliziert, denn hier kommen theologische, ethische und kirchenrechtliche Aspekte zusammen. Ich möchte kurz – so kurz wie möglich – zu klären versuchen, wie der Prozess abläuft, durch den man in der Katholischen Kirche selig bzw. heilig wird, und was dieses Verfahren über den Seligkeits- bzw. Heiligkeitsbegriff der Kirche aussagt.
Zunächst einmal gilt für die Kirche im Zusammenhang mit der Seligund Heiligsprechung folgender Grundsatz: Alle Christen sind potentielle Kandidaten. Das entspricht dem, was in den eingangs zitierten Bibelstellen zum Ausdruck kommt, das entspricht aber auch dem Verständnis von Heiligkeit der nachkonziliaren Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat deutlich gemacht, dass alle Christen durch die Taufe Anteil an der Heiligkeit Gottes haben und dadurch zu einem heiligen Leben berufen sind (Lumen Gentium, Nr. 40).
Nun steht aber ebenfalls schon in der Bibel, dass viele berufen, aber nur wenige auserwählt sind (vgl. Mt 22,14). Nur wenige schaffen es, ihr Talent zur Heiligkeit nicht verkümmern zu lassen, sondern – mit Hilfe der Gnade Gottes – zur Entfaltung zu bringen. Menschen, denen das in besonderer Weise gelungen ist, gelten als Heilige und sollen künftige Christengenerationen anregen, ihre gottgegebene Chance zur Heiligkeit zu nutzen. Dazu muss das Leben der Heiligen in Erinnerung bleiben, was am besten dadurch befördert wird, dass sie regelmäßig in der Liturgie Verehrung erfahren – zumindest einmal im Jahr, am 1. November, an Allerheiligen.
Der Prozess lässt sich nach geltender kirchenrechtlicher Form am besten als doppeltes zweistufiges Verfahren mit zwei Instanzen beschreiben. Die Instanzen sind die Diözese (Bistum) und die zuständige Kongregation (Vatikan), auf denen jeweils die Doppelprüfung der Kandidatin bzw. des Kandidaten hinsichtlich der fama sanctitatis (Tugendhaftigkeit) und der fama signorum (Wundertätigkeit) stattfindet, wobei der ersten Stufe (Seligsprechung) die zweite Stufe (Heiligsprechung) nur dann folgt, wenn sich nach jener ersten Stufe ein weiteres Wunder eingestellt hat, das die selige Person nachdrücklich zur Heiligsprechung empfiehlt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, die fama martyrii (Martyrium, zu deutsch: „Zeugnis“), gilt – im Sinne einer besonderen Tugendübung – als Spezialfall der fama sanctitatis. Da das Martyrium in der Praxis der Heiligsprechung jedoch eine überragende Bedeutung hat und in der Kirchengeschichte eine enge Verknüpfung von Martyrium (als Bezeugung des Glaubens – bis zum Tod und im Tod) und Heiligkeit offenbar wird (so heißt das Heiligenverzeichnis Martyrologium), soll dieser dritte Aspekt neben der Tugendhaftigkeit und der Wundertätigkeit ebenfalls ausführlicher dargelegt werden.
Zunächst zum formalen Ablauf des Prozesses. Da es sich um ein Verfahren auf dem Rechtsweg handelt, muss dieser zunächst eingeschlagen werden. Das geschieht, wie in anderen Rechtsbereichen auch, auf Antrag. Im Heiligsprechungsprozess muss auf Diözesan-Ebene ein Antrag auf Einleitung des Verfahrens gestellt werden. Der Antragsteller (Aktor), dies kann eine Ordensgemeinschaft, eine Pfarrei oder auch jede und jeder einzelne Gläubige sein, ist Träger und Förderer des ganzen Verfahrens, was u. a. bedeutet, dass dessen Finanzierung sichergestellt werden muss, was bei dem zumeist mehrjährigen Prozess mit zahlreichen Gutachten ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist. In jedem Fall liegen die Kosten bei über 50.000 Euro. Allerdings hat der Vatikan für ärmere Diözesen einen Fonds eingerichtet, um zu gewährleisten, dass nicht etwa finanzielle Gründe die Aufnahme eines Selig- bzw. Heiligsprechungsprozesses verzögern oder gar unmöglich machen.
Auf den Antrag hin beginnt ein Sachverständiger (Postulator) mit Nachforschungen zu der betreffenden Person, die zum Zeitpunkt der Antragstellung im übrigen schon mindestens fünf Jahre lang tot sein muss – Ausnahmen bestätigen die Regel; für den Seligsprechungsprozess Johannes Pauls II. gab es eine solche, um die „Santo subito!“-Forderung der Gläubigen zu erfüllen, und auch, wenn man in der Kirchengeschichte etwas weiter zurückgeht, findet man Fälle sehr schneller Kanonisierungen, etwa bei Franz von Assisi (1226 verstorben, 1228 heiliggesprochen) und Elisabeth von Thüringen (1231 verstorben, 1235 heiliggesprochen). Der Postulator muss klären, ob unter den Gläubigen ein Ruf der Heiligkeit vorhanden ist. Hat bereits ein Kult um die verstorbene Person eingesetzt, so hemmt dies den Prozess, denn die Kirche will keine Verehrung von Menschen außerhalb der von ihr konstituierten „Gemeinschaft der Heiligen“. Andere Hindernisse auf dem Weg zur Heiligsprechung, die der Postulator finden könnte, betreffen den Lebenswandel und den Glauben der Kandidatin bzw. des Kandidaten, für die Dauer des Verfahrens „Dienerin Gottes“ resp. „Diener Gottes“ genannt. Auch bei fehlenden Zeugen oder Dokumenten wird das Verfahren eingestellt, bevor es richtig losgehen konnte.
Steht der Aufnahme des Verfahrens jedoch nichts entgegen, erfolgt das Gesuch des Postulators beim Diözesanbischof, der den Antrag mit Hilfe eines Kirchenanwalts und eines Notars prüft. Entschließt sich der Bischof zur Eröffnung des Verfahrens, wird im nächsten Schritt das Schriftgut auf Widersprüche zum Glauben und zur Moral der Kirche hin untersucht. Danach erfolgt die Befragung der Zeugen, welche die vorliegenden Erkenntnisse über das Leben, insbesondere die fama sanctitatis, bestätigen müssen, damit der Prozess weiterlaufen kann. Parallel dazu wird die fama signorum zu verifizieren versucht, denn ein Wunder gilt als stärkste Bestätigung der Tugendhaftigkeit. Dabei ist der Nachweis eines Wunders weder hinreichend noch notwendig. Der Grundsatz lautet: Es geht auch ohne, aber besser wäre es schon. Wie diese Verifikation aussieht, soll weiter unten eingehend erläutert werden.
Sind die Nachforschungsergebnisse insgesamt geeignet, die Heiligkeit der betreffenden Person zu belegen, geht der Vorgang nach Rom, an die Kongregation für die Heiligsprechungen der römischen Kurie (Dicasterium de Causis Sanctorum). Der Vatikan erhält, wiederum über einen Postulator, eine Aktenabschrift (Transumpt) für sein Archiv sowie eine Kopie (copia publica) zur weiteren Bearbeitung des Falls; die Originalakten verbleiben im Diözesanarchiv. Selbstverständlich müssen Original, Abschrift und Kopie inhaltsgleich sein, was Bischof, Anwalt und Notar dem Vatikan bestätigen.
Das Verfahren wird nun von der Kongregation im Vatikan weitergeführt, mit dem Kardinalpräfekten an der Spitze und einem Sekretär, der dem Papst über die Sitzungen des Gremiums berichtet. Es wird ebenfalls ein Aktor bestellt sowie als wichtigste Gruppe innerhalb der Kongregation der congressus ordinarius, in dem das Verfahren maßgeblich betrieben wird, bestehend aus dem Kardinalpräfekten, dem Sekretär und einem Untersekretär, dem Generalrelator, dem Glaubensanwalt (promotor fidei) sowie dem Relator der causa. Das Kollegium wählt unter der Leitung des Generalrelators als Relator der causa einen ausgewiesenen Kirchenhistoriker und Theologen, der sich in der vorliegenden Sache besonders gut auskennt. Ihm kommt eine Schlüsselrolle im Verfahren zu: Er ist verantwortlich für die Erstellung des Gutachtens über das Tugendleben und den Ruf der Heiligkeit (positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis), ein dokumentiertes, chronologisch geordnetes Dossier über das Leben und Wirken des Dieners resp. der Dienerin Gottes, das als Grundlage für das theologische Urteil über die Heiligkeit dient.
Die gedruckte positio wird dem Glaubensanwalt und dem congressus peculiaris, bestehend aus acht Theologen, zur Überprüfung vorgelegt; der promotor fidei und die Mitglieder des congressus peculiaris erstellen unabhängig voneinander ihre Gutachten. Weichen die Stellungnahmen voneinander ab, was bei neun Sachverständigen in der Regel der Fall sein wird, versendet der Glaubensanwalt sein Gutachten nebst Kopien der Gutachten der Mitglieder des congressus peculiaris an alle Kollegen, so dass sich diese im Vorfeld der entscheidenden Sitzung ein Bild über die unterschiedlichen Positionen machen können. Auf dieser Sitzung, die vom promotor fidei geleitet wird, kommt es nach Diskussion der Differenzen zur Abstimmung; der Diener bzw. die Dienerin Gottes braucht mindestens eine Zwei-Drittel-Mehrheit, d. h. sechs der neun Theologen müssen seine bzw. ihre Heiligkeit bejahen. Das Protokoll der Sitzung geht an die Hauptversammlung der Kongregation, die schließlich entscheidet, ob dem Papst die Selig- bzw. Heiligsprechung vorgeschlagen werden soll.
Selbstverständlich wird auch auf der Ebene der Kongregation noch einmal die fama signorum, also die Wundertätigkeit, zu verifizieren versucht. Da es sich zumeist um Heilungswunder handelt, wird das Dossier über die Wunder (positio super miraculis) von zwei Medizinern als Sachverständige unabhängig voneinander begutachtet. Ist zumindest eine Stellungnahme positiv, so geht das Dossier zur weiteren Untersuchung an die consulta medica, ein Gremium von fünf medizinischen Experten. Hinzu kommen der Sekretär der Kongregation, der Generalrelator und der Glaubensanwalt, die hinsichtlich formaler Verfahrensangelegenheiten und etwaig auftretender theologischer Fragen kontrollierend bzw. beratend zur Seite stehen; in die medizinische Diskussion greifen sie nicht ein. Sind drei der fünf medizinischen Experten der Meinung, es liege eine wissenschaftlich nicht erklärbare Heilung, also ein Wunder, vor, wird der Bericht der consulta medica an den congressus peculiaris weitergeleitet, welcher der Hauptversammlung der Kongregation eine Beschlussempfehlung in der Frage des Wunders erteilt, die allein entscheidend ist im Hinblick auf das Votum der Hauptversammlung für den Papst, denn ein übernatürliches Eingreifen Gottes kann nur auf Grundlage des Glaubens bestätigt werden, hier: vom achtköpfigen Theologengremium namens congressus peculiaris.
Die ultimative Entscheidung über die Selig- bzw. Heiligsprechung trifft der Papst. Er kann die vorgeschlagenen Diener und Dienerinnen Gottes zur „Ehre der Altäre“ erheben, er muss es aber nicht. Es gibt gewissermaßen keinen Rechtsanspruch auf Selig- bzw. Heiligsprechung, auch dann nicht, wenn alle Gremien diese befürworten. Umgekehrt braucht es diese, damit der Papst überhaupt Menschen selig oder heilig sprechen kann. Also: Die Selig- bzw. Heiligsprechung kann nicht gegen den Willen des Papstes durchgesetzt werden, der Papst seinerseits kann keine Selig- bzw. Heiligsprechung aus freien Stücken vornehmen.
Nach erfolgter Seligsprechung (Beatifikation) bekommt die Dienerin bzw. der Diener Gottes den Titel „Selige“ oder „Seliger“, nach der Heiligsprechung (Kanonisation) den Titel „Heilige“ resp. „Heiliger“. Selige werden diözesan (regional) verehrt, Heilige gesamtkirchlich (global). Ausschließlich nach Heiligen dürfen Kirchen oder Kapellen benannt, nur sie können als Patrone von Gemeinden eingesetzt werden (zumindest ist das in der Regel so, es gibt auch hier Ausnahmen, etwa die Pfarrei Bernhard Lichtenberg in Berlin, die am 1. Januar 2021 begründet wurde), nur ihr Festtag (Geburts- oder Todestag) wird als gebotener Gedenktag begangen. Voraussetzung für den Aufstieg von der Seligkeit zur Heiligkeit ist – wie oben bereits angesprochen – der Nachweis eines Wunders nach erfolgter Beatifikation.
Das war der – recht komplizierte und langwierige – Verfahrensgang in formaler Hinsicht. Worum geht es dabei inhaltlich? Kurz gesagt: Um die Auseinandersetzung mit den drei Kernthemen des katholischen Heiligkeitsverständnisses: Tugendhaftigkeit, Wundertätigkeit, Martyrium.
Tugendhaftigkeit. Heiligkeit wird insbesondere darauf zurückgeführt, dass die betreffende Person in ihrem Leben die drei christlichen Tugenden (Glaube, Hoffnung, Liebe) sowie die vier platonischen Kardinaltugenden (Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung) in einer den Zeitumständen entsprechenden Weise überdurchschnittlich gelebt hat. Nur die Tugendhaftigkeit als Moralität des Heiligen ist conditio sine qua non für die Heiligkeit, alles andere sind bestätigende Beigaben, die auf die Wirkung (Wunder) sowie auf die Beharrlichkeit (Martyrium) des tugendhaften Lebens verweisen.
Es hat nun wenig Sinn, die sieben Tugenden der Reihe nach durchzugehen, da jede einzelne eine eigene Abhandlung nötig macht. Es soll mithin nachfolgend um den moraltheoretischen Ansatz als solchen gehen, um die Tugendethik. Grundsätzlich stellt die katholische Tugendethik eine Rückbesinnung auf die aristotelisch-thomistische Tradition des Strebens nach dem Glück und dem Guten und damit eine Abkehr von protestantisch-pietistischer Gebotstreue dar, die in der kantianischen Tradition des Sollens steht, also die Erfüllung von Pflichten verlangt. Doch die beiden ethischen Begründungsfiguren „Streben“ und „Sollen“ lassen sich nicht wirklich voneinander trennen. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar, nicht nur für das Leben der Heiligen, sondern für das menschliche Leben ganz allgemein. Die Notwendigkeit einer Verbindung teleologischer und deontologischer Ansätze in der Moraltheorie hat anthropologische Ursachen.
Was bedeutet das? Zunächst bedeutet dies keine Naturalisierung der Ethik oder Aufhebung der Moraltheorie durch den Fehlschluss vom Sein auf das Sollen, sondern die Notwendigkeit einer Klärung des Menschenbildes vor einem Diskurs über Werte und Normen, ein Bewusstwerden, dass die Verinnerlichung des äußeren Gesetzes nur möglich ist, wenn das Gesetz wiederum Ausdruck der inneren Anlagen ist, d. h. die Erkenntnis, dass die Beziehung von Pflicht und Streben von letzterem ausgehen muss und auch ausgehen kann, da das Verlangen nach dem Guten und der Wahrheit jedem Menschen zu eigen ist, Gesetzestreue folglich aus innerem Antrieb geschieht, weil man das Sollen für erstrebenswert hält. So zeigen sich in den Tugenden und den Pflichten nicht Gegensätze, sondern zwei Seiten der Moralität des geheiligten Lebens, die gleichermaßen in der Natur des Menschen wurzeln.
Insbesondere die Natur des Menschen, wie sie bei Thomas von Aquin beschrieben wird, ebnet den Weg für ein Verständnis von Ethik „von innen heraus“ und ergänzt damit den äußerlichen Aspekt der gebotsorientierten Moraltheologie. Mehr noch: Sie wird zum „Lebensgesetz“, das allen Tugenden sowie allen Gesetzen und Geboten vorausgeht. Der Widerspruch von Tugend und Pflicht in den Grundkonzepten Strebensund Sollensethik wird also aufgebrochen, wenn mit Verweis auf dieses Lebensgesetz gezeigt wird, dass die Gebote Gottes der menschlichen Natur, d. h. den Bestrebungen unseres Seelenvermögens – und damit unserer Freiheit – entsprechen, und dass der Mensch qua natura auf das Gute und die Wahrheit ausgerichtet ist, was das eigene Glück und Wohlbefinden einschließt. Das Streben nach Glück und das Vollziehen des Guten stehen also nicht im Widerspruch zueinander, vielmehr bedingen sie sich, auch und gerade im Leben der bzw. des Heiligen.
Wundertätigkeit. Die Wundertätigkeit stellt keine absolute Notwendigkeit dar, wenn es um die Frage geht, ob eine Person im Sinne der Kirche heiligmäßig gelebt hat. Sie ist gewissermaßen nicht verpflichtend, sondern erwünscht. Sie bestätigt als Konsequenz des tugendhaften Lebenswandels die Heiligkeit des Menschen und gehört von daher mit zur Prüfung im Verfahren.
Was aber gilt der Kirche als „Wunder“? Ein Wunder ist ein unerwartetes, innerweltlich (insbesondere auch wissenschaftlich) nicht erklärbares Geschehen, das in Gottes Willen seinen Ursprung hat, wenn es auch durch Menschen oder andere Geschöpfe vermittelt ist. Wunder zeigen uns, worauf Gottes Schöpfung hinausläuft, die wir als unvollendet ansehen, als prozessual und daher als sich immer weiter entwickelnd. Wunder geben einen Vorgeschmack auf das wirklich wunderbare Ziel unseres Daseins, an dem uns das Wunder der Vollendung in Gott als Dauerzustand erwartet. Soweit der Glaube der Kirche.
Als paradigmatisch für Wesen und Wirken der Wunder gelten die Evangelien, die eine Quelle verschiedener Wunderberichte sind, deren Überlieferungsbestand einen Anhaltspunkt bei der historischen Beurteilung der Wundertätigkeit Jesu darstellt. Der Duktus der Erzählungen spricht dabei für die Historizität der Wunder; oft wird sehr nüchtern berichtet. Auffällig ist ihr Anteil an den vier Beschreibungen des Lebens und Wirkens Christi; allein im Markusevangelium machen die Wunderberichte etwa ein Drittel des Textumfangs aus. Die Bedeutung der Wunder, von denen die Evangelien berichten, liegt in ihrer Verbindung zur Eschatologie, denn in der Wundertätigkeit Jesu bricht das Reich Gottes erfahrbar an. Zugleich bringen sie das Geheimnis des Gottesreichs auf die Erde. Dabei entäußert sich das Reich Gottes in der Wundertat, bleibt jedoch unverstanden, zumindest solange, bis die Auferstehung den wundertätigen Jesus als den Sohn Gottes erweist. Jesu Selbstauskunft zu Lebzeiten wird noch zu sehr von der Heimlichkeit vieler Wunderhandlungen und dem darauf zumeist folgenden Schweigegebot überlagert, als dass sich schon allein durch Selbstauskunft und Wundertätigkeit seine Gottessohnschaft hätte offenbaren können. So bleibt das Ostergeschehen in seiner Bedeutung unverzichtbar, als das größte Wunder, das die Christen alle anderen Wunder als Taten des Gottessohnes anerkennen lässt.
Wunder sind Transzendenzerfahrungen in der Immanenz der Welt. Besonders bedeutend sind hierbei Heilungswunder: Die Ärzte wissen keinen Rat, das Bittgebet aber heilt. Man mag sich darüber streiten, ob es in solchen Fällen der Transzendenzbezug im Glaubensakt des Gebets ist, der heilt, oder vielmehr der Glaube an die Heilkräfte dieses Transzendenzbezugs. Das ist selbst eine Glaubensfrage. Im Heilungswunder offenbart sich aber der Zusammenhang von Heiligung und Heilung: Die Heiligung durch das Wunder liegt in der Heilung dessen, an dem sich das Wunder vollzieht. Die Heiligkeit des Wundertäters wird abhängig vom Heil anderer Menschen. Es geht also ganz wesentlich auch um die positiven Folgen – ein Ereignis, das unerklärbar ist, aber Menschen schadet, wäre im christlichen Sinne kein Wunder, da aufgrund der negativen Konsequenz der Ursprung des unerklärbaren Ereignisses nicht im Willen Gottes liegen kann, wenn man – wie das Christentum – an einen Gott glaubt, der Liebe ist.
Für die katholische Theologie sind in der Wunderfrage – wie auch in vielen anderen Fragen – insbesondere Augustinus und Thomas von Aquin wichtige Gewährsmänner. Bei Augustinus überwiegt der Hinweis- und Zeichencharakter des Wunders. Er billigt Wundern keinen Sonderstatus hinsichtlich ihrer ontologischen Struktur zu. Das Wunder als göttliche Tat dient letztendlich dazu, Gott zu erkennen, und zwar aus den sichtbaren Dingen. Nach Augustinus liegt der Zweck der Wundertätigkeit darin, uns auf das Wunder der Wirklichkeit zu stoßen, also uns nicht nur einen Vorgeschmack auf die vollendete Schöpfung zu geben, die einst als Wunder offenbar wird, sondern eine andere Perspektive auf die nur scheinbar unvollendete Schöpfung anzubieten, die uns erkennen lässt, dass bereits hier und jetzt das in Aussicht gestellte „DauerWunder“ jenseitiger Vollendung zu erleben ist. Bei Thomas überwiegt schließlich die Bestimmung des Wunders von der unmittelbaren transzendentalen Kausalität Gottes her; den Gedanken übernimmt er von Aristoteles, der einen „unbewegten Beweger“ als Erstursache postulierte. Das Wunder läuft vorbei an der Ordnung der Natur, es findet unter Übergehung der uns bekannten Ursachen statt. Es kommt von Gott und – so darf man wohl hinzufügen – wir werden die Ursachen des göttlichen Wirkens nie von Gott selbst trennen können, ganz im Sinne von Aristoteles' „unbewegtem Beweger“.
Darin steckt wissenschaftstheoretische Brisanz: Jenseits der Ebene empirisch erfahrbarer Naturrealität werden göttliche Wirkkräfte angesiedelt, die mit dem Methodeninventar der Naturerforschung nicht beschrieben werden können, die somit vorbei an den für uns erkennbaren Naturgesetzen in die Natur einwirken und dort wahrnehmbare Folgen zeitigen. Damit dies denkbar wird, muss – etwa mit dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz – zwischen Ursache und Grund sowie zwischen Finalität und Kausalität unterschieden werden. Zur Verdeutlichung: Dass ein Stein zu Boden fällt, hat seinen Kausalgrund in der Gravitation, die durch eine naturwissenschaftliche Theorie beschrieben wird. Worin jedoch die Finalursache der Gravitation besteht, dazu kann und will die naturwissenschaftliche Theorie keine Aussage machen. Hier entsteht Freiraum für philosophische Spekulation und für den religiösen Glauben. Diese Trennung von materialer Welt (Leibniz nennt diese das „Reich der Natur“) und geistiger Welt (bei ihm das „Reich der Zwecke“ oder der „Gnade“) ist notwendig, um mit Thomas eine Einwirkung auf die Natur (bedingt durch die Finalität) vorbei an der Ordnung der Natur (bestimmt durch die Kausalität) überhaupt für möglich halten zu können. Diese Trennung bedeutet aber auch, dass Wunder sich nur um den Preis einer Metaphysik der Erkenntnis und des Wissens verstehen und akzeptieren lassen. Dass diese Metaphysik von der modernen Naturwissenschaft abgelehnt wird und der Wunderbegriff für sie daher obsolet ist, mag wiederum nicht wundern; hier wird die Idee der uns nicht bekannten natürlichen Ursachen zur Hoffnung des „ Noch nicht, aber bald“ umgewandelt. Was zu diesem Grundkonflikt zwischen naturalistischer und metaphysischer Wissenschaftstheorie zu sagen wäre, ist so vielschichtig und umfassend, dass es den Rahmen dieser Einführung sprengen würde.
Martyrium. Kulminationspunkt des heiligen Lebens ist die Bereitschaft, um der Tugend willen, also insbesondere um Glaube, Liebe und Hoffnung willen, in den Tod zu gehen und damit zu verdeutlichen, dass ein Leben ohne die heiligenden Tugenden nicht lebenswert ist. Auch hier findet sich in der Bibel das Paradigma: die Steinigung des Stephanus (Apg 7,54-8,1a).
Der Gedanke, das Leben sei nicht über alles zu stellen, die Wertschätzung bestimmter Ideale mithin wichtiger als der Erhalt der eigenen biologischen Existenz, ist nicht nur in der Kirche und in der Geschichte des Volkes Gottes vorhanden. Fidel Castros Losung „Sozialismus oder Tod!“ deutet an, dass für einen Kubaner das (Über-)Leben in einer anderen Gesellschaftsform undenkbar sein soll, umgekehrt geisterte der Spruch „Besser tot als rot!“ im Kalten Krieg durch die westliche Welt. Für den Heiligen bzw. die Heilige ist ein Leben, das nicht im Einklang mit den Geboten Gottes steht, nicht lebenswert. Es kann aus christlicher Sicht keine Anpassung, keine Kompromisse, kein Arrangement mit den Verhältnissen geben, soweit diese nicht den Geboten Gottes entsprechen. Und wenn der Widerstand gegen ein gottloses, unchristliches System mit dem Leben bezahlt werden muss, dann – so die innere Logik des Martyriums – sei es so. Das jedoch gilt auch für den Freiheitskämpfer, der sich entschlossen gegen undemokratische Strukturen stellt.
Was aber unterscheidet das Martyrium des Heiligen von dem des Helden, der etwa für die Freiheit seines Volkes zu sterben bereit ist? Eine erste Annäherung an diese Frage bestünde darin, festzustellen, dass im Martyrium nicht nur im, sondern mit dem Tod Zeugnis für ein Ideal, etwa den Glauben, abgelegt wird. Der Märtyrer bezeugt seinen Glauben, auch auf die Gefahr hin, dabei mit seinem Leben zu bezahlen. Die Bereitschaft, diese letzte Konsequenz zu tragen, passt zur Radikalität des Heiligen, der allen vor Augen führt, dass es ihm ernst war und ernst ist mit seiner Überzeugung, so ernst, dass er ihr treu bleibt, bis in den Tod. Dieses Schema passt aber auch auf die Gesinnung eines Helden, der für eine politische Überzeugung zu sterben bereit ist und mit seinem Tod für sie Zeugnis ablegt; die Geschichte lebt von diesen Menschen, ohne dass sie Heilige wären.
Um nicht nur die Zusammengehörigkeit von Tod und Zeugnis im Akt des Martyriums, sondern auch dessen Heiligkeit zu erahnen, müsste in einer genaueren Betrachtung zwischen zwei Komponenten des Martyriums unterschieden werden: zum einen dem freiwilligen Tod als Akt der Wahrung persönlicher Integrität in der existenziellen Gewissensnot und der damit verbundenen „Heiligung“ des eigenen Lebens sowie zum anderen dem mit diesem Tod gegebenen Zeugnis als Akt der „Heiligung“ eines Ideals. Auf dieses Ideal kommt es letztlich an, ob von der Heiligkeit des Martyriums gesprochen werden kann, denn nur, wenn das, was der Märtyrer bezeugt, wofür er stirbt, heilig ist, ist auch das Martyrium ein heiliger Akt. Während dies beim Helden, der für die Freiheit stirbt, in den Augen der Kirche nicht der Fall ist, erweist sich der Heilige, der für Gott stirbt, gerade dadurch als heilig, dass er im Tod für das Heilige Zeugnis ablegt.
Mehr noch: Das Zeugnis des Märtyrers ist nicht nur ein persönlicher Glaubensakt, mit dem er im Sinne der Integrität sich selbst über den Tod hinaus treu bleibt, sondern er bezeugt den Glauben an sich, weil sich im Zeugnis der Glaube der Kirche, nicht nur der persönliche Glaube, als das Bezeugte manifestiert. Wesen und Akt des Glaubens fallen im Zeugnis in eins, denn das Zeugnis im Tod des Heiligen zeugt vom Wesen des Glaubens und ist zugleich ein Akt des Glaubens. Auch dies könnte noch gelten, ersetzte man „Glauben“ durch „Freiheit“, denn das Zeugnis im Tod des Helden offenbart ebenso als Akt der Freiheit zugleich das Wesen der Freiheit, das nämlich genau darin besteht, freiwillig für seine Ideale sterben zu können. Es geht also auch beim Helden nicht nur um die persönliche Freiheit, sondern um Freiheit an sich.
Doch nur, wenn das Geglaubte etwas Heiliges ist und damit das Heilige an sich bezeugt wird und sich im Zeugnis das Heilige selbst die Bezeugung schafft, was die besondere Begnadigung des Zeugen durch das Heilige andeutet, nur dann liegt es nahe, vom Martyrium als einem Akt der Heiligkeit zu sprechen, der den Märtyrer zum Heiligen macht. Dieses bezeugte und sich zugleich Bezeugung schaffende Heilige ist Gott, die christliche Religion, aber auch die Instanz, die heiligspricht, die Kirche. Hätte sie dieses Selbstverständnis, als Kirche heilig zu sein, nicht, könnte sie nicht nur den Titel nicht (weiter)verleihen, sondern stellte sich selbst grundsätzlich in Frage. Heiligkeit ist ein Wesensmerkmal die Kirche, nicht nur, weil sie Gott bezeugt, und damit eine Märtyrerin ist, sondern weil sich Gott selbst diese Bezeugung durch sein eigenes Martyrium geschaffen hat – durch den Kreuzestod des menschgewordenen Gottes, Jesus Christus.
Das wiederum bedeutet nicht, dass die Kirche nur Heiliges vorzuweisen hat, nur Tugendhaftes, nur Wunderbares. Ihre 2000-jährige Geschichte ist voller Verfehlungen. Die heilige Katholische Kirche ist damit immer auch Gemeinschaft der Sünder. Sie ist heilig, insoweit sie göttlicher Stiftung entspringt, sie ist sündig, weil in ihr Menschen wirken. In ihrer Geschichte zeigt sich beides: Der göttliche Funke der Heiligkeit, der in Menschen wie Franz von Assisi oder Mutter Teresa das Feuer der Liebe entfachte, und die tiefsten Abgründe des Menschen, in denen wir voll Entsetzen die Verfolgung Andersdenkender und den sexuellen Missbrauch von Kindern erblicken.
Also: Das Martyrium ist notwendig (personale Integrität vor dem eigenen Gewissen in der Treue zum Heiligen über den Tod hinaus) und hinreichend (untrügliches Schaffen von Bezeugung durch das Heilige selbst) für die Heiligkeit eines Menschen, wenn das Ideal, für das er sterbend Zeugnis abgab, selbst heilig ist.
Nun müssen wir das Martyrium noch zu einer anderen Seite hin abgrenzen, zum islamistischen Selbstmordattentäter. Offenbar wird durch die langjährige Berichterstattung über Selbstmordattentäter der Begriff des Martyriums völlig falsch konnotiert. Märtyrer, das sind in den Augen vieler Menschen junge Männer (oder Frauen), die mit einem Sprengstoffgürtel ins Einkaufszentrum rennen – und sich dabei auf Gott (bzw. Allah) berufen. Wo ist da der Unterschied zu einem Diakon Stephanus, der sich bei seinem Martyrium ja auch auf Gott beruft? Fragt allen Ernstes die evolutionistische Ethik der Soziobiologie, die das Martyrium als Urinstinkt auffasst, der ehemals sinnvoll gewesen sei, weil er Gemeinschaften stabilisierte, in modernen Gesellschaften jedoch als „Fehlanpassung“ ins Leere liefe, weil der Vorteil – worin und in welcher Hinsicht dieser auch immer genau bestanden haben mag – heute nicht mehr existiere. Mit dieser abenteuerlichen These sollen christliches Blutzeugnis und islamistischer Terror auf eine gemeinsame evolutionsbiologische Basis zurückgeführt werden. Zwischen Sterben zum Zeugnisgeben und als Akt der Hingabe (christliches Martyrium) und dem Töten als Gewaltakt (islamistisches Selbstmordattentat) wird motivational nicht unterschieden. Die Aufopferung geschieht nicht für Gott, für den Glauben, für ein höheres Ideal, sondern für die Gemeinschaft. Das ist die evolutionäre Logik, mit der christliches Martyrium und islamistisches Selbstmordattentat geklammert werden. Nach dieser Logik macht es dann auch keinen Unterschied für das Verständnis des Vorgangs, ob man nur sich selbst oder auch Andere opfert.
Man muss aber wissen: Der Begriff des Martyriums im Christentum ist ein grundlegend anderer als der im Islam. Martyrium bedeutet Zeugnis. Der christliche Märtyrer gibt Zeugnis für den Glauben – mit dem eigenen Leben, nicht mit dem Leben anderer. Das macht ihn in den Augen der Kirche zu einem Vorbild. Gott und Mensch verweisen im Martyrium aufeinander: Gott stiftet dem Märtyrer seine übermenschliche Liebe ein, der Märtyrer deutet durch sein Opfer auf Gott. Ein christlicher Märtyrer ist also ein Mensch, der zum Zeugnis für seine Idee diese über das eigene Leben stellt, weil ihm ein Leben ohne die Verwirklichung der Idee nicht lebenswert erscheint. Er stellt sie über das eigene Leben, nicht über das Leben anderer Menschen. Das ist die entscheidende Differenz. Nicht Gewalt ausüben, sondern Gewalt erleiden. Nicht suchen, sondern finden lassen. Nicht anstreben, sondern annehmen. Das christliche Martyrium bleibt unverstanden, wenn es nicht theologisch, sondern biologisch, psychologisch oder soziologisch interpretiert wird. Das Martyrium aus Überzeugung, von dem niemand etwas erfährt, passt nicht ins Denken unserer Zeit, ein Denken, das den Glauben kategorisch ausklammert, ebenso wenig, wie das Opfer aus Liebe, einer Liebe, die nicht auf die Gegenleistung seitens der Gemeinschaft hofft, einer Liebe, die nicht auf den Nutzen ihrer Entäußerung setzt, einer Liebe, die das eigene Leben relativiert, die absolut ist, weil sie sich vom Absoluten gestiftet weiß.
Kommen wir schließlich noch einmal zum christlichen Verständnis der Heiligkeit und damit zur Einheit von Güte und Glück, die im Heiligen zu finden ist. Die Tugendhaftigkeit als die Moralität, die weit über das hinausgeht, was erwartet werden darf, die Wundertätigkeit als das Besondere, das der Wertschätzung des Alltäglichen dient und das Martyrium als die Treue und die Bereitschaft, nicht nur bis zur Vollendung im Tod, sondern mit und durch den Tod Zeugnis abzulegen von Gott – wer diese Aspekte verinnerlicht, darf wahrhaftig als heilig gelten, als Vorbild im Glauben und in der Nachfolge Christi.
Die Christen, die – wie schon erwähnt – ausnahmslos zur Heiligkeit berufen sind, sind auch heute aufgefordert, die Nachfolge Christi unter diesen Bedingungen anzutreten und ihre Leben dadurch zu heiligen. Werden sie dabei nicht nur ein gutes, sondern auch ein glückliches, ein gelungenes Leben führen, nach den Vorzeichen der Weltimmanenz? Oder bleiben sie auf dem Weg zur „Ehre der Altäre“ selbst „auf der Strecke“, als „Opfer“ ihrer eigenen Ansprüche, die aus denen der Kirche resultieren?
Ich denke, wie bereits angedeutet, dass „Gutsein“ und „Glücklichsein“ im Leben der bzw. des Heiligen zusammengehören. Das Streben nach dem Glück und dem Guten sind verschiedene Ausdrücke der einen menschlichen Natur. Das natürliche Sittengesetz ist ein inneres, es ist dem Menschen in Herz und Verstand geschrieben, auch wenn es sich in äußerer Gebotsform ausdrücken lässt, wie etwa in der Goldenen Regel. Die Natur des Menschen weckt die Tugenden und liefert damit die Bedingung der Einsichtsmöglichkeit in die Gültigkeit der Regel, die nicht vermittelt, gelernt und befolgt werden könnte, wenn nicht im Menschen die entscheidende Triebkraft ihrer Anerkennung läge. Die anthropologische Betrachtung und die Bewusstmachung, was der Mensch ist, geht damit der Ethik voraus.
„Gutsein“ und „Glücklichsein“ – in der griechischen Antike war die Unterscheidung der beiden Begriffe überhaupt kein Gegenstand. „Gutsein“ als Gesamtheit tugendhafter Lebensvollzüge und „Glücklichsein“ als Gefühlskomponente fielen zusammen. Auf die Frage „Geht es Dir gut?“ antwortete man „Ja, ich handle gut.“ Es geht mir gut, wenn ich gut handle! Soweit die Antike, man denke etwa an Aristoteles’ eudaimonia. Umgekehrt zeigen Forschungsergebnisse aus den letzten Jahrzehnten, dass schlecht zu handeln unglücklich macht. So beschreibt das Konzept der kognitiven Dissonanz des Psychologen Leon Festinger ein Gefühl der Freudlosigkeit als Folge moralischen Fehlverhaltens, was darauf verweist, dass wir von Natur aus im Einklang mit unseren Wertüberzeugungen zu handeln prädestiniert sind und jede Abweichung zunächst uns selbst stört. Insoweit erzeugt auch pflichtbewusstes Regelfolgen jene tiefe Freude, die das Glück des Menschen ausmacht, der damit seinem natürlichen Glückstreben gerecht wird. Erst die Befolgung des Gesetzes (Kern der Sollensethik) löst damit die Hoffnung auf das eigene Glück (Kern der Strebensethik) ein.
Wir sollten uns also heilige Menschen zunächst und vor allem als glückliche und dann erst als gute Menschen vorstellen. Wenn an die Seligen und Heiligen nicht als Opfer ihrer eigenen Maxime gedacht wird, sondern als selbstbewusste Persönlichkeiten, die genau das wollten, was sie taten und taten, was sie wollten und dabei glücklich waren, tut das der Würdigung ihrer Lebensleistung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Der Gedanke an die enge Verknüpfung von Güte und Glück macht Menschen, die unnahbar scheinen, verständlich und greifbar, so dass ein Nacheifern dieser Vorbilder eher möglich wird als unter der Annahme, sie hätten etwas „Besonderes“, das dem „normalen“ Menschen, trotz allgemeiner Berufung zur Heiligkeit bzw. Moralität, nicht gegeben ist. Sie werden so „vermenschlicht“ und damit hinsichtlich ihrer Vorbildfunktion noch wertvoller. Und darum geht es – ich wiederhole mich da gerne: Die tiefe Bedeutung der Heiligen liegt darin, dass mit dem lebendigen Glauben der Toten der tote Glaube der Lebenden erneuert wird. Schauen wir, wie das mit der Betrachtung der 72 Beispiele gelingen kann.
2 Am Anfang – und schon davor
Agnes von Rom
Meine Großmutter mütterlicherseits heißt Agnes, benannt nach Agnes von Rom, eine Märtyrerin aus dem 3. Jahrhundert. Sie war Tochter einer römischen Adelsfamilie. Der Sohn des Präfekten hatte ein Auge auf sie geworfen und wollte Agnes zur Frau nehmen. Zum Tode verurteilt wurde sie, weil sie den Heiratsantrag des jungen Mannes mit den Worten ablehnte, sie sei schon vergeben – ihr Verlobter sei Christus. Nun gab es aber ein Problem: Jungfrauen durften in Rom nicht hingerichtet werden. Das Gericht übergab sie dem Freier und ließ Agnes zur Überwindung dieses juristischen Hemmnisses vergewaltigen.
An dieser Stelle setzt die Legende ein. Die Legenda aurea berichtet ziemlich detailreich von der Vergewaltigung und ihren Folgen. So soll der ganze Tatort in einem gleißenden Licht erstrahlt sein und der Vergewaltiger wurde von einem Dämon niedergestreckt. Die Heilige Agnes habe ihren Peiniger daraufhin durch Gebet ins Leben zurückgeholt, so die Legende weiter. Nun war sie obendrein der Hexerei verdächtig und sollte auf den Scheiterhaufen. An dieser Stelle sei ein anderes Problem aufgetreten: das Feuer sei vor ihr zurückgewichen.
Wie im Fall der Heiligen Katharina von Alexandria, von der im nächsten Kapitel die Rede sein wird, musste man sich überlegen, wie das Todesurteil vollstreckt werden kann. Auch bei Agnes ist es schließlich die Enthauptung, die ihr irdisches Leben beendet. Dabei soll der Henker die junge Frau so enthauptet haben, wie es sonst nur beim Schlachten von Lämmern üblich ist. Agnes wird daher oft mit einem Lamm (lat. „agnus“) dargestellt. Sie gilt als Schutzpatronin der Jungfrauen und der jungen Mädchen, der Verlobten und der Keuschheit. Ihre Reliquien befinden sich in Sankt Agnes vor den Mauern