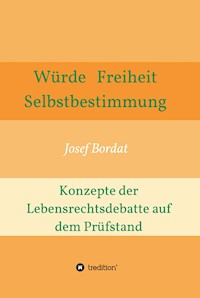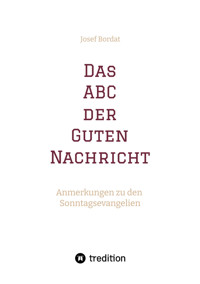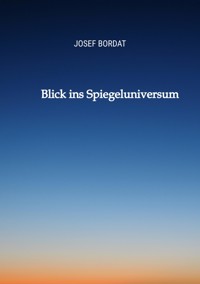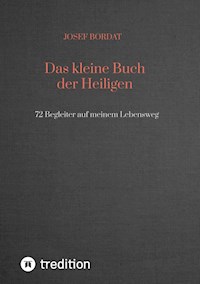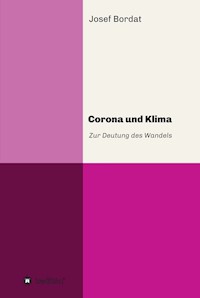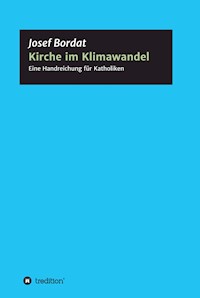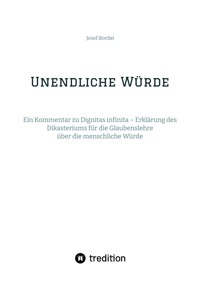
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch kommentiert der Philosoph und Theologe Josef Bordat das gehaltvolle und kontrovers diskutierte Dokument des Vatikan zur Menschenwürde: Dignitas Infinita. Dies geschieht auch im Rückgriff auf Immanuel Kant und mit Rücksicht auf die Menschenwürde in Artikel 1 Grundgesetz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Unendliche Würde
Ein Kommentar zu Dignitas infinita – Erklärung des Dikasteriums für die Glaubenslehre über die menschliche Würde
Josef Bordat
Den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb
© 2024 Josef Bordat
Verlag & Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
978-3-384-23710-1
(Paperback)
978-3-384-23711-8
(Hardcover)
978-3-384-23712-5
(e-Book)
978-3-384-23713-2
(Großdruck)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich ge-schützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektro-nische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
Im Sommer 2024 strahlt Radio Horeb meine Kommentierung der Erklärung Dignitas infinita über die menschliche Würde aus. Parallel dazu erscheint dieses Buch, gewissermaßen als „Begleitbuch“ zu den Sendungen, in denen ich mit Radio Horeb-Moderator Gregor Dornis im Gespräch bin.
Die Struktur der Erklärung wird hier übernommen, aus rechtlichen Gründen ist der Text der Erklärung jedoch nicht vollständig abgedruckt. Ich habe daraus lediglich prägnante Stellen zitiert. Zugrunde liegt dabei die deutsche Fassung, die auf der website des Vatikan zu finden ist.1 Es lohnt sich, in die Erklärung hineinzulesen, schon deshalb, um die Bezüge, die im Kommentar vorgenommen werden, nachvollziehen zu können.
Bei dem hier abgedruckten Text handelt es sich nicht um eine Transkription der Kommentare in den Sendungen. Vielmehr sind diese – obgleich inhaltlich weitgehend unverändert – sprachlich und stilistisch der Schriftform angepasst worden. Zudem gehen die Erläuterungen hier oftmals weit über das hinaus, was in den Sendungen aus Zeitgründen gesagt werden konnte.
Am 25.3.2024 wurde die Erklärung des Dikasteriums für die Glaubenslehre von Papst Franziskus approbiert, am 22.4.2024 hatte Immanuel Kant seinen 300. Geburtstag und am 23.5.2024 wurde unser Grundgesetz 75 Jahre alt. Kein Zufall also, dass dieses Buch am 24.6.2024 erschien.
Ein herzlicher Dank an Gregor Dornis für die Initiative zu dieser Sendereihe und an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb für die Geduld angesichts der doch sehr anspruchsvollen Thematik. Und: Ein Hoch auf die unendliche Würde des Menschen!
Josef Bordat
1 https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_do c_20240402_dignitas-infinita_ge.html
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
1. Einleitung
2. Eine grundlegende Klärung
3. Die zentrale Bedeutung der Menschenwürde
4. Die Kirche als Garant der Menschenwürde
5. Die Menschenwürde, Grundlage der Menschenrechte und -pflichten
6. Einige schwere Verstöße gegen die Menschenwürde
7. Schluss
Unendliche Würde
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
7.Schluss
Unendliche Würde
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
1. Einleitung
„1. Eine unendliche Würde (Dignitas infinita), die unveräußerlich in ihrem Wesen begründet ist, kommt jeder menschlichen Person zu, unabhängig von allen Umständen und in welchem Zustand oder in welcher Situation sie sich auch immer befinden mag.“
Gleich zu Beginn eine Klarstellung: Die Würde des Menschen ist unendlich, unveräußerlich und unabhängig davon, was der Mensch sonst noch ist oder hat.
Die Menschenwürde als unveräußerlich lässt sich schöpfungstheologisch und christologisch begründen. Dem Menschen – als Bild Gottes geschaffen und von Jesus Christus erlöst – kommt von daher eine Würde zu, die untrennbar mit seiner Existenz verbunden ist, die zum Sein gehört (das meint das Attribut „ontologisch“, das uns noch beschäftigen wird). Also: Die Würde ist nicht nur eine Eigenschaft, so wie der Mensch eben bestimmte Eigenschaften hat, z. B. die Fähigkeit, komplexe Werkzeuge zu gebrauchen, sondern sie ist im Kern die Beschreibung seines Wesens. Der Mensch ist nicht Mensch ohne Würde, die Würde bleibt ihm, auch wenn alles andere wegfällt, alle typischerweise dem Menschen zugeschriebenen Eigenschaften. Die Würde bleibt.
Das hat eine große praktische Bedeutung in einer Welt, in der es immer mehr Menschen gibt, die alt und gebrechlich sind, die dement sind, die schwach sind, die keine Fähigkeiten mehr haben, an denen wir sonst menschliches Verhalten ablesen können. Und diese Menschen in den Pflegeheimen und Hospizen sind mit unveräußerlicher Würde begnadet, weil sie eben als Bild Gottes geschaffen und von Jesus Christus erlöst sind, daran ändert sich ja im Alter nichts. So wird es jedenfalls von der Kirche gesehen, die diese Würde im Licht der Offenbarung bekräftigt und bestätigt, also im Licht der Bibel, in der wir von der Schöpfung der Welt, der Menschwerdung Gottes, dem Leiden und der Auferstehung Jesu erfahren.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, Menschenwürde als unveräußerlich zu begreifen, ohne auf die Offenbarung zurückgreifen zu müssen. Sonst wäre das ja auch ein Problem für die säkulare Rechtsordnung auf globaler oder nationaler Ebene. Eine elegante Möglichkeit hat uns ein großer preußischer Philosoph eröffnet, dessen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern: Immanuel Kant. Ich komme gleich auf diesen wichtigen Denker zurück (vgl. den Kommentar zu Nr. 3).
„2. Diese ontologische Würde und der einzigartige und herausragende Wert jeder Frau und jedes Mannes, die in dieser Welt existieren, wurden in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (10. Dezember 1948) von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verbindlich bekräftigt.“
Hier finden wir eine globale Rechtsordnung zitiert, deren 75. Geburtstag die Arbeit an dem vorliegenden Papier motiviert hat: die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948. Wir feiern in Deutschland in diesem Jahr 75 Jahre Grundgesetz, auch da spielt die Menschenwürde eine überragende Rolle. Also, die Kirche erkennt an, dass die Menschenwürde keine innerchristliche Anlegenheit ist, sondern mittlerweile über die Rechtsordnungen universale Geltung beansprucht. Wir werden über die Grenzen dieses Geltungsanspruchs noch intensiv nachdenken müssen (vgl. den Kommentar zu Nr. 63).
„3. Seit Beginn ihrer Sendung hat sich die Kirche, geleitet vom Evangelium, darum bemüht, die Freiheit zu bekräftigen und die Rechte aller Menschen zu fördern.“
Über ein Zitat Pauls VI. erfolgt an dieser Stelle ein Hinweis auf die Überlegenheit der christlichen Würdekonzeption gegenüber anderen Anthropologien, d. h. Menschenbildern. Das ist interessant. Wir haben einerseits die universale Geltung, andererseits die partikulare Genese. Man könnte hier – um sich Diskussionen zu ersparen – sagen, es kommt auf die Geltung an, nicht auf die Genese. Wo es herkommt, ist egal, Hauptsache, wir haben es. Das ist aber nicht ganz so einfach. Denn: Je besser ein Moral- oder Rechtsbegriff begründet ist, desto widerstandsfähiger ist er, wenn man ihn in Frage stellt. Und hier muss man genauer hinschauen.
Das ontologische Verständnis der Würde ist weit verbindlicher als ein konventionalistisches, also die Idee einer gegenseitigen Zuschreibung von Würde. Würde, die so begründet wird, ist nicht mehr voraussetzungslos. Das ontologische Verständnis der Würde ist auch verbindlicher als ein phänomenologisches Verständnis, das Würde als eine besondere Auszeichnung des Menschen begreift, zugleich aber an Bedingungen knüpft, etwa daran, ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht zu haben.
So werden dann Menschen mit und Menschen ohne Würde denkmöglich – etwas, das in den Augen der Kirche nicht sein kann. Denn dann gäbe es Menschen, die nicht von Gott geschaffen wurden, für die Gott nicht Mensch geworden ist, für die Jesus nicht ans Kreuz ging. Und das ist absurd.
Also, es geht immer etwas verloren, wenn wir von der christlichen Anthropologie abweichen und die Erfüllung von Zusatzbedingungen für die Anerkennung von Würde verlangen. Das Problem ist nur: Rechtsordnungen werden nicht von der Kirche gemacht und gelten auch nicht nur für Christen. Insofern muss man schauen, ob es ein Menschenbild gibt, das dem christlichen nahekommt, ohne auf dessen schöpfungstheologische und christologische Voraussetzungen angewiesen zu sein. Und da landen wir eben bei dem schon erwähnten Philosophen Kant. Die so genannte humanitas-Formel seines Kategorischen Imperativs fordert ebenso wie die Kirche eine unbedingte Achtung vor der Würde des Menschen: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“2. Der Mensch ist Zweck an sich selbst, er ist Selbstzweck. Das heißt umgekehrt aber auch, dass überall dort, wo der Mensch als Mittel zu einem vermeintlich höheren Zweck dient, seine Würde verletzt wird. Wir werden noch öfter auf diesen epochalen Gedanken zurückkommen.
„4. Der heilige Johannes Paul II. erklärte 1979 auf der Dritten Lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Puebla: 'Die Menschenwürde ist ein Wert im Evangelium, der nicht verachtet werden kann, ohne den Schöpfer schwer zu verletzen'3.“
Jetzt wird es konkret. Der heilige Papst Johannes Paul II. nennt einige Beispiele für eklatante Würdeverletzungen. Etwa Folter. Folter verstößt gegen die Achtung der Menschenwürde. Klar. Was aber, wenn durch Folter, also die Missachtung der Menschenwürde einer Person, nämlich der des Gefolterten, die Menschenwürde einer anderen Person geschützt werden könnte, etwa weil diese entführt wurde und nun gefunden werden muss. Wir sehen uns mit Dilemmasituationen konfrontiert, in denen wir dazu gezwungen sind, entweder die Achtung der Menschenwürde oder den Schutz der Menschenwürde aufzugeben. Beides ist ja vorrangigste Aufgabe, für Kirche wie Staat.
Nach Johannes Paul II. ist die Kirche bei der „Verteidigung oder Förderung der Menschenwürde präsent“ wie es hier heißt, Verteidigung oder Förderung; nach dem Grundgesetz (Artikel 1 Absatz 1 Satz 2) ist der Staat, also der deutsche Staat, zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde verpflichtet. Bei der so genannten „Rettungsfolter“ steht Achtung gegen Schutz und auch, worin Verteidigung bzw. Förderung besteht, ist nicht ganz klar. Diese „Rettungsfolter“ wird entsprechend heiß diskutiert. Unstreitig zwischen den Teilnehmern der Debatte ist wohl nur, dass es im Bereich der Würde des Menschen liegt, nicht gefoltert zu werden, dass es gleichfalls nicht im Bereich der Würde des Menschen liegt, in einem Kellerraum oder Erdloch zu verdursten. Genau durch diese Einsicht ergibt sich ja das konfliktträchtige „Würde gegen Würde“-Dilemma.
Es zeigt sich hier aber zugleich das grundsätzliche Problem konsequentialistischer Argumente: Kein Mensch kann in die Zukunft blicken, um zu bestätigen, dass die in Aussicht gestellten Folgen auch die tatsächlichen und alleinigen sein werden. Damit sind wir beim ethisch relevanten Unterschied zwischen „Handeln“ und „Unterlassen“, auf den Robert Spaemann hinweist: Grundsätzlich sind Unterlassungsfolgen schlechter prognostizierbar als Handlungsfolgen.4
Man kann sehr genau sagen, was mit dem Täter passiert, wenn er gefoltert (wenn also „gehandelt“) wird, nämlich, dass der Staat dessen Würde verletzt, also der Achtungsverpflichtung nicht nachkommt. Man kann aber nicht sagen, was mit dem Opfer passiert, wenn es unterlassen wird, den Täter zu foltern. Es kann sich jederzeit eine neue Lage ergeben, in der die staatliche Gewalt zum Schutz des Opfers befähigt wird, ohne gefoltert zu haben, sei es, dass der Täter „freiwillig“ einknickt und aussagt, sei es, dass sich das Opfer befreien kann oder dass es im Rahmen der „herkömmlichen“ Polizeiarbeit gefunden wird. Man kann ferner nicht sagen, was mit dem Opfer passiert, wenn der Täter gefoltert wird, denn der Erfolg der Folter des Täters mit Blick auf die Lage des Opfers ist ungewiss.
Bereits in Friedrich von Spees Cautio criminalis (1631) wird dieses Argument gegen die Folter gewendet. Spee schreibt, dass Folter schon allein aufgrund der zweifelhaften Aussichten auf Erfolg abzulehnen sei, also wegen der zum Zeitpunkt der Folter nicht beantwortbaren Frage, ob man durch sie wirklich der Wahrheit näher kommt. Spee hält Folter zwar wegen deren Grausamkeit auch für moralisch verwerflich, doch vorderhand für juristisch untauglich, weil sie in der Rechtspraxis zur fehlerhaften Beweisaufnahme führe. Folter ist für Spee zunächst und vor allem eines: ein untaugliches Beweismittel; sie ist insbesondere deshalb abzuschaffen. Auch wenn wir heute eher mit Ethik als mit Rechtspragmatik argumentieren, ergänzt diese Sicht der Frühen Neuzeit doch gut die Überlegungen zur Menschenwürde, die im Entführungsfall bzw. in der Debatte um „Rettungsfolter“ anzustellen sind.
Für die „Achtung-Schutz-Kollision“ bedeutet das zusammengefasst: Wird durch die am Entführer vollzogene Folter in jedem Fall dessen Würde missachtet, so ist die Schutzwirkung in Bezug auf das Entführungsopfer ungewiss. Sie tritt möglicherweise ein, sie tritt u. U. sogar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein, doch es ist eben nicht sicher, ob sich durch die Folter neue, verwertbare Erkenntnisse ergeben, die dem Schutz des Opfers dienen und die ohne Folter nicht zu erlangen gewesen wären. Sicher ist im Zusammenhang mit Folter nur, dass die Würde des Gefolterten verletzt wird. Deswegen ist Folter abzulehnen: als juristisch untauglich und als moralisch unzulässig. Oder, nochmal mit den Worten des heiligen Papst Johannes Paul II.: „Die Menschenwürde wird auf gesellschaftlicher und politischer Ebene mit Füßen getreten, wenn Menschen physischer oder psychischer Folter ausgesetzt sind“.
„5. Im Jahr 2010 erklärte Benedikt XVI. vor der Päpstlichen Akademie für das Leben, dass die Würde der Person 'ein grundlegendes Prinzip [ist], das der Glaube an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, immer verteidigt hat, vor allem wenn es gegenüber den geringsten und schutzlosesten Personen mißachtet wird'5.“
Weil wir noch zu Lebensrechtsfragen, die die „schutzlosesten Personen“ betreffen (Abtreibung, Sterbehilfe) kommen werden, möchte ich hier nur auf den zweiten Themenblock eingehen, den Benedikt nennt: „die Wirtschaftsund die Finanzwelt“, die auf den Menschen ausgerichtet sein muss, weil sie andernfalls seine Würde verletzt.6 Mir fällt da wieder Kants humanitas-Formel ein: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“7.
Tun wir das immer? Oder ist es nicht gerade das Prinzip der kapitalistischen „Wirtschafts- und Finanzwelt“, das Kalkül vieler Unternehmen, Menschen zu bloßen Mitteln ihrer Profitzwecke zu degradieren? Indem sie die Produktionskosten senken und unsere Billigprodukte, etwa im Bereich der Bekleidung, der Sportartikel, aber auch der Unterhaltungselektronik, in Sonderwirtschaftszonen oder Exportproduktionszonen (EPZ) fertigen lassen, etwa in Mittelamerika oder Südostasien. Dort verdienen die Menschen fast nichts und sind arbeitsrechtlich praktisch schutzlos. Es gibt keine Tarifverträge, lange Arbeitszeiten, kaum Kündigungsschutz, geringes Arbeitsentgelt und Gewalt als Strafe für schlechtes oder langsames Arbeiten. Die Entwicklungsländer in diesen Regionen machen das mit, weil sie sich Investitionen erhoffen und Devisen. Die Menschen dort machen das mit, weil sie sonst gar nichts hätten. Und das ist auch das Argument der Unternehmen, die davon profitieren: Besser eine solche Arbeit als keine Arbeit.
Wenn aber gelten soll, was Benedikt sagt: „Ziel der Wirtschafts- und Finanzwelt ist die menschliche Person und ihre volle Erfüllung in Würde“ dann kann man so zynisch nicht argumentieren. Und wenn man nochmal Kants humanitas-Formel zugrundelegt, dann zeigt sich, was Zweck und Mittel ist. Der Zweck: niedriger Preis für uns als Konsumenten bei immer noch hohem Profit für die Konzerne, das Mittel: hoher sozialer Preis für die Menschen, die als Produzenten die (Drecks-)Arbeit der Konzerne übernehmen. Hier werden Menschen verzweckt, für uns. Das ist eine Verletzung der Würde von Millionen von Menschen. Und wir sollten genau hinschauen, wer den Preis für unsere Billigprodukte bezahlt.
„6. Nach Papst Franziskus liegt 'die Quelle der Menschenwürde und Geschwisterlichkeit im Evangelium Jesu Christi'8, aber es ist auch eine Überzeugung, zu der die menschliche Vernunft durch Reflexion und Dialog gelangen kann“.
Jetzt wird es wieder theologisch, nach den politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten des Würde-Topos. Die Menschenwürde wird hier aber nicht – wie üblich – explizit schöpfungstheologisch begründet, sondern mit der Liebe Gottes und dem Evangelium Jesu Christi. Das ist interessant.
Das Wesen der Würde erkennt man, so Franziskus, wenn man in Gott den Vater sieht, „der jeden einzelnen Menschen unendlich liebt“ und damit zu entdecken, „dass er ihm ‚dadurch unendliche Würde verleiht‘“.9 Das stammt aus Evangelii gaudium und die Formulierung, dass Gott durch seine Liebe jedem Menschen „unendliche Würde verleiht“ ist einer Ansprache Johannes Pauls II. entnommen, die er 1980 in Osnabrück vor behinderten Menschen hielt. Die Liebe Gottes verleiht dem Menschen Würde, jedem Menschen.
Und „die Quelle der Menschenwürde und Geschwisterlichkeit“ liegt, so Franziskus, „im Evangelium Jesu Christi“. Zitiert wird hier Fratelli tutti. Und jetzt kommt der entscheidende Zusatz, der die Universalität des Würdekonzepts unterstreicht: Dies sei „auch eine Überzeugung, zu der die menschliche Vernunft durch Reflexion und Dialog gelangen kann“.
Also, Würde ist keine christliche Veranstaltung, auch keine judeo-christliche (nach der schöpfungstheologischen Begründung), auch keine theistische, sondern eine, die sich entweder im Glauben offenbart oder aber über Reflexion und Dialog vermitteln lässt, allein unter der Maßgabe menschlicher Vernunft. Das ist eine urkatholische Auffassung, die seit Thomas von Aquin fester Bestandteil des katholischen Denkens ist: der Glaube führt zu Gott, die Vernunft führt aber auch zu Gott. Und damit eben zur Anerkennung der „unendlichen Würde“ (Johannes Paul II.) für „jeden einzelnen Menschen“ (Franziskus).
2 I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademie-Ausg., Bd. IV, Berlin 1911, 429.
3 Johannes Paul II., Ansprache bei der 3. Generalversammlung der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz (28. Januar 1979), III.1-2, in: Insegnamenti II/1 (1979), 202-203.
4 Vgl. R. Spaemann, Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Stuttgart 2001, 218-237.
5 Benedikt XVI., Ansprache an die Teilnehmer der Vollversammlung der Päpstlichen Akad. f. d. Leben (13. Februar 2010), in: Insegnamenti VI/1 (2011), 218.
6 Benedikt XVI.: „Die Wirtschafts- und die Finanzwelt sind kein Selbstzweck, sondern nur ein Werkzeug, ein Hilfsmittel. Ihr einziges Ziel ist die menschliche Person und ihre volle Erfüllung in Würde. Dies ist das einzige Kapital, das es zu bewahren gilt.“ (Anspr. an die Mitglieder der Entwicklungsbank des Europarats, Sala Clementina (12. Juni 2010), in: Insegnamenti VI/1 (2011), 912-913.
7 Vgl. FN 2.
8 Franziskus, Enz. Fratelli tutti (3. Oktober 2020), Nr. 277, in: AAS 112 (2020), 1069.
9 Franziskus, Apost. Schreiben Evangelii gaudium (24. November 2013), Nr. 178, in: AAS 105 (2013), 1094, inneres Zitat: Johannes Paul II., Angelus mit den Behinderten in der Kathedrale von Osnabrück (16. November 1980), in: Insegnamenti III/2 (1980), 1232.
2.Eine grundlegende Klärung
„7. Obwohl inzwischen ein recht allgemeiner Konsens über die Bedeutung und auch über die normative Tragweite der Würde und des einzigartigen und transzendenten Wertes jedes Menschen besteht, birgt der Ausdruck 'Würde der menschlichen Person' oft die Gefahr, dass er viele Bedeutungen annehmen und somit zu möglichen Missverständnissen und 'Widersprüche[n führen kann], aufgrund derer wir uns fragen, ob die Gleichheit an Würde aller Menschen […] unter allen Umständen anerkannt, geachtet, geschützt und gefördert wird'10 […] Die Geschichte bezeugt, dass die Ausübung der Freiheit gegen das vom Evangelium geoffenbarte Gesetz der Liebe unermessliche Ausmaße des Bösen erreichen kann, das anderen zugefügt wird. Wenn dies geschieht, stehen wir vor Menschen, die jede Spur von Menschlichkeit, jede Spur von Würde verloren zu haben scheinen. In dieser Hinsicht hilft uns die hier eingeführte Unterscheidung, genau zwischen dem Aspekt der sittlichen Würde, die tatsächlich „verloren“ gehen kann, und dem Aspekt der ontologischen Würde, die niemals aufgehoben werden kann, zu differenzieren.“
Es gibt einen „recht allgemeinen Konsens“, der sich in globalen und regionalen Erklärungen zeigt. In der AEMR heißt es in Artikel 1: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“11 und in der KSZE-Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975 werden in einer beachtlichen Formulierung die Menschenrechte direkt aus der Menschenwürde abgeleitet: „Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten. Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie der anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, fördern und ermutigen“12.
Das ist schon was. Aber wir Deutsche haben ja noch unser Grundgesetz, das in diesem Jahr 75. Geburtstag hat. Dort heißt es in Artikel 1 Absatz 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Das ist wunderbar in dieser Klarheit. Aber auch anfällig für Kritik, gerade wegen dieser Entschiedenheit. Unantastbar? Wirklich? Jede und jeder Mensch? Immer? Geht denn das? Achten und schützen? Ist das nicht manchmal ein Widerspruch? Wir hatten ja schon über die Rettungsfolter gesprochen und sie im Ergebnis mit Friedrich Spee und Papst Johannes Paul II. verworfen (vgl. den Kommentar zu Nr. 4), aber es gibt Verfassungsrechtler, die das anders sehen.