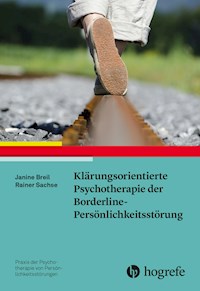
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Praxis der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Während für die Emotionsregulationsstörung der Borderline-Persönlichkeitsstörung mit der Dialektisch-behavioralen Therapie ein wirksames Behandlungskonzept vorliegt, wünschen sich viele Therapeuten Unterstützung beim Umgang mit dem typischen dysfunktionalen Interaktionsverhalten ihrer Klientinnen. Genau dies können die Konzepte der Klärungsorientierten Psychotherapie bieten. So werden in diesem Band zunächst verschiedene Dimensionen zur Konzeptualisierung der Störung vorgeschlagen und mit dazu passenden Störungsmodellen beschrieben. Anschließend wird auf die konkrete praktische Umsetzung im Therapieprozess eingegangen: Es werden Überlegungen zur Therapieplanung bei gleichzeitigem Vorliegen verschiedener Problembereiche angestellt und dargelegt, wie Methoden der Beziehungsgestaltung integriert werden können. Auch die Konfrontation mit der Spielebene und die Klärung und Bearbeitung von Schemata anhand eines mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen arbeitenden Rahmenmodells wird anschaulich beschrieben. Beispiele und Transkripte veranschaulichen das konkrete Vorgehen und runden diesen empirisch fundierten, praxisorientierten Band ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Janine Breil
Rainer Sachse
Klärungsorientierte Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Praxis der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen
Band 9
Klärungsorientierte Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Dr. Janine Breil, Prof. Dr. Rainer Sachse
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Rainer Sachse, Prof. Dr. Philipp Hammelstein, PD Dr. Thomas Langens
Dr. Janine Breil, geb. 1976. 1995–2000 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. 2001–2004 Weiterbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin. 2002–2004 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität Bochum. 2004–2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Heidelberg. 2007 Promotion. Seit 2005 Lehrtätigkeit am Institut für Psychologische Psychotherapie (IPP) Bochum und Psychologische Psychotherapeutin; aktuell als Psychotherapeutin, Dozentin und Supervisorin tätig.
Prof. Dr. Rainer Sachse, geb. 1948. 1969–1978 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 1980 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. 1985 Promotion. 1991 Habilitation. Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1998 außerplanmäßiger Professor. Leiter des Institutes für Psychologische Psychotherapie (IPP), Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Persönlichkeitsstörungen, Klärungsorientierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © matsilvan – istockphoto.com/de
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2018
© 2018 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2808-6; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2808-7)
ISBN 978-3-8017-2808-3
http://doi.org/10.1026/02808-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Charakteristika und Merkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung
1.1 Diagnosekriterien
1.2 Merkmale der Störung
1.2.1 Epidemiologie und Prävalenz
1.2.2 Verlauf und Prognose
1.3 Komorbidität
1.3.1 Komorbidität mit Achse-1-Störungen
1.3.2 Komorbidität mit Achse-2-Störungen
1.4 Biographie
1.5 Therapeutische Probleme und Herausforderungen
2 Weitergehende Beschreibung der Borderline-Persönlichkeitsstörung
2.1 Heterogenität der Borderline-Persönlichkeitsstörung
2.2 Verschiedene Problemfelder der Borderline-Persönlichkeitsstörung
2.2.1 Borderline-Persönlichkeitsstörung: Achse-1- oder Achse-2-Störung?
2.2.2 Dimensionale versus kategoriale Diagnostik
3 Problemfeld: Emotionsregulationsstörung
3.1 Beschreibung des Problemfelds
3.2 Neurobehaviorales Störungsmodell
3.3 Therapie der Emotionsregulationsstörung
4 Problemfeld: Schwierigkeiten in Beziehungen
5 Das Verhältnis der Problemfelder zueinander
6 Störungsmodell für das Problemfeld Schwierigkeiten in Beziehungen
6.1 Allgemeine Beschreibung des Modells
6.2 Konkretisierung des Modells für die reinen Persönlichkeitsstörungen
6.3 Konkretisierung des Modells für die Borderline-Persönlichkeitsstörung
6.3.1 Motivebene bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
6.3.2 Schemaebene bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
6.3.3 Spielebene bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
6.3.4 Kombination verschiedener Persönlichkeitsanteile und Konflikthaftigkeit
7 Therapie
7.1 Voraussetzungen auf Seiten des Therapeuten
7.2 Schlussfolgerungen aus dem Modell der doppelten Handlungsregulation für die Therapie
7.3 Ablauf und Phasen der Therapie der Beziehungsstörung bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
8 Beziehungsaufbau
8.1 Basisvariablen und Validierung
8.1.1 Realisierung der Basisvariablen
8.1.2 Validierung und empathisches Verstehen
8.2 Komplementarität zur Motivebene
8.2.1 Komplementarität zu den sechs Beziehungsmotiven und zu dem jeweils aktivierten Modus
8.2.2 Kombinierte Komplementarität
8.2.3 Weitere Aspekte bei der Beziehungsgestaltung mit Klientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung
8.3 Nicht-Komplementarität zur Spielebene
8.4 Umgang mit Images und Appellen
8.5 Umgang mit Beziehungstests
8.5.1 Allgemeines zum Umgang mit Beziehungstests
8.5.2 Spezifischer Umgang mit den verschiedenen Testarten
8.6 Explizierung der Beziehungsmotive
8.7 Die Beziehung zum Inhalt der Therapie machen
9 Diagnostik und Therapieplanung
9.1 Mögliche Problembereiche und Modellbildung durch den Therapeuten
9.2 Probleme bei der Diagnostik und Besprechung der Diagnose
9.3 Ablauf der Behandlung
9.3.1 Problembereiche im Rahmen der Borderline-Persönlichkeitsstörung
9.3.2 Komorbide psychische Störungen
10 Konfrontation mit der Spielebene
10.1 Inhalt der Konfrontation
10.2 Zeitpunkt für die Konfrontation
10.3 Grund für die Konfrontation
10.4 Kombination mit Ressourcenaktivierung und Lösungsorientierung
11 Schemaklärung und -bearbeitung
11.1 Klärung von Schemata und ihre Bearbeitung – allgemein
11.1.1 Schemaklärung
11.1.2 Klärung der biographischen Entstehung
11.1.3 Schemabearbeitung
11.2 Klärung von Schemata und ihre Bearbeitung bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
11.2.1 Spezifische Aspekte der Schemaklärung
11.2.2 Spezifische Aspekte der Klärung der biographischen Entstehung
11.2.3 Spezifische Aspekte der Schemabearbeitung und Ressourcenaktivierung
12 Das kombinierte therapeutische Vorgehen
12.1 Mögliche Anteile in der Klientin
12.2 Identifikation der verschiedenen Anteile
12.3 Achtsamkeit entwickeln
12.4 Aktivierung und Aufbau von Ressourcen
12.5 Umgang mit den verschiedenen Anteilen
12.5.1 Umgang mit verletzten kindlichen Anteilen
12.5.2 Umgang mit abwertenden Anteilen
12.5.3 Umgang mit Bewältigungsteilen
12.6 Verhaltensänderung
13 Umgang mit manipulativen Aspekten von Selbstverletzungen
13.1 Direkter Umgang innerhalb der therapeutischen Beziehung
13.2 Inhaltliche Arbeit an manipulativen Aspekten von Selbstverletzungen
14 Umgang mit manipulativer Suizidalität
14.1 Umgang mit manipulativen Aspekten in der Therapie
14.1.1 Intention auf Beziehungsebene
14.1.2 Konkrete Forderungen
14.1.3 Mischform aus authentischer und manipulativer Suizidalität
14.2 Inhaltliche therapeutische Arbeit an manipulativen Aspekten
14.3 Fehlende Verantwortungsübernahme
15 Erneute Traumatisierung
15.1 Gründe für eine (erneute) Traumatisierung
15.2 Umgang mit dem Thema Reviktimisierung in der Therapie
16 Transkripte zur Illustration von Therapie
16.1 Beziehungsaufbau und Herausarbeiten von Problembereichen
16.2 Herausarbeiten der kompensatorischen Strategien und ihrer Funktion
Literatur
Anhang
|1|Vorwort
Während die Borderline-Persönlichkeitsstörung lange als kaum behandelbar galt, wurden in den letzten Jahren zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, um die Störung besser zu verstehen, und es wurden Therapieverfahren entwickelt, deren Effektivität nachgewiesen ist.
Andererseits zeigen die hohe Anzahl und Dauer stationärer und ambulanter Behandlungen, die beträchtlichen Abbruchquoten, der ungünstige Krankheitsverlauf und die hohe Suizidrate, wie schwierig es ist, einen Therapieerfolg zu erreichen, und dass Therapien häufig nicht mit einem optimalen Ergebnis abgeschlossen werden können (Arntz, Klokman & Sieswerda, 2005).
Dass es immer noch einen Teil der Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt, der nicht bzw. nicht gut auf die Behandlung anspricht, ist insofern nicht verwunderlich, da es sich um eine insgesamt sehr heterogene Patientengruppe handelt, die möglicherweise unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen erforderlich macht und von den Therapeuten ein breites Wissen erfordert. Auch Steinert, Streib, Uhlmann und Tschöke (2014) kommen zu dem Schluss, dass bei einem sehr heterogenen Störungsbild patientenorientierte und schulenübergreifende Therapieformen notwendig sind.
Entsprechend ist anzunehmen, dass es auch in Zukunft eine Herausforderung für die Psychotherapieforschung sein wird, die Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung weiter zu verbessern.
In diesem Buch stellen wir unsere Ideen zum Verständnis und zur Therapie dieser Störung vor und zur Diskussion. Hierbei sehen wir unseren Ansatz nicht als eigenständige Therapieform, sondern eher als Ergänzung zu anderen bestehenden Ansätzen. An den Stellen, an denen wir bereits Vorschläge zur Integration mit anderen therapeutischen Vorgehensweisen wie z. B. der DBT oder der Schematherapie haben, gehen wir darauf ein. Es ist aber auch eine Kombination mit anderen Verfahren denkbar (Breil & Sachse, 2011), wie sie sich z. B. in Turners dynamic-cognitive-behavior-therapy findet (Turner, 1987; 1989; 1993; 1994).
Im ersten Teil dieses Buches (Kapitel 1 – 6), in dem es um die Beschreibung des Störungsbildes geht, wird dargestellt, warum anzunehmen ist, dass der Borderline-Persönlichkeitsstörung verschiedene Dimensionen zugrunde liegen. Es werden zwei Dimensionen beschrieben, ohne dass dieses Modell Anspruch auf Vollständigkeit hat. Während die Dialektisch-behaviorale Therapie ein vertieftes Verständnis der ersten Dimension der Emotionsregulationsstörung und entsprechende Behandlungsstrategien entwickelt hat (Kapitel 3), kann die zweite Dimension als Beziehungsstörung gesehen werden, welche im Folgenden schwerpunktmäßig dargestellt wird. Nach der Beschreibung eines entsprechenden Störungsmodells wird im zweiten Teil des Buches (ab Kapitel 7) auf Aspekte der Therapie dieser Dimension eingegangen.
|2|Ähnlich anderen therapeutischen Vorgehensweisen, die sich in dem Fokus auf die Beziehungsgestaltung mit Etablierung eines Gleichgewichts zwischen Sicherheit (Containing, Validieren) und konfrontativen Interventionen gleichen (Steinert et al, 2014), werden wir – wie wir es für eine Störung, die sich aufgrund ihrer Problematik direkt im Therapieprozess manifestiert, für notwendig erachten – ebenfalls ausführlich auf die Etablierung einer tragfähigen therapeutischen Allianz eingehen. Im nächsten Schritt werden dann inhaltliche therapeutische Strategien für die unterschiedlichen Problembereiche der Störung vorgestellt.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch auf die Verwendung jeweils beider Geschlechter verzichtet. Da in klinischen Stichproben mehr weibliche als männliche Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung zu finden sind, haben wir uns für die weibliche Variante entschieden. Bei den behandelnden Personen wird im Sinne eines generischen Maskulinums die männliche Form verwendet. Gemeint sind aber immer beide Geschlechter.
|3|1 Charakteristika und Merkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung
In diesem Kapitel geht es um eine Beschreibung des Störungsbildes der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Neben den Kriterien der aktuell gültigen Klassifikationssysteme wird auf weitere Merkmale der Störung wie die Epidemiologie und auf die Komorbidität eingegangen. Des Weiteren werden für die Borderline-Persönlichkeitsstörung typische Aspekte der Biographie vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Schilderung der Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen sich Therapeuten bei der Behandlung von Menschen mit Borderline-Störung möglicherweise stellen müssen.
1.1 Diagnosekriterien
Um sich dem Störungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung anzunähern, ist eine Betrachtung der Diagnosekriterien aus den kategorialen Diagnosesystemen sinnvoll. Interessanterweise unterscheiden sich ICD 10 (Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2006) und DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) im Falle der Borderline-Persönlichkeitsstörung sowohl in der Namensgebung als auch in Bezug auf die deskriptiven Kriterien und legen damit unterschiedliche Schwerpunkte bei der Diagnosestellung. Hierdurch wird bereits die Heterogenität im Störungsbild deutlich und eine Betrachtung beider Systeme erscheint sinnvoll.
Beiden Diagnosesystemen gemeinsam ist, dass die allgemeinen Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung erfüllt sein müssen: Die von den Erwartungen der soziokulturellen Umgebung abweichenden, überdauernden Erlebens- und Verhaltensmuster sollten sich in mindestens zwei Bereichen von Kognition, Affektivität, Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen und Impulskontrolle manifestieren, unflexibel und tiefgreifend in einem weiten Bereich persönlicher und sozialer Situationen auftreten (Kriterium A), zu Leiden und Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen (Kriterium B) und stabil und langandauernd mit Beginn in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter sein (Kriterium C). Zudem gehen die Muster nicht auf eine andere psychische Störung (Kriterium D) oder auf eine Substanz bzw. einen medizinischen Krankheitsfaktor zurück (Kriterium E).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























