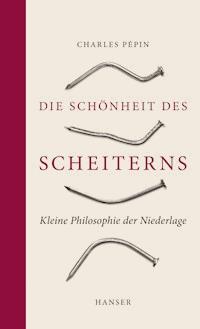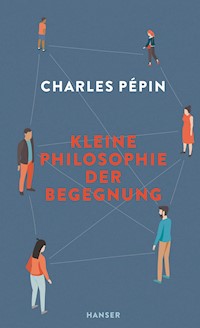
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gesundheit, Kreativität, persönliches Glück – Charles Pépin zeigt: Wir müssen anderen begegnen, um uns selbst zu begegnen. Begegnungen verändern uns, indem sie uns mit dem Anderen konfrontieren, schreibt Charles Pépin. Nachdem uns die Pandemie auf Abstand gezwungen hat, geht der Philosoph der Frage nach, was freundschaftliche, romantische, professionelle und zufällige Begegnungen für den Einzelnen bedeuten. Er zeigt: Jeder zwischenmenschliche Kontakt ist auch eine Begegnung mit der Welt und mit uns selbst. Mit vielen Beispielen aus dem täglichen Leben verortet Pépin diese These in der Philosophiegeschichte, spannt einen Bogen von Aristoteles über Hegel bis Jean-Paul Sartre und lässt auch unterhaltsame Seitenpfade zu David Bowie und Lou Reed nicht aus. Über allem steht die Erkenntnis: Leben heißt auch lernen, anderen wirklich zu begegnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Begegnungen verändern uns, indem sie uns mit dem Anderen konfrontieren, schreibt Charles Pépin. Nachdem uns die Pandemie auf Abstand gezwungen hat, geht der Philosoph der Frage nach, was freundschaftliche, romantische, professionelle und zufällige Begegnungen für den Einzelnen bedeuten. Er zeigt: Jeder zwischenmenschliche Kontakt ist auch eine Begegnung mit der Welt und mit uns selbst. Mit vielen Beispielen aus dem täglichen Leben verortet Pépin diese These in der Philosophiegeschichte, spannt einen Bogen von Aristoteles über Hegel bis Jean-Paul Sartre und lässt auch unterhaltsame Seitenpfade zu David Bowie und Lou Reed nicht aus. Über allem steht die Erkenntnis: Leben heißt auch lernen, anderen wirklich zu begegnen.
Charles Pépin
Kleine Philosophie der Begegnung
Aus dem Französischen von Caroline Gutberlet
Hanser
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Charles Pépin
Impressum
Inhalt
Einleitung
Teil 1
: Die Zeichen der Begegnung
Ich bin verwirrt
Ich erkenne dich wieder
Ich bin neugierig auf dich
Ich möchte es wagen
Ich entdecke deine Sichtweise
Ich habe mich verändert
Ich fühle mich für dich verantwortlich
Ich bin am Leben
Teil 2
: Die Bedingungen von Begegnung
Die eigenen vier Wände verlassen
Ohne konkrete Erwartungen
Die Maske fällt
Teil 3
: Das wirkliche Leben ist Begegnung
Begegnung als etwas spezifisch Menschliches?
Ich begegne dir, also bin ich
Begegnung mit dem Mysterium
Begegnung mit dem eigenen Begehren
Dem Anderen begegnen, um sich selbst zu begegnen
Schluss
Die Werke, die dieses Buch gemacht haben
Teil 1 Die Zeichen der Begegnung
Teil 2 Die Bedingungen von Begegnung
Teil 3 Das wirkliche Leben ist Begegnung
Personenregister
Für Émilie
Einleitung
Verliebte, die ihr Glück kaum fassen können, lassen manchmal den Film ihrer Begegnung Revue passieren — voller Rührung und zugleich mit einem Schauder. Eine Nichtigkeit hätte gereicht, eine andere Zugverbindung oder ein anderer Sitzplatz im Abteil, und ihre Wege hätten sich wohl niemals gekreuzt.
Bei genauerer Betrachtung wird allerdings bald deutlich, dass ihre Begegnung sich nicht nur einem glücklichen Zufall verdankt. Diese beiden Sitzplätze nebeneinander haben ihnen lediglich eine Gelegenheit geboten; sie hat es gewagt, ein Gespräch anzufangen, und er hat sich auf das Unvorhergesehene eingelassen, eine Frau, die auf den ersten Blick gar nicht sein Typ ist. Zwei Fremde haben einen Austausch zugelassen und die Begegnung hat stattgefunden.
Dieser Mann und diese Frau an Bord eines mit dreihundert Stundenkilometern dahinrasenden TGV hätten genauso gut einander niemals finden können. Zwei Menschen in rasender Fahrt auf parallelen Umlaufbahnen: sie eine Führungskraft mit geradlinigem Werdegang, er ein Osteopath mit ansehnlicher Kundschaft. Es hatten nur einige wenige auslösende Momente zusammenkommen müssen, um sie von ihrem Weg abkommen zu lassen und den Zauber in Gang zu setzen. Vielleicht hat sie seine Nervosität bemerkt? Bevor er in den Zug stieg, hatte er einen Anruf vom Psychiater seines Sohnes erhalten, und als ihn seine Sitznachbarin darauf ansprach, hat er seine Sorge nicht vor ihr zu verbergen versucht. Er hat die Maske fallen lassen. Im Gegenzug hat sie diesem Unbekannten gegenüber mehr von sich preisgegeben, als sie es für möglich gehalten hätte. Sie haben miteinander gesprochen, ohne sich zu verstellen, ohne ihre Rolle zu spielen.
Diese Begegnung, die das Werk des Zufalls zu sein scheint, wurde somit durch die Haltung dieser beiden Menschen ermöglicht. Das Gleiche gilt für Begegnungen auf der Freundschaftsebene oder im Arbeitsumfeld: Der Zufall ist lediglich der Ausgangspunkt und entscheidet nicht über unser Schicksal, sondern wir führen ihn vielmehr herbei. Ich habe dieses Buch geschrieben, um zu zeigen, dass wir den Zufall zu unserem Verbündeten machen und uns darauf vorbereiten können, uns auf das Unvorhergesehene einzulassen. Ob in einem Zug oder in einem Supermarkt, auf einer Abendveranstaltung oder im Büro, auf einer Dating-Plattform oder in einem öffentlichen Park.
Das setzt allerdings voraus, dass wir uns über den Mechanismus und die Kraft von Begegnung im Klaren sein müssen und die Bedeutung des Handelns, der Bereitschaft und der Verletzlichkeit verstehen.
Dazu werden wir die großen Denker des 20. Jahrhunderts befragen, die in der Nachfolge Hegels die Beziehung zum Anderen und die fundamentalen Bindungen, die sich zwischen zwei Wesen knüpfen können, untersucht haben. Sigmund Freud, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Jean-Paul Sartre, Simone Weil und Alain Badiou werden bei der Skizzierung einer Philosophie der Begegnung Pate stehen. Und Romanschriftsteller, Dramatiker, Maler, Filmregisseure, die schöne Begegnungen in Szene gesetzt haben — Marivaux in seinem Stück Das Spiel von Liebe und Zufall, Louis Aragon in seinem Roman Aurélien oder Albert Cohen in Die Schöne des Herrn, Clint Eastwood in Die Brücken am Fluß oder Abdellatif Kechiche in seinem Film Blau ist eine warme Farbe —, werden diesem Denken Gestalt verleihen.
Für eine zusätzliche Erhellung werden wir auch solche Werke hinzuziehen, die selbst die Frucht einer entscheidenden Begegnung gewesen sind und uns daran erinnern, dass sogar die größten Genies auf andere Menschen angewiesen sind. Wer weiß schon, dass Pablo Picasso sein Bild Guernica nicht gemalt hätte, wenn sich seine Wege mit denen des Lyrikers Paul Éluard nicht gekreuzt hätten und er nicht in Freundschaft zu ihm entbrannt wäre? Oder wie viel Albert Camus’Mensch in der Revolte der Leidenschaft des Schriftstellers für die Schauspielerin Maria Casarès verdankt? Oder wie sehr Voltaire und Émilie du Châtelet sich gegenseitig inspiriert haben, als sie Candide oder der Optimismus und die Rede vom Glück verfassten? Und dass der Song Perfect Day von Lou Reed ohne ein Abendessen mit David Bowie in New York nicht entstanden wäre?
Wenn wir die Bedeutung von Begegnung ermessen, richten wir einen anderen Blick auf die Werke, die uns Nahrung geben, ja einen anderen Blick auf unser Leben. Wir sind abhängig von anderen Menschen. Begegnungen sind keine schmückende Beigabe, keine zusätzliche Alternative, sondern sie sind wesentlich und modellieren unsere Persönlichkeit. Begegnungen stehen im Mittelpunkt des Abenteuers unseres Daseins. Wie wir sehen werden, wohnt der Begegnung die Kraft inne, uns Liebe und Freundschaft entdecken zu lassen, uns zum Erfolg zu führen, ja mehr noch, uns selbst zu offenbaren und uns der Welt zu öffnen. Darin besteht ihre Kraft und ihr Mysterium: Ich brauche den Anderen, ich muss dem Anderen begegnen, um mir selbst zu begegnen. Ich muss anderen begegnen, um ich selbst zu werden.
Teil 1
Die Zeichen der Begegnung
Ich bin verwirrt
Wenn mein Panzer Risse bekommt
Jemandem zu begegnen, bedeutet, überrumpelt und aus der Fassung gebracht zu werden. Es geht etwas vor sich, das wir uns nicht ausgesucht haben, das uns unerwartet trifft: Es ist der Schock der Begegnung. Im Wort »Begegnung« steckt das Wörtchen »gegen« und bringt zum Ausdruck, dass wir auf unserem Weg auf jemanden stoßen. Somit verweist es auf eine Kollision mit der Andersheit: Zwei Wesen kommen in Kontakt, stoßen aufeinander und sehen ihre Bahnen einen anderen Lauf nehmen. Ein singuläres Wesen kann aber auch sehr wohl einem anderen über den Weg laufen, ohne in Verwirrung zu geraten, was beweist, dass es nicht zu einer Begegnung gekommen ist, sondern dass sie sich lediglich gekreuzt haben. Nichts ist erstaunlicher, zuweilen unangenehmer, schwieriger zu fassen als die Differenz des Anderen. Wie könnte ich durch die Begegnung mit dir nicht erschüttert sein, wo du dich mir doch gerade deswegen entziehst, weil du anders bist, weil du eine andere Geschichte hast, weil du die Dinge anders siehst und anders empfindest? Wenn ich ungerührt bleibe, lässt das nur den Rückschluss zu, dass ich dich kaum wahrgenommen habe oder dass du lediglich eine Projektionsfläche für mich gewesen bist, in der ich mich gespiegelt habe.
Auslöser der Verwirrung ist häufig ein visueller Schock. Als Anna Karenina den Grafen Alexej Wronskij in einem Bahnhof erblickt, weiß sie noch nichts über ihn, doch jäh überkommt sie Verwirrung und schon sticht er aus der Menge heraus. Was ist es, das sie derart berührt? Die Erscheinung des Anderen, dessen Stärke und Einzigartigkeit sie erahnt? Jene Regung, jene Anwandlung, die sie in sich verspürt und auf die nichts und niemand sie vorbereitet hat? Diese Verwirrung ruft zuweilen mehrere Sinne auf den Plan, etwa wenn wir einen Menschen nicht zu kennen meinen, bis wir verwundert die unbeschreibliche Sanftheit seiner Haut entdecken und spüren, wie er auf unsere Zärtlichkeiten, Küsse, Worte reagiert. In der Liebesverwirrung gibt es gewisse untrügliche Anzeichen, die darauf hindeuten, wie unvorbereitet uns diese Regung trifft: Beschleunigung des Herzschlags, stockende Stimme, trockener Mund, Schweiß, Verstummen … Angesichts dieser Beschleunigungskraft des Lebens reagiert unser Körper so, als bräuchte er — unfähig, sich auf den neuen Rhythmus einzustellen — eine Eingewöhnungszeit. Manchmal ist es zuerst die Klangfarbe einer Stimme, die uns berührt, unsere Neugier weckt, tief vergrabene Erinnerungen in uns wachruft, wie eine Stimme aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, die uns ruft. Als Christian Bobin zum ersten Mal die Stimme von Pierre Soulages am Telefon hörte, wusste er, noch bevor er ihn leibhaftig gesehen hatte, mit absoluter Gewissheit, dass er ihm begegnet war. Er schildert diesen Moment in dem Buch Pierre, das er ihrer Freundschaft gewidmet hat: »in Soulages’ Stimme schwang eine Vergnügtheit, ein Staunen über dich und über sich«. Manchmal findet diese Erschütterung auf einer intellektuelleren Ebene statt. Pablo Picasso war völlig gleichgültig gegenüber Politik und seine Wege kreuzten sich seit Jahren mit denen von Paul Éluard, ohne dass etwas geschah, bis dieser ihm eines Tages im Jahr 1934 von seinem pazifistischen Engagement erzählte. Da öffnete er sich für eine politische Sicht auf die Welt. Genau in diesem Moment begegnete er dem Dichter. Manchmal trifft der andere uns mitten ins Herz, etwa wie bei einem der legendärsten Tandems des Indie-Rock der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre: Die Begegnung zwischen David Bowie und Iggy Pop fand nicht vor dem Hintergrund ihrer musikalischen Verbundenheit statt, sondern es waren vor allem die Notlage des Junkies und die Einsamkeit des »Iguana«, für die Bowie sensibel war.
Egal, welche Form die Verwirrung annimmt, die von einem leisen Empfinden bis zum Schwindelgefühl reicht, sie ist Ausdruck dafür, wie sehr das Leben uns überraschen kann: Spätestens jetzt müssen wir erkennen, dass wir nicht alles im Griff haben. Zwei singuläre Wesen haben sich, jenseits zweier Welten, gerade aneinander gerieben. Wir wissen noch nicht, was daraus wird (die Begegnung mit Éluard wird Picassos Schaffenskraft neu anfachen, Anna Karenina wird schließlich daran zugrunde gehen), Tatsache aber ist: Es hat stattgefunden. Sollten wir die Illusion hegen, selbstgenügsame, autonome Monaden zu sein, die sich in ihrer Identität und in ihren Gewohnheiten gemütlich eingerichtet haben, dann ist es mit der Ruhe plötzlich vorbei. Die Komfortzone ist gestört. Wir spüren Sehnsucht nach etwas anderem, was berückend und beängstigend zugleich ist. Unsere Verwirrung führt uns gleichzeitig zum Anderen, der uns in Staunen versetzt, und zu jenem Teil unserer selbst, der sich uns entzieht. Als Picasso Éluard begegnete, war er von dem Idealismus des Dichters genauso überrascht wie von der Resonanz, die er bei ihm fand. Im Zustand der Sinnesverwirrung, ausgestreckt in den durchwühlten Laken, sind wir vom Anderen, seiner Schönheit, seiner Lust ebenso überrascht wie von dem, was wir in uns hochsteigen fühlen (und das manchmal wirklich erstaunlich ist). Genau genommen verhält es sich so, als fänden zwei Begegnungen gleichzeitig statt: die mit der Andersheit des Anderen und die mit der Andersheit in uns. »Ich ist ein anderer«, schrieb Rimbaud in einem Brief an Paul Demeny vom 15. Mai 1871. Wir müssen mitunter dem Anderen begegnen, um dieses Ich zu verstehen und endlich zu fühlen. Dem Anderen im Anderen begegnen, um zu entdecken, dass es einen Anderen in unserem Selbst gibt, und gewahr werden, dass dieser Andere in unserem Selbst vielleicht mehr er selbst ist, als wir geglaubt haben. Hier sind wir meilenweit vom heuchlerischen Satz »es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen« entfernt, den wir manchmal von uns geben, um eine Verabredung zu verkürzen, die umso langweiliger war, als sie nicht die geringste Verwirrung in uns ausgelöst hat.
Clint Eastwood hat die Entstehung und die Kraft dieser Verwirrung in seiner filmischen Adaption des Romans Die Brücken am Fluß von Robert James Waller in Szene gesetzt. Meryl Streep spielt eine ursprünglich aus Süditalien stammende Hausfrau, die seit Jahrzehnten mit ihrem Mann und den beiden nunmehr halbwüchsigen Kindern auf einer Farm in Iowa lebt. Als ihr Mann mit den Kindern für vier Tage zu einer Rinderschau fährt und sie allein auf der Farm zurückbleibt, lernt sie Robert kennen, der als Fotograf des National Geographic für eine Reportage über die »überdachten« Brücken von Iowa unterwegs ist, jene bemalten Holzkonstruktionen, die für diese Gegend so typisch sind. Gemeinsam durchleben sie eine Leidenschaft, die ihr Leben verändern wird. Nach diesen vier Tagen — ein verrücktes Intermezzo, in dem sich ein ganzes Leben zu verdichten scheint — und einem herzzerreißenden Moment des Zögerns fasst Francesca den Entschluss, ihren Mann nicht zu verlassen, und lässt Robert allein weiterfahren. Doch was sie miteinander geteilt haben, wird sie für immer begleiten, ihrem Farmleben aus einer »Summe von Kleinigkeiten« Tag für Tag Nahrung geben, dem Alltag als Hausfrau, die ihrem Mann Zuwendung und Achtung entgegenbringt, weit von der intensiven Liebe für Robert entfernt, den sie wie einen Schatz hütet — ein Abenteuer auf Augenhöhe mit den Jugendträumen, die sie begrub, als sie sich in Iowa niederließ. In ihrem Testament wird sie verfügen, dass ihre Asche an derselben Stelle gestreut werden soll wie die von Robert, von der Brücke, die die Ursache ihrer Begegnung war.
Mitten in diesen vier Tagen, die sie mit Reden und Lachen, Spazieren und Biertrinken, Baden und Lieben verbringen, offenbart sich die Essenz von Begegnung in einer Bemerkung Francescas, die den Zustand der Verwirrung, in dem sie sich befindet, zum Ausdruck bringt: »Ich erkenne mich selbst nicht wieder, ich bin nicht mehr ich selbst … und gleichzeitig war ich noch nie so sehr ich selbst wie jetzt.« Hier ist die Verwirrung reines Schwindelgefühl. Was sie tut, sieht ihr — auf den ersten Blick — nicht ähnlich. Sie möchte nicht im Entferntesten den Ehemann hintergehen, dem sie nichts vorzuwerfen hat, doch an dessen Seite sie eingeht, sie immer weniger gegenwärtig für sich selbst ist, sie in der endlosen Wiederholung der alltäglichen Verrichtungen immer mehr verkümmert. Die Begegnung mit Robert ist viel intensiver; sie vermag sich gegen die Woge, die sie plötzlich erfasst, nicht zu wehren: ihre italienische Jugend, ihr Humor, ihre Weiblichkeit, die Lebenskraft an sich in ihr. Alles, was sie von sich selbst vergessen hatte, was durch die Schwere der Tage und dieses »Lebens voller Kleinigkeiten« überdeckt wurde, ist plötzlich wieder da, stärker denn je, weil sie jemandem begegnet ist, weil die Augen dieses Mannes auf ihr ruhen und alles in ihr entfachen. Dieser Fotograf, der sich verfahren hatte, hat sie nach dem Weg gefragt, und nun findet sie ihren eigenen Weg wieder. Gewiss, sie wird darauf verzichten, alles für ihn aufzugeben, ihre Kinder zurückzulassen, ihrem Mann eine Demütigung zuzufügen, von der er sich nicht erholen würde. Sie leben auf einer Farm, die seit über hundert Jahren im Besitz der Familie ihres Mannes ist, mitten auf dem Land, wo niemandem etwas verborgen bleibt, in einem puritanischen Landstrich, wo der geringste Ehebruch jahrzehntelanges Gerede und Gebrandmarktsein nach sich zieht. Wir dürfen sie also nicht dafür verurteilen, dass sie einer Liebe den Rücken zukehrt, von der Robert sagt: »Glaubst du, dass das vielen Leuten passiert, was mit uns passiert?« Wie der Film uns zu verstehen geben möchte, bleibt sie Robert letztlich treu und währt die Begegnung durch ihre andauernde Liebe, durch diese neue Dimension ihrer selbst, die sie entdeckt hat, fort. Eine solche Liebe schien ihr unmöglich, aber paradoxerweise hat gerade diese Liebe — und damit einhergehend ihr neues Innenleben, von dem sie zehrt — es ihr erlaubt, die Ehefrau eines aufrichtigen Mannes zu bleiben, dem allerdings das Wesentliche fehlt. Dank der Begegnung mit Robert, mitten in der Verwirrung dieser Begegnung, hat sie sich als eine andere entdeckt, und genau diese andere, die wirklich sie selbst wurde, wird sie bis an ihr Lebensende begleiten. Sie hat dieses zeitlose Intermezzo riskiert, diese vier ewigen Tage, und fand zu der italienischen Liebenden in ihrem Innersten zurück. Jetzt weiß sie, dass Träume Gestalt annehmen können, dass es tiefe Freude und höhere Gemeinschaft auf dieser Erde gibt, eine erhabene Hegemonie des Herzens — und nicht nur die Dinge, die getan werden müssen.
In seinem Gedichtband La Parole en archipel schreibt René Char: »Wir müssen uns außerhalb unserer selbst einrichten, am Rand der Tränen und im Orbit des Hungers, wenn wir wollen, dass etwas Außergewöhnliches geschehe, das nur für uns bestimmt war.« Das ist eine schöne Definition der Verwirrung durch Begegnung. Auch wenn sie für Robert nicht alles hat stehen und liegen lassen, so hat Francesca doch etwas getan: Sie hat sich in den vier Tagen »außerhalb ihrer selbst« eingerichtet, außerhalb ihrer im Leben als Hausfrau erstarrten Identität. Sie hat Tränen in Kauf genommen und es ist tatsächlich »etwas Außergewöhnliches« geschehen, das nur für ihn und für sie bestimmt war, eine Kollision, deren Wellen sich bis zu ihrer beider Tod ausbreiten werden und die eine große Ähnlichkeit mit dem plötzlichen Anbruch des wirklichen Lebens hat.
Der Panzer, der in der Verwirrung der Begegnung Risse bekommt, ist meist unser sozialer Panzer. Das tiefere Ich ist vielschichtig, wandelbar und zu großen Teilen rätselhaft, dagegen ist das soziale Ich einfacher gestrickt und starrer. Es ist notwendig, aber simplifizierend. Dieses Ich taucht auf unserem Personalausweis auf oder wenn wir uns mit unserem Beruf vorstellen und ein Gespräch mit den Worten beginnen: »Und was machst du im Leben?« Das ist kein guter Einstieg, denn er birgt die Gefahr, dass wir den anderen auf seinen Beruf und den damit verbundenen Status reduzieren. Wir wollen dies den Stempel des Sozialen nennen: Er sitzt uns auf der Pelle, beschneidet unsere Freiheit und schmälert unsere Fähigkeit zur Offenheit für andere und manchmal für uns selbst. Dieser Stempel des Sozialen beeinträchtigt unsere Bewegungsfreiheit, trübt unser Urteilsvermögen und kappt unsere Neugier. Wie viele Frauen und Männer verdammen sich zur Einsamkeit, weil sie es nicht vermocht haben, diesen Stempel des Sozialen abzuschütteln? Der Andere hat sich vor ihnen präsentiert, vielleicht mit der Möglichkeit einer Beziehung, aber sie haben ihn nicht gesehen, noch nicht einmal »ins Auge gefasst«: Sie haben es sich nicht gestattet, ihn zu bemerken, haben die Tür für die Möglichkeit der Verwirrung verschlossen gehalten, weil dieser Andere ihren sozialen Kriterien nicht entsprach, nicht in die richtige Schublade passte. Glücklicherweise gibt es Begegnungen, die uns dem Stempel des Sozialen entreißen und eine Kollision herbeiführen, die Risse in unseren Panzer treibt. Begegnung hat dann die Kraft, einen Spielraum im sozialen »Ich« zu schaffen: Sie lässt einen Hauch von Freiheit über einer erstarrten Identität wehen.
»Komm, ich nehme dich mit«
Dieser Hauch von Freiheit weht auch in der Komödie Das Spiel von Liebe und Zufall von Marivaux, der die Begegnung von Silvia und Dorante in Szene setzt, deren Heirat die Familien arrangiert haben. Silvia, die Dorante versprochen worden ist, erhält von ihrem Vater die Erlaubnis, ihren Zukünftigen ein erstes Mal zu treffen, wobei sie sich als ihre eigene Dienerin verkleidet, um ihn in aller Ruhe unerkannt beobachten zu können. Dorante wiederum hat genau denselben Einfall: Er schlüpft in die Kleider seines Dieners, um sich vor Silvia zu präsentieren. Doch der Zauber wirkt trotz der Verkleidung: Sie verlieben sich ineinander. Die Verwirrung stellt sich unversehens ein, allem Schein zum Trotz. Das ist die Kraft von Begegnung: Sie vermag Erwartungen zu vereiteln, Prognosen zu durchkreuzen, die Karten neu zu mischen. Silvia erwartet, den Auserwählten besser kennenzulernen, doch nun weckt ein anderer ihre Neugier, den sie für dessen Diener hält. Dorante geht es genauso, er horcht die Dienerin über ihre Herrin aus, aber er muss sich der Tatsache stellen, dass es die Dienerin ist, die ihm gefällt. Während Dorante mit ihr spricht, wird Silvia ihrer Verwirrung gewahr und spricht zu sich selbst: »Fast glaube ich, er amüsiert mich …«. Und als er zugibt: »ich wollte selbst über etwas anderes mit dir reden, aber ich weiß nicht mehr, worüber«, gesteht auch sie ein: »Ich hatte dir auch etwas zu sagen; aber du hast mir ebenfalls meine Gedanken verscheucht.« Sie kündigt mehrmals an, dass sie gehen wird, kann sich aber nicht losreißen. Dieser ständig aufgeschobene, überaus theatralische Aufbruch macht ihre Verwirrung nur allzu deutlich, die peinlich und amüsant zugleich ist.
Als sie ihre Gefühle für den Mann entdeckt, den sie für Dorantes Diener hält, wundert sie sich darüber, wie entzückt sie ist: »Welch ein Mensch, dieser Diener!« Sie versucht sich wieder zur Räson zu bringen — »mir ist vorausgesagt worden, daß ich nur einen Mann von Stand heiraten werde« —, aber alle Mühe ist vergebens, die Argumente der Vernunft verlieren an Gewicht, wenn das Herz spricht. Die soziale Konditionierung ist kein Schicksal — daran erinnern uns bestimmte Begegnungen. Wobei sie meist nicht reibungslos verlaufen, denn die Befreiung vom Stempel des Sozialen kann ziemlich unangenehm sein. Silvia jedoch freut sich zu sehen, dass Dorante sich auf der Höhe zeigt. Als sie als Erste begreift, dass sie beide denselben Einfall hatten, und seine wahre Identität entdeckt, jubelt sie, ihn von der Frau verführt zu sehen, die er für eine Dienerin hält: »Daß es ihn so viel kostet, sich zu entscheiden, macht ihn mir noch schätzenswerter: er glaubt, seinen Vater zu enttäuschen und seine Geburt zu verleugnen. Das sind wichtige Überlegungen: ich bin glücklich, wenn ich sie besiege! Doch muß ich mir diesen Sieg erringen, er darf ihn mir nicht schenken«. Auch wenn sie derselben sozialen Schicht angehören und den Wünschen ihrer Familien gemäß heiraten werden, hat die Verwirrung, die sie in diesem Moment fühlen, ihrer sozialen Identität einen Riss zugefügt: Sie lassen eine Anwandlung des Herzens zu, die »gesellschaftlich unschicklich« ist, aber umso reizvoller und aufregender, als sie eine Übertretung darstellt.
Indem Begegnung das soziale Ich verschiebt, seine Eindeutigkeit stört und seine Konturen verschwimmen lässt, manchmal sogar seine List und Täuschung entlarvt, gibt sie dem inneren Ich sein volles Daseinsrecht zurück. Daher dieses starke Gefühl mitten in der Verwirrung, die sie auslöst, mit allen Fasern zu leben, endlich zu leben. Das innere Ich lässt sich vom sozialen Ich nicht mehr verdecken: Es schwappt jäh darüber hinweg. Die Verwirrung verweist auf den Weg, der zurückgelegt wurde, manchmal in rasend schnellem Tempo. Alles hatte mit dem Satz begonnen: »Und du, was machst du so?« Worauf wir jetzt die Stimme von France Gall und ihren verwirrenden Vorschlag vernehmen: Viens, je t’emmène — Komm, ich nehme dich mit.
Ich erkenne dich wieder
Wenn der Zufall nach Schicksal aussieht
Manchmal verstärkt ein seltsames Gefühl von Evidenz noch die Verwirrung. Ich kenne diese Person nicht, ich habe sie gerade kennengelernt, und doch bin ich mir sicher: Sie ist es. Dieses Gefühl gibt uns Vertrauen angesichts des Unbekannten, das es schon nicht mehr wirklich ist. Wir laufen jemandem zufällig über den Weg, doch es kommt uns vor, als hätten wir dieser Person begegnen müssen, als wären wir mit ihr verabredet.
Dieser Eindruck der Vertrautheit, den wir beim ersten Mal im Beisein eines Menschen haben, der uns lieb und teuer geworden ist, beruht auf Gegenseitigkeit. Wir fühlen uns sofort wohl mit ihm, das Verständnis ist beiderseitig. Das ist mehr als irritierend: Wie kann es sein, dass wir uns mit einem Unbekannten wohler fühlen als mit Leuten, mit denen wir schon seit ewigen Zeiten verkehren? Es ist, als knüpfte ich, durch diese Begegnung, an Bekanntes an; als würde ich, statt dich kennenzulernen, dich wiedererkennen. Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren — schon bei den ersten Gesprächen —, eine verwandte Seele gefunden zu haben: Dieselben Songs rühren uns, dieselben Skurrilitäten amüsieren uns, dieselben Verhaltensweisen nerven uns. Wir brauchen uns nicht anzustrengen; alles läuft wie von selbst und fühlt sich leicht an. Kaum dass wir einander begegnet sind, fühlen wir eine ähnlich starke Bindung wie zu einem Familienmitglied, eine verwirrende Nähe.
Wie kommt es, dass das Neue, das Unbekannte uns so vertraut vorkommen? Dieses Rätsel bildet den Kern dieses Buches. Aber auch des Chansons Les Mots bleus von Christophe, das Alain Bashung gecovert hat:
Ich werde ihr die blauen Worte sagen
Solche, die Menschen glücklich machen
Eine Liebesgeschichte ohne Worte
Braucht keine Formalitäten mehr
Und alle belanglosen langen Reden
Würden ihn verderben, den Stil
Unseres Wiedersehens
Dieser Liedtext aus der Feder von Jean-Michel Jarre erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich nicht traut, eine Frau anzusprechen, und sich ihre Begegnung ausmalt. Er beobachtet sie, zögert. Kehrt immer an denselben Ort zurück, um auf sie zu warten. Er hat noch nicht gewagt, sie anzusprechen, wägt aber schon die Worte ab, die er ihr sagen könnte, oder was er verschweigen sollte. Warum also von »Wiedersehen« sprechen? Einem Wiedersehen, das auf Französisch ein »Wiederfinden« ist: retrouvailles. Was genau findet er wieder? Vielleicht haben sich ihre Blicke gekreuzt, vielleicht meint er sie zu kennen, nachdem er sie schon so lange beobachtet. Dann findet er sie tatsächlich wieder. Vielleicht findet er aber auch zu einem Teil seiner selbst zurück, zu seiner Kindheit, zu seiner Geschichte, zu einer Welt, die einmal die seine gewesen ist, zu den Männern und Frauen, die ihn geprägt haben. Manche Begegnung ist ein derartiger Schock, dass es ihm vielleicht vorkommt, als ob er den Sinn seines Lebens entdecken würde, von dem er sich entfernt hatte: seine wahre Bestimmung. Er hat den Klang ihrer Stimme immer noch nicht gehört, aber er glaubt an das, was er fühlt; er vertraut sich selbst.
»Es gibt keinen Zufall, es gibt nur Verabredungen«, soll Paul Éluard gesagt haben. Eine Verabredung können wir mit einem anderen Menschen, mit uns selbst oder mit unserem Schicksal haben, so der Dichter des Surrealismus, für den Letzteres ein wichtiges Thema war. In allen Fällen ist dieses Gefühl von Evidenz — oder besser gesagt: des Wiedererkennens (reconnaissance) — das untrügliche Zeichen der Begegnung, die gerade stattfindet. Ich erkenne dich wieder, denn du bist mir tatsächlich nicht unbekannt. Ich erkenne mich wieder in dem Sinne, dass ich mich wiederfinde, mich oder etwas, das ich liebe, eine entfernte Erinnerung, einen mir bereits bekannten Zustand. Oder aber ich erkenne meine Bestimmung wieder in dem Sinne, dass ich ihre Tarnung als Zufall aufdecke. Das Zeichen der Begegnung ist hier, mitten im Zufall, der Eindruck einer Verabredung mit dem nicht Zufälligen: Das Gefühl von Evidenz ist so stark, dass das Akzidentelle plötzlich als Schicksal in Erscheinung tritt. Es kann sogar sein, dass wir so etwas wie Dankbarkeit (reconnaissance) empfinden für das, was uns das Leben zu bieten hat. Ich weiß nicht, ob ich dir begegne oder mir oder meiner Bestimmung — oder allen dreien auf einmal. Aber die Evidenz ist gegeben: Es gibt Begegnung, Wiedererkennen und Dankbarkeit in einem.
Ich habe Sie irgendwo schon mal gesehen
»Ich glaube, ich habe Sie irgendwo schon mal gesehen«, lautet eine ziemlich phantasielose Anmache, die manchmal zu hören ist. Und dennoch bringt der banale und zugegebenermaßen plumpe Ausspruch etwas davon zum Ausdruck, was jede Begegnung ausmacht: der Eindruck, den Anderen wiederzuerkennen.
Man könnte sogar sagen, dass der Anmacher unwissentlich eine der Thesen zur Sprache bringt, die Platon im Menon vertritt. In diesem Dialog zwischen Menon und Sokrates untersucht der Philosoph das Rätsel des (Wieder-)Erkennens anhand der Begegnung mit einer Idee. Woher kommt, genau in dem Moment, in dem wir zum ersten Mal etwas begreifen, in dem wir eine Idee klar formulieren, der Eindruck, dass sie evident sei, dass wir es schon immer wussten? Warum löst das Formulieren einer Idee das Gefühl von Wiederentdecken aus? Erkenntnis, so Platon, ist eigentlich ein Wiedererkennen oder, um es mit seinen Worten zu sagen, eine »Reminiszenz« oder Rückerinnerung. Bevor wir geboren wurden und für die begrenzte Dauer unseres irdischen Lebens in unseren Körper »fielen«, gehörten wir der Welt der ewigen Ideen an, und diese Welt werden wir im Augenblick unseres Todes, befreit von den Grenzen unseres Körpers, wiederfinden. Demnach ist das Verständnis einer Idee eigentlich ein Wiedererkennen dieser Idee, die wir in ihrer intelligiblen und ewigen Form gekannt haben, bevor wir in unsere Körperhülle gefallen sind. Einer Idee zu begegnen, bedeutet, sie wiederzufinden.
Auch die Liebe auf den ersten Blick, die Solal im Roman Die Schöne des Herrn von Albert Cohen für Ariane empfindet, mutet wie ein Wiedersehen oder Wiederfinden an. Cohens barocker Stil bringt auf wunderbare Weise die Kraft dieser Evidenz zum Ausdruck und was sie an Verwirrung für uns als vermeintlich vernünftige und rationale Wesen bereithält: »›Auf dem brasilianischen Empfang‹, flüsterte er, ›zum ersten Mal gesehen und sofort geliebt, distinguiert unter den Nichtswürdigen erschienen, du und ich und kein anderer in der Menge der Erfolgsmenschen und Machthungrigen […]. […] du warst es, die Erwartete, sofort auserwählt an jenem Schicksalsabend, auserwählt beim ersten Schlag der langgeschwungenen Wimpern […]. Den anderen gelingt es erst nach Wochen zu lieben, und sie lieben wenig, und sie brauchen dazu Gespräche und gemeinsame Neigungen und Kristallisationen. Ich brauche nur die Dauer eines Lidschlags.‹«
Ariane ist für Solal eine gänzlich Unbekannte, doch er zweifelt nicht einen Augenblick daran, der Frau seines Lebens begegnet zu sein. Es dauert keinen Bruchteil einer Sekunde — »nur die Dauer eines Lidschlags« —, um es zu wissen. Er braucht keine Argumente, keine Überlegungen, noch nicht einmal ein einziges Wort. Solal erkennt in Ariane die Frau, die alle anderen in den Schatten stellen wird: »die Unerwartete und die Erwartete«. Unerwartet, weil sie überraschend auftaucht, erwartet, weil er diejenige (wieder)erkennt, die er ersehnt hat, zu der ihn sein ganzes bisheriges Leben geführt hat, mit der er folglich »verabredet« war. Er erkennt außerdem den »Schicksalsabend«, obwohl er sich nur zufällig im Ritz befindet.
Und Solal fährt fort: »›Nenn mich verrückt, aber glaub mir. Ein Schlag deiner Lider, und du blicktest mich an, ohne mich zu sehen, und es war die Herrlichkeit und der Frühling und die Sonne und das warme Meer und meine wiedergekehrte Jugend, und die Welt war geboren, und ich wusste, dass niemand vor dir, weder Adrienne noch Aude, noch Isolde, noch all die anderen meines Glanzes und meiner Jugend mehr waren als deine Vorboten und Dienerinnen. Ja, niemand vor dir, niemand nach dir.‹«