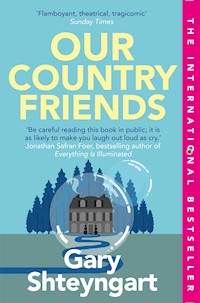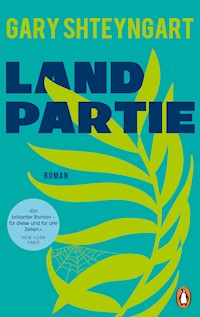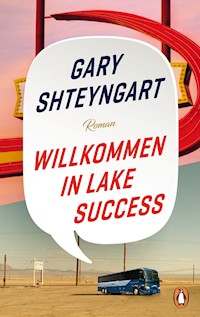9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Igor, ein asthmatischer kleiner Junge, der mit seinen Eltern in Leningrad lebt, wächst mit Sehnsüchten auf: nach Essen, nach Bestätigung, nach Wörtern. Als er fünf ist, schreibt er unter dem Einfluss seines Lieblingsbuchs «Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen» seinen ersten Roman, «Lenins wunderbare Wildgänse», und seine Großmutter gibt ihm für jede Seite eine Scheibe Käse. Damit er weiter zu Kräften kommt und auch seine Höhenangst überwindet, bringt sein Vater im Wohnzimmer eine Sprossenwand an, und trotz Schwindel und Schweißausbrüchen träumt Igor hoch droben, er werde Kosmonaut. Zwei Jahre später, 1979, wandert die jüdische Familie nach Amerika aus, aber erst unterwegs erfährt er mit Schrecken, wohin die Reise geht: «zum Feind». Und doch findet Igor, der sich nun Gary nennt, in New York seine erste Spielkameradin überhaupt, ein Mädchen, dem ein Auge fehlt. «Ich bin Einwanderer, und sie hat nur ein Auge, also sind wir gleich.» Diese Geschichte eines Jungen, der von seinen Eltern zärtlich «Kleiner Versager» genannt wird, weil man ihn zwar abgöttisch liebt, aber nicht so recht an sein Glück und seinen Erfolg im Leben glaubt, ist ein an Menschenkenntnis und Emotionen beglückend reiches Buch – voller Humor, obwohl die Familie wegen Hitler und Stalin nicht viel zu lachen hat und Alltagsnöte sich auftürmen wie Berge. Eine berührende und zugleich komische Kindheitsgeschichte: fesselnd, meisterhaft und – da sie Gary Shteyngarts eigene Geschichte ist – auch wahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Ähnliche
Gary Shteyngart
Kleiner Versager
Aus dem Englischen von Mayela Gerhardt
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Igor, ein asthmatischer kleiner Junge, der mit seinen Eltern in Leningrad lebt, wächst mit Sehnsüchten auf: nach Essen, nach Bestätigung, nach Wörtern. Als er fünf ist, schreibt er unter dem Einfluss seines Lieblingsbuchs «Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen» seinen ersten Roman, «Lenins wunderbare Wildgänse», und seine Großmutter gibt ihm für jede Seite eine Scheibe Käse. Damit er weiter zu Kräften kommt und auch seine Höhenangst überwindet, bringt sein Vater im Wohnzimmer eine Sprossenwand an, und trotz Schwindel und Schweißausbrüchen träumt Igor hoch droben, er werde Kosmonaut. Zwei Jahre später, 1979, wandert die jüdische Familie nach Amerika aus, aber erst unterwegs erfährt er mit Schrecken, wohin die Reise geht: «zum Feind». Und doch findet Igor, der sich nun Gary nennt, in New York seine erste Spielkameradin überhaupt, ein Mädchen, dem ein Auge fehlt. «Ich bin Einwanderer, und sie hat nur ein Auge, also sind wir gleich.»
Über Gary Shteyngart
Inhaltsübersicht
Für meine Eltern – die Reise ist nie zu Ende.
Für Dr. med. Dr. phil. Richard C. Lacy
1.Die Kirche und der Hubschrauber
Während einer einsamen Lebensphase, 1995–2001. Der Autor versucht, eine Frau zu umarmen.
Ein Jahr nach meinem College-Abschluss arbeitete ich im gewaltigen Schatten des World Trade Centers in Manhattan, und während meiner ausufernden vierstündigen Mittagspause aß und trank ich mich täglich an den beiden Riesen vorbei – den Broadway rauf, die Fulton Street runter und bis zum Strand Book Annex. Im Jahr 1996 lasen die Menschen noch Bücher, und der legendäre Strand Bookstore konnte sich noch eine Filiale im Financial District leisten. Will sagen, man traute damals Börsenmaklern, Sekretärinnen, Regierungsbeamten – jedem – eine Art Seelenleben zu.
Im Jahr davor hatte ich versucht, für eine Bürgerrechtskanzlei als Anwaltsassistent zu arbeiten, aber das war nichts. Die Stelle bedeutete viel Kleinstarbeit, deutlich mehr, als ein nervöser junger Mann mit Pferdeschwanz, minderschwerem Drogenproblem und einem Hanfstecker auf der Pappkrawatte bewältigen konnte. Nie war ich näher dran, den Traum meiner Eltern von einem Anwaltssohn zu erfüllen. Wie die meisten sowjetischen Juden, wie die meisten Einwanderer aus kommunistischen Ländern waren meine Eltern zutiefst konservativ und gar nicht angetan von meinen vier Jahren auf dem liberalen Oberlin College, wo ich marxistische Gesellschaftslehre und Bücherschreiben studierte. Bei seinem ersten Besuch auf dem Oberlin stand mein Vater mitten auf einer riesigen Vagina, die von der Vertretung schwuler, lesbischer und bisexueller Studenten auf den Hof gemalt worden war; das um ihn herum anschwellende Getuschel und Gezischel nahm er gar nicht wahr, während er mir die Unterschiede zwischen Laserdruckern und Tintenstrahldruckern darlegte, vor allem die Preisunterschiede zwischen den Druckerpatronen. Ich glaube, er hielt das Gemälde für einen Pfirsich.
Das Examen machte ich mit Auszeichnung, wodurch mein Ansehen bei Mama und Papa etwas stieg, aber im Gespräch ließen sie deutlich durchblicken, dass ich sie nach wie vor enttäuschte. Weil ich als Kind kränklich war und mir dauernd die Nase lief (auch als Erwachsener noch), nannte mich mein Vater sopljak oder Rotznase. Meine Mutter entwickelte eine interessante Mischung aus Englisch und Russisch und bastelte sich den Ausdruck failurtschka: kleiner Versager. Ihr Wort schaffte es in das schwülstige Romanmanuskript, das ich damals in meiner Freizeit tippte und dessen Eingangskapitel kurz darauf vom renommierten Studiengang Kreatives Schreiben an der Universität Iowa abgelehnt werden sollte. Was mir zeigte, dass nicht nur meine Eltern nichts von mir hielten.
Als meine Mutter begriff, dass aus mir nie etwas Anständiges werden würde, ließ sie ihre Beziehungen spielen, wie es nur eine jüdisch-russische Mama kann, und besorgte mir einen Job als festangestellter «Redakteur» bei einer Beratungsstelle für Immigranten in Manhattan, wo ich im Schnitt eine halbe Stunde pro Jahr zu tun hatte; meistens musste ich Broschüren korrigieren, die russische Neuankömmlinge über das Wundermittel Deodorant und die Gefahren von Aids aufklärten und für die subtile Befriedigung warben, sich auf amerikanischen Partys nicht die Hucke vollzusaufen.
In der übrigen Zeit soff ich mir mit meinen russischen Kollegen auf diversen amerikanischen Partys die Hucke voll. Schließlich wurden wir allesamt gefeuert, aber vorher konnte ich noch große Teile meines ersten Romans schreiben und wieder umschreiben und in einer Kneipe namens Blarney Stone, wenn ich mich nicht irre, die irischen Freuden eines Gin Martini zu Corned Beef mit Kohl kennenlernen. Um zwei Uhr nachmittags lag ich auf meinem Schreibtisch und ließ stolze irische Kohlfürze fahren, benebelt von überaus romantischen Gefühlen. Aus dem Briefkasten des robusten Kolonialhäuschens meiner Eltern in Little Neck, Queens, quollen die Überreste des amerikanischen Traums, den sie für mich geträumt hatten: nette Broschüren für Aufbaustudiengänge, in absteigender Qualität – von der Harvard Law School über die Fordham Law School, die John F. Kennedy School of Government (fast wie ein Jurastudium, aber eben nur fast), das Cornell Department of City and Regional Planning bis hin zur düstersten Aussicht einer jeden Einwandererfamilie: dem Master-Studiengang Kreatives Schreiben an der Universität Iowa.
«Aber was für ein Beruf ist das – Schriftsteller?», wollte meine Mutter wissen. «Das willst du werden?»
Das will ich werden.
Im Strand Book Annex stopfte ich meinen Beutel voll mit Taschenbüchern zum halben Preis, stöberte die ausrangierten Rezensionsexemplare durch und hielt dabei Ausschau nach jemandem wie mir hinten auf dem Buchumschlag: junger Flaneur mit Ziegenbart, verzweifelt urban, besessen von allem, was nach Orwell und Dos Passos riecht, bereit für einen nächsten Spanischen Bürgerkrieg, könnten sich die launischen Spanier nur endlich dazu aufraffen. Und wenn ich einen solchen Doppelgänger fand, hoffte ich inbrünstig, dass seine Texte nichts taugten. Denn der Veröffentlichungskuchen gab nicht unendlich viel her. Die blaublütigen amerikanischen Verleger wie jene vom Verlagshaus von und zu Random würden meine übereifrige Einwandererprosa durchblättern und dann einen Trottel von der Brown University begünstigen, dessen Auslandsstudium in Oxford oder Salamanca ihm den blassen Teint beschert hatte, den man für einen gut verkäuflichen Bildungsroman brauchte.
Nachdem ich dem Strand Book Annex sechs Dollar überlassen hatte, rannte ich zurück ins Büro und verschlang die zweihundertvierzig Romanseiten meines Konkurrenten in einem Rutsch, während sich meine russischen Kollegen im Büro nebenan mit ihrer wodkaseligen Lyrik überbrüllten. Verzweifelt suchte ich nach schlampig gebauten Sätzen oder Schreibkursklischees. Nach Beweisen dafür, dass sein Werk schlechter war als jenes, das in meinem Bürocomputer heranreifte (idiotischer Arbeitstitel: Die Pyramiden von Prag).
Eines Tages, ich hatte eben mit zwei Portionen Vindaloo von der Wall Street ein Desaster in meinem Magen heraufbeschworen, stürmte ich in die Kunst- und Architekturabteilung des Strand Book Annex. Mein damaliges Jahresgehalt von neunundzwanzigtausend Dollar passte leider nicht zu dem gediegenen Preisschild auf dem Band mit Aktzeichnungen von Egon Schiele. Doch es war kein melancholischer Österreicher, der den besoffenen und bekifften Stadtgorilla, in den ich mich grade verwandelte, völlig aus dem Gleichgewicht brachte. Nicht die attraktiven teutonischen Nackten zogen mich zurück an den trostlosen Ort.
Das Buch hieß Sankt Petersburg: Architektur der Zaren, und die barocken Blautöne der Smolny-Kathedrale sprangen mir vom Buchdeckel entgegen. Ein drei Kilo schwerer Hochglanz-Coffeetable-Bildband. Und das war bereits das erste Problem.
Die Frau, in die ich damals verknallt war, kam auch vom Oberlin («Liebe, wen du kennst», lautete meine provinzielle Theorie) und hatte ihr Urteil über den Inhalt meiner Bücherregale bereits gefällt: zu viel Leichtes und zu viel Männliches. Immer wenn sie in meine neue Einzimmerwohnung in Brooklyn kam und ihre hellen Midwest-Augen die Reihen meiner literarischen Armee nach einer Tess Gallagher oder Jeanette Winterson absuchten, wollte ich unbedingt ihren Geschmack treffen – und als Begleiterscheinung den Druck ihres rasiermesserscharfen Schlüsselbeins an meinem spüren. Hoffnungslos bemüht stellte ich meine Oberlin-Lektüre – wie Tabitha Konogos Squatters and the Roots of Mau Mau – neben neu entdeckte Perlen feministischer Ethnologie, beispielsweise Lois-Ann Yamanakas Wild Meat and the Bully Burgers, für mich der Inbegriff des hawaiianischen Entwicklungsromans. (Irgendwann sollte ich ihn mal lesen.) Würde ich die Architektur der Zaren kaufen, müsste ich sie vor dieser jungen Frau in einem meiner Schränke verstecken, gut getarnt hinter Kakerlakenfallen und Flaschen billigen GEOЯGI-Wodkas.
Abgesehen davon, dass ich vor meinen Eltern als Versager dastand und Die Pyramiden von Prag einfach nicht fertig bekam, war meine größte Sorge die Einsamkeit. Meine erste richtige Freundin, ein attraktives lockiges hellhäutiges Mädchen aus North Carolina, eine Kommilitonin vom Oberlin, war in den Süden gezogen, um mit einem gutaussehenden Schlagzeuger in seinem Minibus zu leben. Nach meinem College-Abschluss sollte ich vier Jahre verbringen, ohne ein Mädchen auch nur zu küssen. Brüste, weibliche Hinterteile und die Worte «Ich liebe dich, Gary» lebten nur noch in meiner abstrakten Erinnerung fort. Bis auf Widerruf bin ich für den Rest des Buchs in alles und jeden total verknallt.
Und dann war da noch das Preisschild an der Architektur der Zaren – von fünfundneunzig auf sechzig Dollar herabgesetzt –; dafür könnte ich mir im Haus meiner Eltern knapp dreiundvierzig Hühnerkoteletts leisten. Wenn es um Finanzielles ging, war meine Mutter herzlich, aber hart. Als ihr kleiner Versager eines Abends zum Essen kam, überreichte sie ihm eine Packung «Kiewer Koteletts» – mit Butter gefüllte Hühnerkoteletts. Ich nahm sie dankbar entgegen, doch Mama teilte mir mit, jedes Kotelett koste «ungefähr einen Dollar vierzig». Ich wollte ihr für die vierzehn Koteletts siebzehn Dollar geben, aber sie knöpfte mir volle zwanzig ab; immerhin bekam ich als Dreingabe noch eine Rolle Frischhaltefolie, um das Geflügel einzuwickeln. Ein Jahrzehnt später, nachdem ich meinen Alkoholkonsum etwas eingedämmt hatte, würde mich das Wissen, dass mir meine Eltern nicht zur Seite standen und ich das Leben grimmig und allein anpacken musste, zu einem beängstigenden Arbeitspensum antreiben.
Ich blätterte die monumentale Architektur der Zaren durch, betrachtete die vertrauten Wahrzeichen meiner Kindheit und empfand die vulgäre Nostalgie, die poschlost, die Nabokov so verachtete. Da war der Triumphbogen des Generalstabsgebäudes mit seiner gewundenen Geometrie, der zum Schlossplatz mit den cremigen Gebäuden führt. Der Schlossplatz mit dem cremigen Winterpalast, aufgenommen von der glorreichen goldenen Spitze der Admiralität; die glorreiche goldene Spitze der Admiralität, aufgenommen vom cremigen Winterpalast, Winterpalast und Admiralität, aufgenommen von der Ladefläche eines Bierwagens und so weiter und so fort, in einer endlosen touristischen Spirale.
Ich sah mir Seite neunzig an.
«Ginger Ale im Schädel», so beschrieb Tony Soprano seiner Psychiaterin die ersten Anzeichen einer Panikattacke. Trockenheit und Nässe gleichzeitig, aber alles an den falschen Stellen, als hätten Achselhöhlen und Mund einen Kulturaustausch vereinbart. Der Film, den man eben gesehen hat, wird durch einen anderen ersetzt, das Gehirn muss ständig umspringen – auf ungewohnte Farben, fremdartige, bedrohliche Gesprächsfetzen. Wieso sind wir plötzlich in Bangladesch?, fragt der Verstand. Seit wann gehören wir zur Marsmission? Warum schweben wir auf einer schwarzen Pfefferwolke demNBC-Regenbogen entgegen? Dazu noch die Vorstellung, dass der nervös zuckende Körper nie wieder zur Ruhe kommt oder – im Gegenteil – viel zu schnell die ewige Ruhe findet, sprich, das Bewusstsein verliert und stirbt – und schon hat man alle Zutaten für einen hyperventilierenden Kollaps beisammen. Genau das erlebte ich.
Und worauf starrte ich, während mein Hirn in seiner harten Schale herumkullerte? Auf eine Kirche. Die Tschesmensker Kirche an der Uliza Lensowjeta (Leningrad-Sowjet-Straße) im Moskowski-Bezirk jener Stadt, die früher einmal Leningrad hieß. Acht Jahre später sollte ich sie in einem Artikel für die Zeitschrift Travel + Leisure folgendermaßen beschreiben:
Die himbeerrot und weiß gestreifte Konfektschachtel der Tschesmensker Kirche ist ein schrilles Beispiel russischer Neogotik und sticht durch ihre Lage zwischen dem scheußlichsten Hotel der Welt und einem ganz besonders grauen sowjetischen Wohnblock umso stärker hervor. Das Auge rotiert angesichts der blendenden Selbstverliebtheit, der irren Ansammlung zuckergussüberzogener Türmchen und Zinnen. Zum Reinbeißen. Diese Kirche ist mehr Backwerk als Bauwerk.
Doch 1996 war ich noch nicht in der Lage, geistreiche Prosa zu verfassen. Noch hatte ich keine zwölf Jahre Psychoanalyse mit vier Sitzungen pro Woche hinter mir, die ein geschmeidiges rationales Wesen aus mir machen würde, das fast jeden Schmerzquell zu quantifizieren, katalogisieren und geschickt zu umschiffen weiß – bis auf einen. Ich betrachtete die zierliche Kirche: Der Fotograf hatte sie mit zwei Bäumen eingerahmt, und vor dem putzigen kleinen Eingang lag der schlaglöcherdurchsetzte Asphalt. Sie ähnelte einem Kind, das sich für einen festlichen Anlass zu fein gemacht hat. Oder einem kleinen Versager mit rotem Gesicht und Bauchansatz. Sie sah so aus, wie ich mich fühlte.
Ich versuchte, meine Panikattacke in den Griff zu kriegen. Mit schweißnassen Händen legte ich das Buch zurück. Ich dachte an das Mädchen, in das ich verknallt war – die nicht eben zartbesaitete Zensorin meiner Bücherregale und meines Geschmacks; ich dachte daran, dass sie größer war als ich, und an ihre grauen geraden Zähne, die ebenso entschlossen wirkten wie alles an ihr.
Und dann dachte ich überhaupt nicht mehr an sie.
Die Erinnerungen standen Schlange. Die Kirche. Mein Vater. Wie sah Papa aus, als wir jünger waren? Ich sah die mächtigen Brauen, den fast sephardischen Teint, die gequälte Miene eines Menschen, dem das Leben übel mitgespielt hat. Aber nein, das war ja mein Vater der Gegenwart. Wenn ich an meinen frühen Vater dachte, den vor unserer Einwanderung, dann konnte ich mich in seiner bedingungslosen Liebe sonnen. Ich erinnerte mich an einen unbeholfenen, kindlich-fröhlichen Mann, der sich freute, einen kleinen Kumpel namens Igor zu haben (mein russischer Name vor «Gary»), seinen Igorjotschik, der weder Vorurteile hat noch Antisemit ist, einen kleinen Gefährten im Kampf – erst gegen die Erniedrigungen der Sowjetunion und später gegen die der Auswanderung nach Amerika, der großen Entwurzelung aus Sprache und gewohnter Umgebung.
Da ist er, der frühe Vater mit seinem Igorjotschik, und gerade sind wir zu der Kirche aus dem Buch gegangen! Das vergnügte himbeerrote Eiskonfekt der Tschesmensker Kirche, nur fünf Straßen von unserer Leningrader Wohnung entfernt, ein rosarotes barockes Kleinod inmitten der vierzehn Beige-Schattierungen der Stalin-Ära. Zu Sowjetzeiten war es keine Kirche, sondern ein Marinemuseum zu Ehren der siegreichen Seeschlacht bei Çeşme im Jahr 1770 – wenn mich meine Erinnerung nicht trügt (möge sie mich bitte nicht trügen) –, bei der die orthodoxen Russen die türkischen Hurensöhne erledigten. Das Innere des Gotteshauses (heute ist es wieder eine geweihte Kirche) war ein Traum für kleine Jungen – bis oben hin vollgestopft mit Modellen prachtvoller Kriegsflotten des 18. Jahrhunderts.
Lasst mich noch einen Augenblick beim Thema «Der frühe Vater und die Türken» bleiben. Dazu erstmal ein paar grundlegende Vokabeln: Datscha ist das russische Wort für Wochenend- oder Sommerhaus, aber aus dem Mund meiner Eltern klang es wie «Gottes barmherzige Gnade». Kaum hatte sommerliche Wärme den Würgegriff des eisigen Leningrader Winters und laschen Frühlings gelockert, schleppten mich meine Eltern von einer Datscha zur nächsten, kreuz und quer durch die damalige Sowjetunion: ein pilzreiches Dorf in der Nähe von Daugavpils in Lettland; das anmutig bewaldete Sestrorezk am Finnischen Meerbusen; das berüchtigte Jalta auf der Krim (wo Stalin, Churchill und Roosevelt eine Art Grundstücksdeal einfädelten); Sochumi, heute ein heruntergekommener Urlaubsort am Schwarzen Meer in einer abtrünnigen Region Georgiens. Mir wurde beigebracht, vor der Sonne auf die Knie zu fallen, vor der Lebensspenderin, die Bananen gedeihen ließ, und ihr für jeden ihrer grausam brennenden Strahlen zu danken. Wie lautete Mutters liebster Kosename für mich? Kleiner Versager? Nein! Solnyschko. Kleiner Sonnenschein.
Fotografien aus jener Ära zeigen ein Gruppe müder Frauen in Badeanzügen und einen Jungen, der aussieht wie Marcel Proust und die Warschauer-Pakt-Variante einer Speedo-Badehose trägt (das wäre dann ich); sie starren geradeaus in die grenzenlose Zukunft, während ihnen das Schwarze Meer sanft die Füße kitzelt. Ein sowjetischer Urlaub war beileibe kein Zuckerschlecken. Auf der Krim standen wir in aller Herrgottsfrühe auf und reihten uns in die Schlange für Joghurt, Kirschen und sonstige Lebensmittel ein. Die KGB-Obersten und Parteibonzen in ihren schicken Strandhäusern machten sich ein laues Leben, während wir anderen mit mattem Blick in der elenden Sonne standen, um einen Brotlaib zu ergattern. In dem Jahr hatte ich ein Haustier, einen knallbunten mechanischen Aufziehhahn, den ich stolz jedem in der Schlange präsentierte. «Er heißt Pjotr Petrowitsch Hahnowitsch», verkündete ich ungewohnt großspurig. «Wie ihr seht, humpelt er, weil er im Großen Vaterländischen Krieg verwundet wurde.» Meine Mutter befürchtete, es könnten auch Antisemiten in der Kirschenschlange stehen (denn auch die müssen essen), und zischte mir zu, ich solle leise sein, sonst gäbe es nachher kein Rotkäppchen-Konfekt zum Nachtisch.
Ob mit oder ohne Konfekt, mein invalider Vogel Pjotr Petrowitsch Hahnowitsch brachte mich immer wieder in die Bredouille. Er erinnerte mich an mein Leben in Leningrad, das hauptsächlich daraus bestand, allmählich an Winterasthma zu ersticken, wobei ich reichlich Zeit hatte, Kriegsromane zu lesen und davon zu träumen, wie Pjotr und ich in Stalingrad unseren Anteil an Deutschen zur Strecke brachten. Der Hahn war schlicht mein bester und einziger Freund auf der Krim, und niemand konnte uns trennen. Als der freundliche ältere Besitzer der Datscha, in der wir wohnten, Pjotr in die Hand nahm, sein Hinkebein streichelte und murmelte: «Schauen wir doch mal, ob wir den kleinen Kerl nicht repariert kriegen», entriss ich ihm den Hahn und schrie: «Du Fiesling, du Schuft, du Dieb!» Daraufhin flogen wir hochkant aus der Datscha und mussten fortan in einer Art unterirdischer Hütte hausen. Dort wollte ein schwächlicher dreijähriger Ukrainer ebenfalls mit meinem Hahn spielen, was ähnliche Folgen hatte. Diesem Zwischenfall verdanke ich die einzigen ukrainischen Worte, die ich beherrsche: «Ty chlopez menja bjosch!» («Du Junge haust mich!») Auch in der unterirdischen Hütte blieben wir nicht lang.
In besagtem Sommer war ich nervlich wohl etwas angespannt, gleichzeitig aber verzaubert und verwirrt von der sonnigen südlichen Landschaft und vom Anblick der gesunden, starken Körper, die in voller slawischer Pracht um mich und meinen kaputten Hahn herumturnten. Ohne dass ich es ahnte, steckte auch meine Mutter mitten in einer Krise; sie rang mit sich. Sollte sie bei meiner kranken Großmutter in Russland bleiben oder sie für immer verlassen und nach Amerika auswandern? Die Entscheidung wurde ihr in einem schmierigen Lokal auf der Krim abgenommen. Über einem Teller Tomatensuppe erzählte eine stämmige Frau aus Sibirien, wie ihr achtzehnjähriger Sohn nach der Einberufung bei der Roten Armee grundlos grün und blau geprügelt worden war, was ihn eine Niere gekostet hatte. Die Frau zeigte meiner Mutter ein Foto ihres Jungen. Er sah gewaltig aus, wie ein mit einem Ochsen gekreuzter Elch. Meine Mutter warf bloß einen Blick auf diesen gefällten Riesen und einen weiteren auf ihren schmächtigen, keuchenden Sohn, und wenig später saßen wir schon in einem Flugzeug Richtung Queens. Hahnowitsch mit seinem traurigen Hinkebein und dem prächtigen roten Kamm blieb das einzige Opfer der Roten Armee.
Doch wen ich in jenem Sommer wirklich vermisste – deshalb auch meine Gewaltausbrüche gegenüber großen und kleinen Ukrainern –, war mein wahrer bester Freund. Mein Vater. Alle anderen Erinnerungen sind bloß die Soufflierkarten für ein mächtiges Bühnenbild, das sich wie der Rest der Sowjetunion längst in Luft aufgelöst hat. Manchmal frage ich mich, ob irgendetwas davon tatsächlich passiert ist. War das wirklich der junge Genosse Igor Shteyngart, der an der Schwarzmeerküste entlangkeuchte, oder ein anderer eingebildeter Kranker?
Sommer 1978. Damals lebte ich nur für die lange Schlange vor der Telefonzelle mit der Aufschrift LENINGRAD (verschiedene Telefonzellen für verschiedene Städte), um die undeutlich knackende Stimme meines Vaters zu hören, die sich den Weg durch alle technischen Probleme des Landes hindurch bahnte, vom gescheiterten Atomwaffenversuch in der kasachischen Steppe bis zum jämmerlich blökenden Ziegenbock im nahen Weißrussland. Damals verband das Versagen uns alle miteinander. Die ganze Sowjetunion wurde langsam ausgeblendet. Mein Vater erzählte mir Geschichten durchs Telefon. Bis heute halte ich das Gehör für den stärksten meiner fünf Sinne, weil ich mich damals während der Schwarzmeerurlaube so sehr anstrengen musste, um ihn zu verstehen.
Die Gespräche sind Vergangenheit, aber einen seiner Briefe habe ich noch. Geschrieben in der ungelenken kindlichen Handschrift meines Vaters, der typischen Schrift eines sowjetischen Ingenieurs. Der Brief hat überdauert, weil viele Menschen es so wollten. Wir sind eigentlich kein besonders sentimentaler Menschenschlag, hoffe ich jedenfalls, aber wir wissen fast beängstigend genau, wie viel wir aufheben können, wie viele zerknitterte Schriftstücke ein Wandschrank in Manhattan eines Tages fassen kann.
Ich bin ein fünfjähriger Junge in einer unterirdischen Ferienunterkunft und halte diesen heiligen hingekritzelten Brief in den Händen, die dicht gedrängten kyrillischen Schriftzeichen mit durchgestrichenen Wörtern dazwischen, und während ich sie laut lese, verliere ich mich in der Ekstase der Verbindung.
Guten Tag, mein lieber kleiner Sohn.
Wie geht es dir? Was machst du? Hast du vor, den «Bärenberg» zu besteigen? Und wie viele Handschuhe hast du im Meer gefunden? Hast du schon schwimmen gelernt, und wenn ja, planst du fortzuschwimmen, in die Türkei?
Hier mache ich eine Pause. Keine Ahnung, was es mit diesen Meereshandschuhen auf sich hat, und ich erinnere mich nur vage an den «Bärenberg» (der Everest war es jedenfalls nicht). Aber was soll der letzte Satz? In die Türkei fortschwimmen? Die Türkei liegt zwar jenseits des Schwarzen Meers, aber wir sind in der Sowjetunion und können natürlich nicht dorthin, weder mit dem Dampfschiff noch im Delfinstil. Schwingt da etwas Subversives im Ton meines Vaters mit? Oder spielt er auf seinen sehnlichsten Wunsch an, meine Mutter möge endlich nachgeben und der Emigration in den Westen zustimmen? Oder bezieht er sich unbewusst auf die eben erwähnte Tschesmensker Kirche, die «mehr Backwerk als Bauwerk» ist und an Russlands Sieg über die Türken erinnert?
Kleiner Sohn, in ein paar Tagen sehen wir uns schon wieder, sei nicht einsam, benimm dich anständig, hör auf deine Mutter und deine Tante Tanja.
Küsse, Papa.
Sei nicht einsam? Wie könnte ich ohne ihn denn nicht einsam sein? Und sagt er etwa, dass auch er einsam ist? Aber natürlich! Und als wollte er den Schlag abmildern, finde ich unter dem Brieftext das, was ich am allerliebsten mag, noch lieber als Marzipan mit Schokoladenüberzug, das mich zu Hause in Leningrad so begeistert: eine illustrierte Abenteuergeschichte von meinem Vater! Ein Thriller im Stil Ian Flemings, versehen mit ein paar persönlichen Elementen zur Freude eines gewissen kleinen Jungen. Sie beginnt so:
Eines Tages lief in [dem Ferienort] Hursuf [wo ich gerade an Wangen und Armen Farbe bekomme] ein U-Boot namens Arzum aus der Türkei ein.
Mein Vater hat ein U-Boot mit Periskop gezeichnet, das auf einen phallischen Berg auf der Krim zusteuert, der wahlweise von Bäumen bewachsen oder mit Sonnenschirmen gespickt ist – schwer zu sagen. Die Zeichnung ist primitiv, aber das ist das Leben in unserer Heimat ja auch.
Zwei Marinesoldaten mit Tauchgeräten verließen das Boot und schwammen auf die Küste zu.
Die Invasoren ähneln aufgrund der breiten Strichführung meines Vaters eher watschelnden Stören, aber die Türken sind schließlich nicht für ihre Leichtfüßigkeit bekannt.
Von unseren Grenzposten unbemerkt, huschten sie in die Berge, in den Wald.
Die Türken – sind es wirklich Türken oder vielleicht amerikanische Spione, die die Türkei nur als Stützpunkt nutzen? (Himmel, ich bin noch nicht mal sieben Jahre alt und habe schon so viele Feinde!) – besteigen tatsächlich den sonnenschirmgespickten Berg. Noch eine Anmerkung: «von unseren Grenzposten». Ein kleiner Taschenspielertrick meines Vaters; die letzten dreißig Jahre hat er die Sowjetunion so inbrünstig gehasst, wie er Amerika die nächsten dreißig Jahre lieben wird. Doch noch haben wir das Land nicht verlassen. Und ich als glühender Verehrer der Roten Armee, des roten Pionierhalstuchs, überhaupt aller roten Dinge, darf noch nicht wissen, was mein Vater weiß – dass nichts von dem, was mir am Herzen liegt, wahr ist.
Er schreibt weiter:
Am nächsten Morgen entdeckten die sowjetischen Grenzposten frische Fußspuren am Strand des Puschkin-Sanatoriums und alarmierten die Grenzwache, die ihre Spürhündin aussandte. Rasch entdeckte sie die beiden Tauchgeräte unter den Felsen. Die Sache war glasklar: der Feind! «Such!», befahlen die Grenzposten, und die Hündin rannte schnurstracks auf das Internationale Pionierlager zu.
Ach, was gäbe ich nicht für einen kleinen Hund, so einen süßen, flauschigen, wie ihn der Stift meines Vaters jetzt den übergewichtigen amerikanischen Türken auf den Hals hetzt. Aber meine Mutter hat mit mir schon alle Hände voll zu tun, ein Haustier kommt gar nicht in Frage.
Fortsetzung folgt – zu Hause.
Fortsetzung folgt? Zu Hause? Wie grausam. Wie soll ich jetzt erfahren, ob die tapfere sowjetische Grenzwachhündin und ihre schwer bewaffneten Herrchen den Feind aufspüren und ihm verpassen, was ich jedem unserer Feinde wünsche? Nämlich einen langsamen, qualvollen Tod. Nur damit geben wir uns hier in der UdSSR zufrieden. Tod den Deutschen, Tod den Faschisten, Tod den Kapitalisten, Tod den Feinden des Volkes! Wie ich schon in diesem lachhaft jungen Alter koche vor Wut und hilflosem Ärger! Und jetzt spule man bis zum Jahr 1996 vor, zum jungfräulichen Futon in meiner kakerlakenverseuchten Einzimmerwohnung in Brooklyn, zur betrunkenen Beratungsstelle für Immigranten in Manhattan, zum Strand Book Annex, und siehe da: Ich bin immer noch randvoll mit abscheulicher, unanalysierter, entoberlinisierter Wut. Äußerlich ein ruhiges, nachdenkliches Kind, mitteilsam und heiter, aber man kratze an der russischen Oberfläche, und schon bricht ein Dutzend Tataren hervor, man drücke mir eine Heugabel in die Hand, und schon stürme ich auf den Feind im Heuhaufen los, scheuche ihn wie ein Schäferhund heraus und reiße ihn mit den Zähnen in Stücke. Wehe, jemand beleidigt meinen Aufziehhahn! Die Folge: Wut, Erregung, Gewalt und Liebe. «Kleiner Sohn, in ein paar Tagen sehen wir uns schon wieder», schreibt mein Vater, und das ist wahrer und trauriger als alles andere in meinem Leben. Warum erst in ein paar Tagen? Warum nicht jetzt sofort? Mein Vater. Meine Heimatstadt. Mein Leningrad. Die Tschesmensker Kirche. Der Countdown läuft schon. Jeder Moment, jeder Meter Abstand zwischen uns ist unerträglich.
Es ist 1999. Drei Jahre nach meiner Panikattacke im Strand Book Annex. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in meinem Petersburg, ehemals Leningrad, ehemals Petrograd. Ich bin siebenundzwanzig. In ungefähr acht Monaten werde ich einen Buchvertrag für einen Roman unterzeichnen, der nicht mehr Die Pyramiden von Prag heißt.
Aber das weiß ich noch nicht. Ich gehe immer noch davon aus, dass alles, was ich anpacke, zum Scheitern verurteilt ist. Im Jahr 1999 schreibe ich Bittbriefe für eine Wohltätigkeitsorganisation auf der Lower East Side, und die Frau, mit der ich schlafe, hat einen Freund, der nicht mit ihr schläft. Ich bin nach Sankt Petersburg zurückgekehrt, um mich vom Nabokov’schen Strom der Erinnerung mitreißen zu lassen – Erinnerungen an ein Land, das nicht mehr existiert; ich will unbedingt wissen, ob die Metro immer noch so tröstlich nach Gummi, Elektrizität und ungewaschener Menschheit riecht wie damals. Meine Heimkehr fällt in die letzten Zuckungen der Jelzin-Ära im Wilden Osten, als die Alkoholexzesse des Präsidenten und spektakuläre Gewalttaten in den Städten um die Schlagzeilen kämpfen. Es handelt sich mittlerweile dem Aussehen und der politischen Stimmung nach um ein Drittweltland im freien Fall; jede Kindheitserinnerung – und es gab weitaus schlimmere Schicksale als eine Kindheit in der Sowjetunion – wird von der neuen Realität getrübt. Im Gelenk des Ziehharmonikabusses vom Flughafen in die Stadt klafft ein kindergroßes Loch. Ich weiß das, weil um ein Haar ein kleines Kind hindurchfällt, als der Bus ruckend hält. Keine Stunde nach der Landung habe ich schon eine Metapher für meinen gesamten Besuch gefunden.
Am vierten Tag meiner Rückkehr erfahre ich, dass mein Ausreisevisum – Ausländer brauchen in Russland je ein Visum, um ins Land rein und um wieder raus zu kommen – ohne einen bestimmten Stempel ungültig ist. Ein gutes Drittel meines Heimatbesuchs verbringe ich mit der Jagd nach dem Gültigkeitsstempel. Auf dem Moskowskaja Ploschtschad, dem Moskauer Platz, mitten in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, werde ich von den gewaltigen Gebäuden der Stalin-Ära umzingelt. Ich bin mit der Vertreterin einer dubiosen Visumsagentur verabredet. Sie soll mir helfen, einen Hotelangestellten mit tausend Rubeln (damals etwa fünfunddreißig Dollar) zu bestechen, damit mein Visum vorschriftsmäßig gestempelt wird. Ich erwarte die Dame im schäbigen Foyer des Hotels Mir, dem «scheußlichsten Hotel der Welt», wie ich es ein paar Jahre später in meinem Artikel für das Reisemagazin Travel + Leisure nennen werde. Das Mir befindet sich, sollte ich hinzufügen, direkt bei der Tschesmensker Kirche.
Und plötzlich kriege ich keine Luft mehr.
Die Welt erstickt mich, das Land erstickt mich, der Pelzkragen meines Mantels drückt mir in mörderischer Absicht die Kehle zu. Statt «Ginger Ale im Schädel» wie bei Tony Soprano explodieren in mir Selters und Rum. Auf wackligen Beinen wanke ich zu einem neuen McDonald’s am nahegelegenen Platz, der nach wie vor von Lenins Statue gekrönt wird. Hier, zu Lenins Füßen, habe ich früher mit meinem Vater Verstecken gespielt. Im McDonald’s suche ich Zuflucht in der vertrauten fleischigen Midwest-Atmosphäre. Wenn ich Amerikaner bin – sprich unbesiegbar –, dann lass mich bitte jetzt unbesiegbar sein! Mach, dass die Panik aufhört, Ronald McDonald. Bring mich wieder zur Vernunft. Aber die Realität entgleitet mir weiter, während ich den Kopf auf einen kalten Fastfood-Tisch lege und um mich herum schwächliche Drittweltkinder mit Partyhütchen einen Wendepunkt im Leben des kleinen Sascha oder der kleinen Mascha feiern.
2003 habe ich im New Yorker darüber geschrieben und vermutet: «Meine Panik[attacke] war ein Ableger der Angst meiner Eltern zwanzig Jahre zuvor: der Angst, die Ausreise verweigert zu bekommen und ein sogenannter Verbotnik zu werden, wie man es damals nannte (wer mit dieser Bezeichnung gebrandmarkt wurde, durfte im ewigen Fegefeuer staatlich verordneter Arbeitslosigkeit vor sich hin schmoren). Ein Teil von mir glaubte tatsächlich, dass ich Russland nicht würde verlassen dürfen. Dass dies – ein endloser Betonplatz mit lauter unglücklichen, aggressiven Menschen in grauenhaften Lederjacken – den Rest meines Lebens darstellte.»
Aber so war es nicht, das weiß ich heute. Es ging weder um den Visumsstempel noch um die Bestechung oder den Verbotnik-Status, um nichts dergleichen.
Denn während sich die Welt im McDonald’s um mich dreht, versuche ich nur an eines nicht zu denken, nämlich an die Tschesmensker Kirche ganz in der Nähe. An die «irre Ansammlung zuckergussüberzogener Türmchen und Zinnen». Ich versuche, nicht wieder zum Fünfjährigen zu werden. Aber warum eigentlich nicht? Schaut uns an, mich und meinen Papa! Wir haben zwischen den Kirchturmspitzen etwas in die Luft steigen lassen. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Es ist ein Spielzeughubschrauber an einer Schnur, der zwischen den Turmspitzen herumsurrt. Und jetzt steckt er fest! Der Hubschrauber klemmt zwischen den Kirchturmspitzen fest, aber wir sind trotzdem glücklich, denn wir sind gut, besser als das hier, besser als das Land um uns herum! Ich glaube, das ist der glücklichste Tag meines Lebens.
Aber warum kriege ich Panik? Wieso verschwindet hinter meinen falschen weißen amerikanischen Zähnen eine Beruhigungspille?
Was geschah vor zweiundzwanzig Jahren bei der Tschesmensker Kirche?
Ich will nicht dorthin zurück. O nein, ganz bestimmt nicht. Was auch immer passiert ist, ich darf nicht daran denken. Wie gern wäre ich jetzt zu Hause in New York. Wie gern würde ich an meinem wackligen Flohmarktküchentisch sitzen, die amerikanischen Zähne in Mutters Einsvierzig-Kiewer-Koteletts schlagen und spüren, wie sich überall in meinem dummen kleinen Mund die widerlich buttrige Wärme ausbreitet.
Die Matrjoschka der Erinnerung fällt auseinander, und jedes Einzelteil führt zu etwas immer Kleinerem, während ich immer größer werde.
Vater.
Hubschrauber.
Kirche.
Mutter.
Pjotr Petrowitsch Hahnowitsch.
Türken am Strand.
Sowjetische Lügen.
Oberlin-Liebe.
Die Pyramiden von Prag.
Çeşme.
Das Buch.
Wieder stehe ich im Strand Book Annex auf der Fulton Street, in den Händen Sankt Petersburg: Architektur der Zaren, und die barocken Blautöne der Smolny-Kathedrale springen mir vom Buchdeckel entgegen. Ich schlage das Buch auf, zum ersten Mal, auf Seite neunzig. Ich blättere nochmals zu dieser Seite. Und ein weiteres Mal. Die dicke Seite wendet sich in meiner Hand.
Was geschah vor zweiundzwanzig Jahren bei der Tschesmensker Kirche?
Nein. Vergessen wir das. Lassen wir mich erst einmal in Manhattan, wo ich im Buchladen die Seite umblättere, unschuldig und naiv in meinem Büroangestelltenhemd, mit meinem affigen Künstler-Pferdeschwanz, meinen Träumen vom Schriftstellerdasein, meiner Liebe und Wut, die so glutrot in mir lodern wie eh und je. Wie schrieb mein Vater in seiner Abenteuergeschichte:
Fortsetzung folgt – zu Hause.
2.Auftritt Rotznase
Der Autor erfährt, dass die Brotschlange kein Lieferservice ist.
GEBURTSURKUNDE
–––––––––––––––
IGOR SHTEYNGART
5. Juli 1972
Liebe Eltern!
Wir gratulieren herzlich und freuen uns mit Ihnen über die Geburt eines neuen Menschen – eines Bürgers der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und Mitglieds der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft.
Wir wünschen Ihrer Familie Gesundheit, viel Liebe, Freundschaft und Harmonie.
Wir sind überzeugt, dass Sie Ihren Sohn zu einem gewissenhaften Arbeiter und treuen Patrioten unseres großen Vaterlandes erziehen werden!
Gezeichnet
Exekutivkomitee der
Arbeitervertretung des Leningrader Stadtrats
ICH WERDE GEBOREN.
Meine hochschwangere Mutter überquert eine Leningrader Straße, und ein Lkw-Fahrer hupt sie an, weil man schwangere Frauen nun mal gern erschreckt. Sie fasst sich an den Bauch. Die Fruchtblase platzt. Sie hastet zum Otto-Geburtshaus auf der Wassiljewski-Insel, einem wichtigen schwimmenden Anhängsel auf dem Leningrader Stadtplan, zu demselben Geburtshaus, in dem schon sie und ihre beiden Schwestern das Licht der Welt erblickten. (Russische Kinder werden nicht wie im Westen in richtigen Krankenhäusern geboren.) Mehrere Wochen zu früh purzle ich aus meiner Mutter heraus, Beine und Hintern voran. Ich bin lang und dünn und ähnele einem Dackel in Menschengestalt, allerdings mit einem Riesenschädel. «Gut gemacht!», loben die Krankenschwestern meine Mutter. «Du hast einen ordentlichen muschik zur Welt gebracht.» Ein muschik, ein stämmiger muskelbepackter russischer Mann, werde ich ganz sicher niemals werden, doch am meisten ärgert meine Mutter, dass die Krankenschwestern sie duzen und nicht siezen. Da ist sie empfindlich. Sie stammt aus gutem Elternhaus und ist keine dahergelaufene Jüdin (jewrejka), die man einfach duzen darf.
Das Otto-Geburtshaus. Für ein «Mitglied der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft» ist das jugendstilartige Gebäude ein ebenso guter Ort, um geboren zu werden, wie jeder andere in der Stadt oder im ganzen Land. Unter den Füßen meiner Mutter: ein kunstvoll gefliester Boden mit Wellen- und Schmetterlingsmotiven; über ihr: verchromte Kronleuchter; vor dem Fenster: die mächtigen Kollegiengebäude der Leningrader Staatsuniversität, erbaut unter Peter dem Großen, und ein beruhigendes Aufblitzen von russischem Immergrün inmitten der subarktischen Landschaft. Und in ihren Armen: ich.
Ich werde hungrig geboren. Heißhungrig. Ich will die Welt aufessen und werde nie satt. Brust, Kondensmilch, was immer man mir hinhält, ich nuckle daran, beiße hinein, schlucke es runter. Jahre später werde ich mich unter der Fürsorge meiner geliebten Großmutter Polja in ein Dickerchen verwandeln, aber noch bin ich dünn, schmächtig und heißhungrig.
Meine Mutter ist mit sechsundzwanzig für damalige Verhältnisse eine ziemlich alte Erstgebärende. Mein Vater ist dreiunddreißig und hat die Hälfte des Lebens bereits hinter sich – laut der lokalen Lebenserwartung für Männer. Meine Mutter gibt im Kindergarten Klavierunterricht; mein Vater ist Maschinenbauingenieur. Sie besitzen eine etwa fünfundvierzig Quadratmeter große Wohnung im Stadtzentrum von Leningrad und sind damit privilegiert; privilegierter jedenfalls, als wir es in den USA sein werden, auch wenn uns in den späten 1980ern ein kleines Haus im Kolonialstil in Little Neck, Queens, gehört.
Außerdem, und das werde ich im Laufe meines Lebens erst allmählich begreifen, sind meine Eltern zu verschieden für eine glückliche Ehe. Die Sowjetunion versteht sich zwar als klassenlose Gesellschaft, doch mein Vater ist unter schwierigen Bedingungen in einem Dorf aufgewachsen, während meine Mutter dem Petersburger Bildungsbürgertum entstammt. Das hat zwar seine eigenen Sorgen, aber die sind vergleichsweise lachhaft. Meine Mutter hält die Familie meines Vaters für primitiv und provinziell. Mein Vater findet ihre Verwandten hochnäsig und verlogen. Beide liegen nicht ganz falsch.
Meine Mutter sieht halb jüdisch aus, für damalige Verhältnisse viel zu jüdisch, aber sie ist hübsch, auf eine kompakte, handfeste Weise; über ihrem besorgten Gesicht und dem Rollkragenpullover sitzt die dezent toupierte Frisur, die Mundwinkel sind immer zu einem Lächeln bereit, das meistens ihrer Familie gilt. Leningrad ist ihre Stadt, so wie auch New York es bald sein wird. Sie weiß, wo es manchmal Hühnerkoteletts gibt und vor Buttercremefüllung überquellendes Gebäck. Sie dreht jede Kopeke zweimal um, und als die Kopeken in New York zu Cent werden, dreht sie diese sogar dreimal um. Mein Vater ist nicht groß, aber auf düster-levantinische Art gutaussehend, und sehr darauf bedacht, in Form zu bleiben – seiner Ansicht nach ist körperliche Ertüchtigung die einzige Rettung vor einem Geist, der ständig um sich selbst kreist. Bei meiner Hochzeit viele Jahre später wird nicht nur ein Gast scherzhaft bemerken, wie erstaunlich es sei, dass ein so blendend aussehendes Paar mich hervorgebracht hat. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Das Blut meiner Eltern hat sich in mir nicht gut vermischt.
Väter dürfen nicht mit ins Otto-Geburtshaus, doch in den zehn Tagen der Trennung erfasst meinen Vater das starke (wenn auch nicht unbedingt einzigartige) Gefühl, dass er nicht mehr allein auf der Welt ist und dass er in meiner Nähe sein muss. Während meiner ersten Jahre als Erdenbürger wird er diesem Gefühl, nennen wir es Liebe, gekonnt und energisch Ausdruck verleihen. Die anderen Bereiche seines Lebens – eine wenig aufregende Arbeit bei der bekannten Kamerafabrik LOMO, wo er große Teleskope fertigt, und seine zerplatzten Träume von einer Karriere als professioneller Opernsänger – verlieren an Bedeutung, während er versucht, das kaputte Kind in seinen Armen zu reparieren.
Aber er muss sich beeilen!
Im Otto-Geburtshaus werden die Neugeborenen immer noch stramm in Tücher eingewickelt, und meine Dackelgestalt bekommt eine riesige blaue Schleife (bant) um den Hals. Als uns das Taxi vom Geburtshaus nach Hause gebracht hat, sind meine Lungen so gut wie luftleer und mein merkwürdiger Riesenschädel fast so blau wie die Schleife, die mich stranguliert.
Ich werde wiederbelebt, aber einen Tag später fange ich an zu niesen. Meine besorgte Mutter (mal sehen, wie oft die Wörter «besorgt» und «Mutter» in diesem Buch dicht beieinanderstehen) ruft in der örtlichen Poliklinik an und verlangt nach einer Krankenschwester. Das Bruttoinlandsprodukt der Sowjetunion beträgt nur ein Viertel des amerikanischen, doch hier machen Ärzte und Krankenschwestern noch Hausbesuche. Eine bullige Frau kommt an unsere Tür. «Mein Sohn niest, was soll ich tun?», fragt meine Mutter kurz vorm Hyperventilieren.
«Sagen Sie ‹Gesundheit!›», rät die Krankenschwester.
In den kommenden dreizehn Jahren – bis zu meiner Bar-Mizwa in einem kratzigen Anzug in der Ezrath-Israel-Synagoge in den Catskill Mountains – leide ich an Asthma. Meine Eltern ängstigen sich oft fast zu Tode, und ich mich auch.
Aber mich umgibt auch die unerbetene, eigenartig schöne Tröstlichkeit und Geborgenheit, mit der sich ein krankes Kind in eine Festung aus Kissen und Bettdecken hineinsinken lassen kann – diese absurd dicken sowjetischen Decken, aus denen verlässlich die usbekische Baumwollfüllung quillt. Aus den Heizkörpern wummert eine Bullenhitze, und auch meine eigene muffige Kinderwärme zeigt mir, dass ich mehr als bloß ein Behälter für den Schleim meiner Lungen bin.
Ist das meine erste Erinnerung?
Die frühesten Jahre, die wichtigsten, sind die schwierigsten. Aus dem Nichts aufzutauchen braucht seine Zeit.
Daran meine ich mich zu erinnern:
Mein Vater oder meine Mutter wacht die ganze Nacht an meinem Krankenbett und hält mir mit einem Esslöffel den Mund auf, damit ich nicht am Asthma ersticke und Luft in meine Lunge gelangt. Mutter liebevoll besorgt. Vater liebevoll besorgt, aber traurig. Und verängstigt. Ein Mann vom Dorf, ein kleiner, aber kräftiger muschik, dem man ein schlecht funktionierendes Lebewesen vorgesetzt hat. Meinem Vater zufolge lösen sich die meisten Probleme durch einen beherzten Sprung in einen eiskalten See, aber hier gibt es keinen See. Seine warme Hand streichelt mitleidig über den feinen Haarflaum auf meinem Hinterkopf, und er kann seine Enttäuschung kaum verbergen, als er zu mir sagt: «Ach, ty, sopljak.» Ach, du Rotznase. Da mein Asthma in den folgenden Jahren nicht verschwindet, höre ich die Wut und Enttäuschung aus seiner Bemerkung immer deutlicher heraus und sehe, wie sich seine vollen Lippen verziehen, während sich der Satz in seine Bestandteile zerlegt:
Ach.
Seufz.
Du.
Kopfschütteln.
Rotznase.
Aber noch bin ich nicht tot! Mein Hunger ist groß. Und er verlangt nach Fleisch. Doktorskaja kolbasa, ein weicher russischer Mortadella-Ersatz; und als meine Zähne härteren Herausforderungen gewachsen sind: wetschina, russischer Schinken, und buschenina, gefährlich zäher Schweinebratenaufschnitt, dessen Geschmack einem stundenlang auf der Zunge liegt. Solche Lebensmittel sind nicht leicht zu beschaffen; selbst die Aussicht auf stinkenden, tagealten Fisch lockt Hunderte Menschen in eine Schlange, die sich unter dem glanzlosen rosa Morgenhimmel bis um die nächste Straßenecke zieht. Die optimistische «Tauwetterstimmung» unter Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow ist längst verflogen, und unter der zunehmend starren Führung des komischen Tattergreises Leonid Breschnew beginnt die Sowjetunion ihren rapiden Abstieg ins Bodenlose. Doch ich habe einen unbändigen Appetit auf meine Fleischwaren und dazu mehrere Löffel sguschtschonka, Kondensmilch aus den kultigen blauen Konservendosen. «Milch, vollfett, kondensiert, gezuckert» waren vermutlich die ersten russischen Worte, die ich zu lesen versuchte. Nach den berauschenden kolbasa-Nitriten spendet mir meine Mutter etwas von diesem süßen Segen. Jeder Liebesbeweis bindet mich an sie, an sie beide, und jeder nachfolgende Verrat und jede Fehlentscheidung festigen die Bindung noch. So sieht das erstickend enge russisch-jüdische Familienmodell aus, das nicht allein unserer Art vorbehalten ist. Doch hier in der Sowjetunion, wo die Freiräume und die Vorräte an Fleischwurst und Kondensmilch begrenzt sind, wird es noch verstärkt.
Ich bin ein neugieriges Kind, und nichts erregt meine Neugier so sehr wie die Steckdose. Für mich ist es das Größte, die Finger in die beiden schmuddligen Löcher zu stecken (gern geschehen, liebe Freudianer) und die Wucht einer Kraft zu spüren, die lebendiger ist als ich. Meine Eltern erzählen mir, in der Steckdose wohne djadja tok – Onkel Elektrischer Strom, ein böser Mann, der mir weh tun wolle. Djadja tok gehört neben meinen Fleischvokabeln (wetschina, buschenina, kolbasa) und sopljak zu den ersten Worten, die ich in der mächtigen russischen Sprache lerne. Hinzu kommt mein Urschrei «Jobtiki matj!», ein kindlicher Versprecher von Job twoju matj oder «Fick deine Mutter!», was ein hübsches Licht auf die Beziehungen zwischen meinen Eltern und ihren beiden Familien wirft.
Meinem Hunger und meiner Neugier stehen ebenbürtig meine Sorgen gebenüber. Erst fünf Jahre später kann ich den Tod als das Ende des Lebens formulieren, aber meine Unfähigkeit zu atmen ist schon mal ein guter Vorgeschmack. Die Atemnot macht mich nervös. Sollte Atmen nicht selbstverständlich sein? Man atmet ein, dann atmet man aus. Dafür muss man kein Genie sein. Und ich versuche es. Aber es funktioniert nicht. Meine innere Maschine quietscht vor sich hin, und es kommt nichts dabei heraus. Andere Kinder kenne ich nicht, ich habe also keinen Vergleich, aber ich weiß auch so, dass mit mir als Junge überhaupt nichts stimmt.
Und wie lang wollen mir die beiden Wesen noch mit einem Esslöffel den Mund aufsperren? Ich spüre, dass sie Höllenqualen leiden.
Es gibt eine Aufnahme von mir mit einem Jahr und zehn Monaten aus einem Fotostudio. Darauf trage ich eine Art Strumpfhose mit einem aufgestickten Hasen auf der Vordertasche, halte einen Telefonhörer in der Hand (stolz präsentiert das Fotostudio diese fortschrittliche sowjetische Technologie) und sehe aus, als würde ich gleich losplärren. Mein Gesichtsausdruck ähnelt dem einer Mutter im Jahr 1943, der soeben ein verhängnisvolles Telegramm von der Front übermittelt wurde. Das Fotostudio macht mir Angst. Das Telefon macht mir Angst. Alles außerhalb unserer Wohnung macht mir Angst. Die Menschen mit ihren großen Pelzmützen machen mir Angst. Der Schnee macht mir Angst. Die Kälte macht mir Angst. Die Hitze macht mir Angst. Der Deckenventilator macht mir Angst; ich pflege dramatisch mit dem Finger auf ihn zu zeigen und in Tränen auszubrechen. Alles, was höher ist als mein Krankenlager, macht mir Angst. Onkel Elektrischer Strom macht mir Angst. «Warum hatte ich vor allem so große Angst?», frage ich meine Mutter fast vierzig Jahre später.
«Weil du als jüdischer Mensch geboren wurdest», sagt sie.
Mag sein. Das Blut in meinen Adern stammt hauptsächlich von den Jasnizkis (meine Mutter) und den Shteyngarts (mein Vater), aber die Krankenschwestern im Otto-Geburtshaus haben dem noch 10, 20, 30, 40 Kubikzentimeter Stalin, Beria, Hitler und Göring hinzugefügt.
Und es gibt noch ein wichtiges Wort: tigr. Meine frühe Kindheit wird nicht durch Spielsachen oder Lernspielzeug, wie man es heute nennt, bereichert, aber ich habe meinen Tiger. Das Standardgeschenk für eine junge Mutter in Russland im Jahr 1972 besteht aus einem Stapel Baumwollwindeln. Als die Kolleginnen meiner Mutter herausfinden, dass sie in einem der schicken neuen Häuser am Newa-Ufer wohnt – heute sehen diese Gebäude mit ihren mehrfarbigen drangeklatschten Holzbalkonen aus, als gehörten sie in einen heruntergekommenen Stadtteil von Mumbai –, beschließen sie, dass Windeln nicht angemessen sind. Also kratzen sie achtzehn Rubel für ein Luxusgeschenk zusammen und kaufen einen Stofftiger. Tiger ist vier Mal so groß wie ich, genau richtig orange, seine Schnurrhaare sind so dick wie meine Finger, und sein Gesichtsausdruck sagt: Ich will dein Freund sein, Rotznase. Mit allem akrobatischen Geschick, das ein kränklicher Junge aufbringen kann, klettere ich über ihn hinweg, so wie ich noch viele Jahre über den Brustkorb meines Vaters krabbeln werde, und wie bei meinem Vater ziehe ich an Tigers runden Ohren und kneife ihn in die dicke Nase.
Ich würde gern noch mehr Erinnerungen einfangen und hier ausstellen, aber leider bin ich mit meinem Kescher nicht schnell genug. Unter der Aufsicht meiner Großmutter (väterlicherseits) Polja falle ich aus dem Kinderwagen und lande kopfüber auf dem Asphalt. Vermutlich ist das der Grund für meine bis heute andauernden Lern- und Koordinationsprobleme (wer mir auf der Route 9G entgegenkommt, sollte aufpassen!). Ich lerne zwar laufen, aber besonders sicher werde ich nicht. Während eines Sommerurlaubs auf einem Bauernhof in Lettland stolpere ich mit ausgebreiteten Armen auf ein Huhn zu und bücke mich, um es zu umarmen. Tiger ist immer nett zu mir, was sollte mir dieses kleinere bunte Tier also anhaben? Das lettische Huhn schüttelt seinen Kamm, kommt auf mich zu und hackt nach mir. Vielleicht aus politischen Erwägungen. Schmerz und Verrat, Geheul und Tränen. Erst Onkel Elektrischer Strom und jetzt baltisches Geflügel. Die Welt ist hart und rücksichtslos, und verlassen kann man sich nur auf seine Familie.
Und dann strömen die Erinnerungen auf mich ein. Und ich werde der, der ich schon immer sein sollte. Das heißt: ein Liebender. Fünf Jahre alt und bis über beide Ohren verliebt.
Sein Name ist Wladimir.
Aber das muss noch warten.
3.Ich bin immer noch der Große
Ein Familienalbum
1940 in der Ukraine. Der Vater des Autors sitzt in der vordersten Reihe, zweiter von links, auf dem Schoß der Großmutter des Autors. So gut wie alle anderen werden bald sterben.
Thanksgiving 2011. Ein zweistöckiges Kolonialhäuschen in Little Neck, Queens. Was ein klassenbesessener Brite vielleicht als mittlere Mitte der Mittelschicht bezeichnen würde. Meine kleine Familie hat sich um einen orange glänzenden Mahagonitisch versammelt – ein rumänisches Produkt aus der Ceauşescu-Ära, das wir wider jede Vernunft aus Leningrad mitgeschleppt haben –, auf dem meine Mutter gleich einen knoblauchtriefenden Truthahn servieren wird, der bis zum Augenblick der Präsentation unter seiner Frischhaltefolie vor sich hin gurgelt, und einen Nachtisch aus einem Dutzend Matzen, je einer Gallone Sahne und Amarettolikör und einem Eimer Himbeeren. Ich glaube, meine Mutter hatte einen mille-feuille im Sinn, einen Blätterteigkuchen, oder dessen russische Schichtkuchen-Variante: die Napoleontorte. Herausgekommen ist eine vom Pessachfest inspirierte Süßspeisenverirrung. Wegen seiner ursprünglichen Herkunft nennt meine Mutter es gern ihr «französisches Dessert».
«Aber das Beste sind die Himbeeren – die habe ich selbst angepflanzt!», brüllt mein Vater. Mit zurückhaltendem Schweigen kann man in dieser Familie nicht punkten; in unserer Mischpoche reißt immer irgendwer das Mikrophon an sich. Wir sind eine Sippe gekränkter, nach Gehör gierender Narzissten. Wenn überhaupt jemand zuhört, dann ich – nicht, weil ich meine Eltern liebe (dabei liebe ich sie, oh, und wie entsetzlich ich sie liebe), sondern weil das meine Aufgabe ist.
Mein Vater hechtet auf meinen Cousin zu, täuscht einen Boxhieb in die Magengrube an und brüllt: «Ich bin immer noch der Große!» Der Große zu sein ist ihm wichtig. Vor ein paar Jahren, noch betrunken anlässlich seines siebzigsten Geburtstags, nahm er meine damalige Freundin (und heutige Ehefrau) mit in den Gemüsegarten und drückte ihr seine größte Gurke in die Hand. «Zur Erinnerung an mich», sagte er und fügte augenzwinkernd hinzu: «Ich bin groß. Mein Sohn ist klein.»
Tante Tanja, die Schwester meiner Mutter, schwadroniert über den Grafen Tschemodanin, der ihrer Überzeugung nach zu unseren Vorfahren gehörte. Tschemodan ist das russische Wort für «Koffer». Tante Tanja zufolge war Graf Koffer eine illustre Gestalt im alten Russland: ein treuer Brieffreund seines gräflichen Gefährten Leo Tolstoi (der allerdings selten zurückschrieb), Denker, Ästhet und – wenn schon, denn schon – wegweisender Mediziner. Mein Cousin, ihr Sohn, immer kurz davor, sein Jurastudium aufzunehmen (so wie ich in seinem Alter), den ich wirklich mag und um den ich mich sorge, spricht in perfektem Englisch und verwirrendem Russisch erregt über die Aussichten des libertären Präsidentschaftskandidaten Ron Paul.
«Wir sind eine gute, normale Familie», verkündet meine Mutter meiner Verlobten unvermittelt.
«Und natürlich war Graf Koffer obendrein ein brillanter Arzt», setzt Tante Tanja nach, während sie dem «französischen Dessert» meiner Mutter mit einem Teelöffel zu Leibe rückt.
Ich geselle mich zu meinem Vater auf die Couch im Wohnzimmer, wo er Zuflucht vor der Großfamilie sucht. Alle paar Minuten stürmt Tante Tanja mit ihrer Kamera herein und schreit: «Los, rutscht näher zusammen! Vater und Sohn, ja? Vater und Sohn!»
Mein Vater wirkt noch trübsinniger und gekränkter als gewöhnlich. Heute weiß ich, dass ich nicht der einzige Grund für seinen Missmut bin. Mein Vater ist sehr stolz auf seine Figur, bemängelt hingegen meine, doch an diesem Thanksgiving wirkt er nicht ganz so gertenschlank und athletisch wie sonst. Er ist graubärtig und klein, keinesfalls dick, er wiegt, was ein Dreiundsiebzigjähriger, der kein burmesischer Bauer ist, wiegen sollte. Früher am Abend hatte der Schwiegervater meiner Cousine Viktoria, einer der wenigen Amerikaner, die unser durch und durch russisches Familienensemble dankenswerterweise verdünnen, ihn in den Bauch gepikt und gesagt: «Na, Semjon, hortest du da schon deinen Wintervorrat?» Ich wusste, mein Vater würde die Beleidigung hinunterschlucken und innerhalb von zwei Stunden zu Wut verdauen («Ich bin immer noch der Große!»), zu der Wut und dem Humor, die unser Haupterbe sind.
Im Fernsehen läuft der russische Kabelkanal; Werbespots für dubiose Zahnarztpraxen in Brooklyn und neue Hochzeitssäle in Queens tun alles, um Freude zu versprühen. Ich spüre, wie sich der Blick meines Vaters in meine rechte Schulter bohrt. Ganz egal, wo ich auf der Welt bin, den Blick meines Vaters spüre ich immer.
«Ich habe keine Angst vor dem Tod», sagt er ohne jeden Anlass. «Gott hat ein Auge auf mich.»
«Mhm», muhe ich. Eine neue russische Seifenoper, die in der Stalinzeit spielt, fängt gerade an, und ich hoffe, unser Gespräch in eine andere Richtung lenken zu können. Als wir frisch in Amerika angekommen waren, machte mein Vater mit mir ausgiebige Spaziergänge durch das grüne Kew Gardens in Queens und versuchte, mir die Geschichte russisch-jüdischer Beziehungen anhand einer mehrteiligen Erzählung näherzubringen, die er Der Planet der Juden nannte. Sobald ich merke, dass er in den Kaninchenbau der Depression zu stürzen droht – meistens geht dem eine gewalttätige oder phallische Handlung voraus (Stichwort Gurke) –, versuche ich, unser Gespräch in die Vergangenheit zu lenken, als keiner von uns an irgendetwas schuld war.
«Das ist ja interessant», kommentiere ich die Sendung in meinem schönsten amerikanischen Hey-lass-uns-Freunde-sein-Tonfall. «Was meinst du, in welchem Jahr das gedreht wurde?»
«Erwähne in dem Buch, das du gerade schreibst, nicht die Namen meiner Verwandten», sagt mein Vater.
«In Ordnung.»
«Schreib bloß nicht wie ein Jude voller Selbsthass.»
Lautes Gelächter aus dem Esszimmer: meine Mutter und ihre Schwester in ihrem typischen Frohsinn. Anders als mein Vater, ein Einzelkind, kommen Mama und Tante Tanja aus einer verhältnismäßig großen Familie mit drei Töchtern. Tanja neigt zu übertriebener Herzlichkeit und ist der befremdlichen amerikanischen Überzeugung, etwas Besonderes zu sein, aber immerhin wirkt sie nicht depressiv. Meine Mutter besitzt die beste Sozialkompetenz in der Sippe; sie weiß genau, wann sie jemanden in ihren Kreis holen und wann sie ihn wieder loswerden muss. Wäre sie zur richtigen Zeit im amerikanischen Süden geboren, hätte sie es bestimmt weit gebracht.
«Da, poschjol on na chuj!», überdröhnt Tanja, die jüngste Schwester, das Dröhnen des Fernsehers. Ja, soll er sich doch zum Schwanz scheren! Und meine Mutter lacht dreckig wie ein mittleres Kind, überglücklich, dass ihre Schwester hier in Amerika ist und sie jemanden hat, mit dem sie chuj und job und bljad sagen kann. Die sieben Jahre Trennung – Tanja durfte Russland erst nach Gorbatschows Machtübernahme verlassen – waren für meine Mutter unerträglich. Und da ich während meiner Kindheit eine Art Seismograph für die Ängste, Enttäuschungen und Entfremdungen meiner Eltern war, war die Trennung der Schwestern auch für mich unerträglich.
«Ich habe keine Freunde», reagiert mein Vater auf das Gelächter aus dem Esszimmer. «Deine Mutter will sie nicht hier haben.» Der erste Satz stimmt zweifellos. Der zweite macht mich neugierig.
«Wieso denn nicht?», frage ich.
Statt einer Antwort seufzt er. Er seufzt so viel, dass ich den Verdacht habe, er praktiziert ungewollt seine eigene kabbalistische Meditation. «Möge Gott ihr beistehen.»
Neben meinem Vater liegt eine Videokassette mit dem Titel Einwanderung: Gefahr für den Zusammenhalt unserer Nation: Teil II: Betrug und Verrat in Amerika, produziert von einer Gruppe namens «American Patrol» aus Sherman Oaks, Kalifornien. (Warum stehen Rechtsextreme so auf Doppelpunkte?) Ich frage mich, was die schießwütigen Mitglieder der amerikanischen Patrouille wohl von meinem Vater halten würden – einem semitischen Typen, der wie Osama bin Laden aussieht, im multikulti Stadtteil von Queens auf seiner Couch sitzt und Sozialhilfe kassiert, in dessen Küche es nach Einwandererfisch stinkt und der eine koreanische Familie und einen indischen Clan als Nachbarn hat.
«Wir leben verschiedene Leben», sagt mein Vater weise. «Und das macht mich traurig.»
Mich macht es auch traurig. Aber was soll man tun? Früher habe ich offener mit meinem Vater gesprochen und ihn folglich gehasst. Jetzt weiß ich, wie sehr ich ihn mit jedem veröffentlichten Buch treffen kann – und treffe –, das kein Loblied auf den Staat Israel singt, mit jeder Aussage im öffentlichen Rundfunk, in der ich nicht meinen Bund mit seinem glorreichen Gott beschwöre. Bringt es mich um, frage ich mich, wenn ich ihm hier und jetzt sage: Du bist immer noch der Große, Papa?
Ich werde immer der Kleine sein, und du bist der Große.
Wäre dann alles wieder gut zwischen uns? Ich sehe noch, wie er vorhin am Esstisch, bevor seine Depression zuschlug, berauscht von familiärer Verbundenheit und einem Schluck Wodka, zu mir eilte, um mich als Ersten zu bedienen, wie er mir die Pilzsuppe mit besonders viel Zwiebeln auftat, die er extra für mich gemacht hatte. «Saure Sahne?», fragte er mich. «Ja, bitte.» «Brot? Wodka? Gurke?» Ja, ja und ja, Papa. Die übrigen Tischgäste schienen für ihn gar nicht zu existieren.
«Er liebt dich so sehr», sagte eine Freundin, die ich zum Familienessen mitgebracht hatte, einmal zu mir, «er weiß bloß nicht, wie er seine Liebe zeigen soll. Alles, was er tut und sagt, kommt falsch rüber.»
Ich möchte bei ihm bleiben und dafür sorgen, dass er sich besser fühlt. Ich möchte die russische Sendung im Fernsehen zu Ende gucken. Möchte die Gurken aufessen und die Suppe, vollgestopft mit Pilzen, die er in einem dichten Wald im New Yorker Umland selbst geerntet hat. «Im Geschäft würde jeder Pilz vierzig Dollar kosten!», kreischte meine Mutter, weil mein Cousin nicht von der pilzsatten Suppe probieren wollte. «Und er isst nichts davon!»
Ich möchte eine Familie haben. Ich möchte lachen und begeistert sein von Tante Tanjas postmodernem Thanksgiving-Trinkspruch à la Bringen-wir’s-hinter-uns-und-fangen-endlich-richtig-an-zu-trinken: «Gott segne Amerika, oder wie auch immer.»
Ich möchte da sein, wenn meine Mutter, die immer alles im Griff hat, sich beim Zubereiten ihres «französischen Desserts» dreimal in den Finger schneidet. Zittern ihre Hände? Sieht sie nicht mehr gut? Sie wirkt heute so müde. Erholt sie sich rechtzeitig zu ihrem manischen Ausbruch von Sorge und Putzwut, der bis in die Nacht andauern wird? Hat Gott ein Auge auf uns?
Ich möchte die Augen schließen und spüren, wie der geballte Wahnsinn um den Tisch herumwirbelt, denn dieser Wahnsinn hat sich auch auf meine Schultern gesenkt.
Aber gleichzeitig will ich nach Hause. Nach Manhattan. In die sorgsam gestaltete, unaufdringliche Wohnung, die ich mir hergerichtet habe, auch um zu beweisen, dass die Vergangenheit nicht die Zukunft ist und dass ich mein eigener Herr bin. Dieses Bekenntnis habe ich mir selbst gegeben: Stunde null. Ein Neuanfang. Den Zorn im Zaum halten. Versuchen, die Wut vom Humor zu trennen. Über Dinge lachen, die nicht dem Schmerz entspringen. Du bist nicht sie. Er ist nicht du. Und jeden Tag, egal ob in An- oder Abwesenheit meiner Eltern, erweist sich mein Credo als Kokolores.
Die Vergangenheit verfolgt uns. Ob in Queens oder Manhattan, sie überschattet uns, boxt uns in den Bauch. Ich bin klein, und mein Vater ist groß. Aber die Vergangenheit – die ist am größten.
Fangen wir mit meinem Nachnamen an: Shteyngart. Ein deutscher Name, dessen wahnwitzige sowjetisierte Schreibweise mit ihrer zu Tränen treibenden Konsonantenballung (fehlt bloß ein i zwischen dem h und dem t für ein schönes «Shit») und allgemeinen Unattraktivität mich viel menschliche Wärme gekostet hat. «Mister, äh, das kann ich nicht aussprechen … Shit … Shit … Shitfart?», kichert das reizende Mädchen aus Alabama an der Hotelrezeption. «Genügt Ihnen ein Einzelbett?»
Was glaubst du denn, Herzchen, möchte ich sagen. Glaubst du vielleicht, jemand möchte sich zu einem Shitfart ins Bett legen?
Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, mir das orthographisch verstümmelte «Shteyngart» nicht als grässlich stinkendes Abfallprodukt der Geschichte vorzustellen. Richtig geschrieben müsste der Name «Steingarten» lauten – ein wunderschöner jüdisch-deutscher Zen-Name, der heitere Gelassenheit und Friedlichkeit suggeriert, wie sie meine jüdischen Vorfahren in ihrem kurzen explosiven Leben sicherlich nie erlebt haben. Steingarten. Schön wär’s.
Vor kurzem habe ich allerdings von meinem Vater erfahren, dass «Shteyngart» gar nicht unser Name ist. Ein Schreibfehler aus der Hand eines sowjetischen Bürokraten, eines betrunkenen Notars, eines quasi analphabetischen Kommissars, wer weiß, jedenfalls bin ich eigentlich nicht Gary Shteyngart. Mein Familienname lautet: Steinhorn. Horn aus Stein. Und da ich eigentlich Igor heiße – Gary haben wir mich in Amerika nur genannt, um mir zumindest ein paar Prügel zu ersparen –, hätte meine Leningrader Geburtsurkunde eigentlich den neuen Erdenbürger «Igor Steinhorn» willkommen heißen müssen. Neununddreißig Jahre lang habe ich nicht gewusst, dass ich in Wahrheit zum bayerischen Pornostar bestimmt war, aber es drängen sich noch weitere Fragen auf: Wenn weder «Gary» noch «Shteyngart» mein richtiger Name ist, warum zum Teufel nenne ich mich dann Gary Shteyngart? Ist jede Zelle meines Körpers eine historische Lüge?
«Schreib bloß nicht wie ein Jude voller Selbsthass», raunt mir mein Vater ins Ohr.
Familie Steinhorn lebte in der ukrainischen Stadt Tschemirowez, wo der Großvater meines Vaters (väterlicherseits) in den 1920ern ohne Grund umgebracht wurde. Die Großmutter meines Vaters musste sich und ihre fünf Kinder fortan allein durchbringen. Es gab nicht genug zu essen. Wer konnte, zog hinauf nach Leningrad, die Hauptstadt des ehemaligen Kaiserreiches und zweitwichtigste Metropole, nachdem die Bolschewiken Moskau zur Hauptstadt bestimmt hatten. Doch auch dort starben die meisten von ihnen. Die Steinhorns waren eine tiefreligiöse Familie, aber die Sowjets nahmen ihnen den Glauben und alles, was dann noch übrig war.
Familie Miller auf mütterlicher Seite meines Vaters lebte im ukrainischen Nachbardorf Orinin, das knapp eintausend Einwohner zählte. Mein Vater reiste in den 1960er-Jahren einmal nach Orinin. Mit ein paar Juden, die ihn gastfreundlich aufnahmen, konnte er über den Völkermord sprechen. Ich selbst habe keine Schtetl-Pilgerfahrt unternommen. Ich