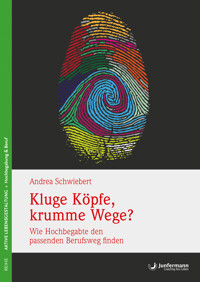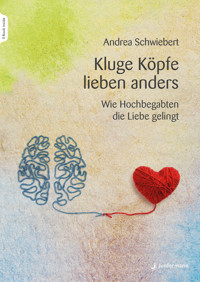
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hochbegabung und Liebe Wie gelingt Hochbegabten die Liebe, und zwar die Liebe zu sich selbst, zu (einem) anderen Menschen und zum Leben allgemein? Aufgrund ihrer vielen Gedanken, intensiven Gefühle und hohen Ansprüche wird die Liebe für Hochbegabte oft zu einer großen Herausforderung. Selbstzweifel, Perfektionismus und die Erfahrung, in den Augen anderer "falsch" zu sein, erschweren ihnen häufig eine gesunde Selbstliebe. Einen geliebten Menschen auf Augenhöhe zu finden gerät schnell zur Suche nach der "Nadel im Heuhaufen", und in Partnerschaften fällt ihnen eine stimmige Balance aus Nähe und Autonomie oft schwer. Auch die "Lebensliebe" wird bei vielen Hochbegabten immer wieder durch Sinnkrisen und Depressionen erschüttert. Dabei sind sie zugleich oft zu tiefer Liebe und intensivem Glücksempfinden fähig. Andrea Schwiebert ermutigt hochbegabte Menschen dazu, auch in der Liebe im Einklang mit sich selbst zu leben und individuelle Wege zu gelingender Kommunikation und zu mehr Verbundenheit mit sich selbst, mit anderen Menschen und mit dem Leben zu entdecken, die häufig außerhalb der Norm zu finden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Andrea SchwiebertKluge Köpfe lieben andersWie Hochbegabten die Liebe gelingt
Über dieses Buch
Hochbegabung und Liebe
Wie gelingt Hochbegabten die Liebe, und zwar die Liebe zu sich selbst, zu (einem) anderen Menschen und zum Leben allgemein?
Aufgrund ihrer vielen Gedanken, intensiven Gefühle und hohen Ansprüche wird die Liebe für Hochbegabte oft zu einer großen Herausforderung. Selbstzweifel, Perfektionismus und die Erfahrung, in den Augen anderer „falsch“ zu sein, erschweren ihnen häufig eine gesunde Selbstliebe. Einen geliebten Menschen auf Augenhöhe zu finden gerät schnell zur Suche nach der „Nadel im Heuhaufen“, und in Partnerschaften fällt ihnen eine stimmige Balance aus Nähe und Autonomie oft schwer. Auch die „Lebensliebe“ wird bei vielen Hochbegabten immer wieder durch Sinnkrisen und Depressionen erschüttert. Dabei sind sie zugleich oft zu tiefer Liebe und intensivem Glücksempfinden fähig.
Andrea Schwiebert ermutigt hochbegabte Menschen dazu, auch in der Liebe im Einklang mit sich selbst zu leben und individuelle Wege zu gelingender Kommunikation und zu mehr Verbundenheit mit sich selbst, mit anderen Menschen und mit dem Leben zu entdecken, die häufig außerhalb der Norm zu finden sind.
© Nicola-Skiba
Andrea Schwiebert hat sich seit vielen Jahren auf die Beratung und Begleitung hochbegabter Erwachsener in Berufs- und Lebensfragen spezialisiert. Sie ist Systemische Beraterin und Sozialtherapeutin und lebt in Münster.
Copyright: © Junfermann Verlag, Paderborn 2023
Coverfoto: © TanyaJoy (https://www.istockphoto.com)
Covergestaltung / Reihenentwurf: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Satz, Layout & Digitalisierung: Junfermann Druck & Service GmbH & Co. KG, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsjahr dieser E-Book-Ausgabe: 2023
ISBN der Printausgabe: 978-3-7495-0400-8
ISBN dieses E-Books: 978-3-7495-0401-5 (EPUB), 978-3-7495-0402-2 (PDF).
Einleitung
Lieben außergewöhnlich kluge und sensible Menschen wirklich „anders“, so, wie es im Titel dieses Buches behauptet wird?
Hochbegabte sind Menschen wie alle anderen, die sich nach Gesehenwerden, Angenommensein, Liebe, Leidenschaft und Sinn im Leben sehnen. Ihre Bedürfnisse sind also nicht ungewöhnlich. Aber die Erfüllung dieser Bedürfnisse kann durch die Begabung erschwert sein: Denn Hochbegabte – als Menschen, die aus der Norm fallen – machen andere Erfahrungen mit sich und der Welt als die meisten Menschen. Und so haben sie es auch in Sachen Liebe mit besonderen Herausforderungen und ungewöhnlichen Wegen zu tun – und lieben also „anders“.
Die Frage, wie Hochbegabten die Liebe gelingt, hat mich über die Jahre immer mehr fasziniert. Dazu gehört aus meiner Sicht nicht ausschließlich der Blick auf romantische oder erotische Liebe, sondern ebenso wichtig sind gelingende freundschaftliche, familiäre oder sonstige Beziehungen. Wichtige Basis für all dies ist ein ausreichendes Maß an „Selbstliebe“ und an „Lebensliebe“.
Als Beraterin für hochbegabte Erwachsene übersetze ich „Hochbegabung“ nicht einfach mit Hochintelligenz oder einem festgestellten IQ, sondern sie umfasst für mich viel mehr als das. Mit diesem ganzheitlichen Blick schaue ich gemeinsam mit meinen Klient:innen auch auf ihr Leben, in dem es nie ausschließlich um Leistung und Erfolg geht, sondern vor allem auch um Gefühle und Beziehungen. Meine Klient:innen berichten mir oft sehr offen von ihren familiären, freundschaftlichen und kollegialen Beziehungen, ihrem Liebesleben, ihren Selbstzweifeln und seelischen Krisen. So unterschiedlich dabei ihre Anliegen sind: Das Ziel ist eigentlich immer, sich geliebt und mit sich selbst, der Welt und anderen Menschen verbunden zu fühlen.
Genau dieses Gefühl des Verbundenseins kann Hochbegabten, auch dann, wenn sie in einer Partnerschaft leben, einen stabilen Freundeskreis haben oder im Beruf Anerkennung genießen, leider in vielen Fällen fehlen. Oft kennen sie die Erfahrung, sich inmitten von Menschen einsam zu fühlen. Und dies obwohl – oder gerade weil – sie meist zu besonders intensiven Gefühlen fähig sind, also auch zu tief empfundener Liebe.
Hochbegabte weichen in allen Bereichen rund um Liebe (wie auch in anderen Lebensbereichen) häufiger von der Norm ab. In der Art und Weise, wie sie dies tun, unterscheiden sie sich dann allerdings wieder sehr voneinander. Von Eigenwilligkeit und Experimentierfreude über lebenslange Treue bis hin zum dauerhaften Single-Leben: Die Liebesbeziehungen Hochbegabter sind natürlich ganz unterschiedlich. Genauso unterscheiden sie sich auch darin, wie sehr sie sich selbst annehmen können, wie sie ihre Freundschaften leben oder wie es um ihre Zufriedenheit mit dem Leben bzw. um ihre psychische Stabilität bestellt ist. Das ist klar, denn natürlich gibt es nicht „den“ oder „die“ typische:n Hochbegabte:n.
Je mehr ich mich mit den Erfahrungen Hochbegabter rund um die Liebe beschäftigt habe, desto mehr wurden aber doch „Muster“ erkennbar: Bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel die oft so hohe Gefühlsintensität, können bestimmte Erfahrungen mit sich bringen – etwa die, von anderen abgelehnt oder nicht verstanden zu werden oder sich von der eigenen emotionalen Intensität überrollt zu fühlen. Der Umgang mit diesen Erfahrungen kann zwar von Person zu Person ganz unterschiedlich sein, es zeigen sich aber auch hier bestimmte Varianten wiederholt.
Um das Thema Liebe im Zusammenspiel mit Hochbegabung möglichst ganzheitlich zu betrachten und zugleich etwas Struktur in die vielfältigen Erscheinungsformen der Liebe zu bringen, unterteile ich Liebe im Folgenden in die drei Säulen „Selbstliebe“, „Liebevolle Beziehungen“ und „Lebensliebe“. Hier ein kurzer Ausblick:
Selbstliebe
Sich selbst zu lieben fällt Hochbegabten oft schwer. Denn aufgrund ihrer hohen Intelligenz, Schnelligkeit, Vielschichtigkeit, Sensibilität und Emotionalität machen sie oft schon in der Kindheit und Jugend die Erfahrung, nicht wirklich „gesehen“, angenommen und geliebt zu werden, wie sie sind. Zur Erfahrung, in den Augen anderer „falsch“ zu sein, gesellen sich zumeist hohe, oft unerfüllbare Ansprüche an sich selbst und die eigenen Leistungen in allen Lebensbereichen.
Liebevolle Beziehungen
In der Liebe stehen Hochbegabte zunächst vor der Herausforderung, überhaupt Partner:innen auf Augenhöhe zu finden. Wenn sie dann eine Liebesbeziehung leben, fällt es ihnen oft schwer, eine stimmige Balance aus Nähe und Autonomie zu bewerkstelligen. Sowohl Geschlechterrollen als auch Beziehungsformen stellen sie häufig infrage und sind auch in der Liebe auf der Suche nach einem Leben im Einklang mit der eigenen Identität. In Partnerschaften sowie in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen in Job und Privatleben ist es oft schwer, anderen die eigene komplexe, intensive Gedanken- und Gefühlswelt zu vermitteln und zu einer für beide Seiten geglückten Kommunikation zu finden.
Lebensliebe
Ein Mangel an Selbstliebe und an stimmigen Beziehungen zu anderen Menschen sowie ihre kritische, oft von tiefer Enttäuschung geprägte Sicht auf die Welt führen nicht selten dazu, dass Hochbegabte sich auch mit der Lebensliebe schwertun und depressiv werden.
Sie sind aber nicht zu Einsamkeit und Depressionen verdammt, sondern meine Erfahrung ist:
Hochbegabung ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance für die Liebe!
Hochbegabte erleben meist äußerst intensive Emotionen und große Leidenschaft und sind häufig besonders experimentierfreudig, was ihre Identitätsfindung und Liebe in all ihren Facetten angeht. Auch wenn sie Phasen des Leids, der Zweifel und der Einsamkeit kennen, sind sie oft bemerkenswert resilient und willens, sich weiterzuentwickeln und doch noch glücklich und in Liebe zu leben.
Ein Buch zu schreiben ist für mich nur dann verlockend, wenn mich ein Thema wirklich „packt“ und auch persönlich bewegt. Dieses Buch ist mir aus mehreren Gründen zu einem Herzensanliegen geworden: Zum einen ist mir das Thema immer wieder begegnet. In den Erfahrungsberichten und Anliegen meiner Klient:innen und in Gesprächen mit hochbegabten Freund:innen. In meinem eigenen Leben, das mir durch mein eigenes Herausfallen aus der Norm eine in Sachen Liebe bunte und nicht immer nur einfache Biografie beschert hat, die ich besser verstehen wollte und inzwischen als einen wertvollen Erfahrungsschatz begreife.
Ein weiterer Anstoß zum Schreiben dieses Buches war für mich, dass auch andere Berater:innen und Therapeut:innen für Hochbegabte, mit denen ich kollegial vernetzt bin und mich austausche, ein großes Interesse am Thema „Hochbegabung und Liebe“ erkennen ließen. Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, unkonventionelle Formen des Zusammenlebens oder dauerhaftes Alleinleben, Ausgrenzung und traumatische Beziehungserfahrungen sind nur einige Themen, die unter uns Kolleg:innen mit Blick auf den Einfluss der Hochbegabung diskutiert wurden und werden. Ebenso ist immer wieder Thema, wie (mangelnde) Selbstliebe und (mangelnde) Lebensliebe mit Besonderheiten als hochbegabter Mensch zusammenhängen können und welche Lösungswege es gibt, um beide zu stärken.
Es war für mich eine große Freude und eine spannende Entdeckungsreise, für dieses Buch rund 30 hochbegabte Menschen zu interviewen und mich zu Fragestellungen des Buches mit Fachkolleg:innen auszutauschen, die mich allesamt mit großer Offenheit an ihren Erfahrungen und Gedanken teilhaben ließen. Ohne sie wäre dieses hoffentlich inspirierende und Mut machende Werk nicht entstanden.
Wie können also Hochbegabte ihre im Grunde oft große Liebesfähigkeit wecken und nutzen, um zu Selbstliebe, erfüllenden Beziehungen und Lebensliebe zu finden?
Darum geht’s in diesem Buch.
Letztlich bleiben die Erfahrungen mit der Liebe für hochbegabte Menschen jedoch so individuell, dass ich es realitätsfern und auch nicht verantwortlich finde, mit diesem Buch eine Anleitung im Sinne von „Das Sieben-Punkte-Programm für Hochbegabte in der Liebe“ zu schreiben. Es geht mir eher darum, eine – immer noch nur exemplarisch bleibende! – Vielzahl von Aspekten rund um die Liebe im Lichte der Hochbegabung zu betrachten. Oder anders ausgedrückt: Ich finde es wichtig, auch in Fragen der Liebe eine vorhandene Hochbegabung immer „mitzudenken“, zu schauen, welche Einflüsse sie hat und wie sich konstruktiv damit umgehen lässt. Das Buch ist in diesem Sinne eher ein „Lesebuch“, das an vielen Stellen Aha-Effekte und Inspirationen liefern kann, und eben keine Anleitung.
Sowohl die Herausforderungen als auch die Lösungen sind so verschieden wie die Menschen selbst – unterscheiden sich bedingt durch die Hochbegabung aber oft von gängigen Erfahrungen und Strategien. Das Buch kann deshalb sowohl für hochbegabte Leser:innen als auch für ihre Partner:innen oder andere nahestehende Personen und ebenso für Berater:innen und Therapeut:innen Hochbegabter von Interesse sein.
Noch ein paar Hinweise zu meiner Herangehensweise
Dieses Buch beruht vor allem auf eigenen beruflichen wie persönlichen Erfahrungen und Gedanken, die ich durch Interviews und weiteren Austausch mit zahlreichen hochbegabten Menschen überprüft und erweitert habe. Literatur zu den Themenkomplexen „Hochbegabung“ und „Liebe“ habe ich nur ergänzend hinzugezogen. Was meine Interviewpartner:innen mir von ihren Erfahrungen, Gefühlen und Gedanken berichtet haben, fand ich so bereichernd und anschaulich, dass ich viele ihrer Statements in das Buch eingeflochten habe – und sie so ein wenig zu Koautor:innen gemacht habe. Ein Riesendankeschön an alle Beteiligten schon an dieser Stelle!
Ich habe die Befragten mittels eines schriftlichen Fragebogens interviewt und zum Teil sehr ausführliche Antworten erhalten. Oft habe ich an einzelnen Punkten nachgehakt und wir haben uns noch weitergehend dazu ausgetauscht. Meine Interviewpartner:innen sind allesamt hochbegabt und entweder Klient:innen meiner Beratungsarbeit, Abonnent:innen meines Newsletters oder Kolleg:innen in der Arbeit mit Hochbegabten. Sie waren zum Zeitpunkt der Befragung im Alter von Mitte 20 bis Mitte 60. Ein Manko ist sicherlich, dass Frauen deutlich überrepräsentiert sind, was daran liegt, dass sich weniger Männer für das Interview gemeldet haben: Es sind nur fünf Männer, darunter ein Transmann, unter den Befragten, die ich allerdings oft zitiert habe. Es mag andererseits auch stimmig sein, dass ich als Autorin mehr Frauen als Männer zu Wort kommen lasse. Ich bin aber überzeugt davon, dass das Buch für Leser:innen jeden Geschlechts lesenswert ist.
Die Aussagen der Interviewpartner:innen sind natürlich nicht repräsentativ. Dennoch zeigen sie sowohl die Vielfalt als auch einige Gemeinsamkeiten Hochbegabter in Sachen Liebe. Alle Namen sind Pseudonyme und die Zitate sind selbstverständlich anonymisiert, um die Identität der Befragten zu schützen.
Ich habe mich bei der direkten Ansprache für das Duzen statt Siezen meiner Leser:innen, in meinen Formulierungen für das Gendern mit Doppelpunkt entschieden und verwende nach Möglichkeit „wir“ oder „ich“, um bei Generalisierungen das Wörtchen „man“ zu ersetzen.
Das Buch ist so aufgebaut, dass mit wenigen Ausnahmen in den einzelnen Kapiteln zunächst jeweils Herausforderungen beschrieben werden, um daran anschließend Inspiration zu einem konstruktiven Umgang hiermit und zur persönlichen Weiterentwicklung zu geben. Diese Anregungen sind jeweils mit diesem Icon versehen, einem Symbol für Inspiration und Kreativität. Zudem hast du an einigen Stellen die Möglichkeit zur „Vertiefung“ in verschiedene Aspekte. Dahinter verbirgt sich Online-Material, das durch dieses Icon angezeigt wird. Du findest diese Materialien in der Mediathek zum Titel unter: https://www.junfermann.de/titel/kluge-koepfe-lieben-anders/1609
Ich beginne mit einem kleinen Einführungsteil zu meinem Verständnis von Hochbegabung und Liebe. Daran schließen sich die drei Hauptteile des Buches an, die sich jeweils einer „Säule“ der Liebe widmen: Teil I: Selbstliebe, Teil II: Liebevolle Beziehungen, Teil III: Lebensliebe.
Nun aber: Viel Freude und eine gute Verbindung zu deinen eigenen Themen wünsche ich dir beim Lesen dieses Buches!
Deine Andrea Schwiebert
1. Verständnis von Hochbegabung und Liebe in diesem Buch
1.1 Hochbegabung und Hochsensibilität
Vielleicht hat dich irgendwer oder irgendwas auf dieses Buch gebracht und du fragst dich: „Hochbegabung? Ich kenne meinen IQ doch gar nicht und das ganze Gerede über Hochbegabung ist mir sowieso viel zu elitär!“ Falls es so sein sollte oder falls du dich einfach noch nicht näher mit dem Thema befasst hast, findest du nun zunächst Erläuterungen dazu, was ich unter Hochbegabung und auch unter Hochsensibilität verstehe.
Falls du dich mit diesen Konzepten schon auskennst, kannst du diesen Teil der Einführung einfach kurz überfliegen und nur an den Stellen tiefer einsteigen, an denen dein Interesse geweckt wird:
Mein Verständnis von Hochbegabung
Häufig wird eine Hochbegabung gleichgesetzt mit einem getesteten Intelligenzquotienten (IQ) von 130 oder mehr. Für mich ist eine Hochbegabung jedoch ein ganzheitliches Phänomen, das den ganzen Menschen betrifft und eine andere Qualität des Denkens, Fühlens und Wahrnehmens beinhaltet.
Ich finde daher immer noch Andrea Brackmanns Satz zutreffend (2012a, S. 19): „Stark vereinfacht gesagt bedeutet Hochbegabung mehr von allem: mehr denken, mehr fühlen, mehr wahrnehmen“, wobei aus meiner Sicht auch qualitativ statt quantitativ formuliert werden könnte: Statt mehr denken, fühlen und wahrnehmen insbesondere auch anders denken, fühlen und wahrnehmen – im Sinne von tiefer, assoziativer, komplexer, unkonventioneller, kreativer, intensiver.
Hochbegabte Menschen haben in einem oder mehreren Bereichen ein stark erhöhtes intellektuelles Potenzial, lernen Dinge (bei Interesse) in diesen Bereichen schneller und können sie oft mit besonderer Leichtigkeit weiterdenken oder weiterentwickeln. Die Vorstellung, dass sie beispielsweise einfach besser in Mathematik oder in Fremdsprachen sind als ihre Altersgenossen, greift aber zu kurz und lässt außer Acht, wie sehr ihre gesamte Persönlichkeit und ihre Art des „In-der-Welt-Seins“ von der Hochbegabung geprägt sein können. Ich verstehe Hochbegabung als ein den ganzen Menschen durchdringendes Phänomen, das sich bei jedem Individuum in unterschiedlichen Bereichen zeigen kann. Dabei wirkt die Hochbegabung nicht nur isoliert im jeweiligen Bereich, etwa als Sprachbegabung, mathematische oder musikalische Begabung, sondern bedeutet allgemein eine qualitativ andere Art und Weise, mit der Hochbegabte sich die Welt erschließen und mit ihr interagieren.
Erfahrungen mit IQ-Tests
Ein IQ-Test misst den Intelligenzquotienten und nicht die Intelligenz selbst, die für eine Messung schlicht zu komplex ist. Mit seinen zu lösenden Aufgaben kann er bestimmte Intelligenzformen aus dem Bereich der logisch-analytischen Intelligenz o. Ä. abfragen. Ein IQ über 130 weist eine hohe Korrelation mit einer Hochbegabung auf, ist aus meiner Sicht aber nicht mit ihr gleichzusetzen. Anders gesagt: Wer einen IQ über 130 hat, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich hochbegabt. Wer einen festgestellten IQ unter 130 hat, kann wiederum dennoch hochbegabt sein, falls andere Anzeichen deutlich für eine Hochbegabung sprechen. Ein so komplexes, ganzheitliches Phänomen wie eine Hochbegabung lässt sich nicht ausreichend durch die Lösung bestimmter Aufgaben abbilden, zumal das Ergebnis ja auch immer von Faktoren wie Tagesform, Prüfungsangst usw. abhängt. Ein gutes Beispiel dafür, dass IQ-Tests auch danebenliegen können, ist mein Interviewpartner Ralf (51):
Mit Mitte 20 war ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit auf einer Messe. An einem Messetag kam Gert Mittring, mathematisch Hochbegabter und bekannter Rechenkünstler, zum Messestand meines Arbeitgebers, um sich zu informieren. Nach einem längeren Gespräch u. a. zum Thema Hochbegabung hielten wir Kontakt, in dessen Folge ich auch die seinerzeit Leitende Psychologin des Hochbegabtenvereins MinD / MENSA Deutschland, Dr. Ida Fleiß, kennenlernen konnte. Nach mehreren Begegnungen und intensiven Gesprächen erklärten diese beiden Mensaner, bei mir läge ganz offensichtlich eine Hochbegabung vor. Damals habe ich das vehement verneint, denn bei einer schulpsychologischen Testung war zuvor ein IQ von 90 gemessen worden. Sehr genau erinnere ich mich an die damalige Erwiderung von Frau Fleiß auf dieses Testergebnis; sie sagte: „Ach, wenn Sie mir erklären wollen, einen IQ von 90 zu besitzen, dann können Sie auch gleich behaupten, Schuhgröße 1 zu haben.“
Mir ist von fachkundiger Seite (Ärzten, Psychotherapeuten, Mensanern) in den letzten Jahrzehnten immer wieder ein hohes Begabungspotenzial zugerechnet worden. Aktuell arbeite ich im Rahmen einer Lebens- und Sinnkrise gemeinsam mit einer Psychotherapeutin, die selbst hochbegabt ist und immer wieder Hochbegabte begleitet, zum Thema. Mit Blick auf das unterdurchschnittliche IQ-Test-Ergebnis geht sie aus von einer „internalen Unfähigkeitsüberzeugung“ bei vorliegender Traumatisierung (frühkindliche Gewalt und emotionaler Missbrauch in der Familie mit in der Folge fragilem Selbstkonzept), sodass nach ihrer Einschätzung gar kein valides Testergebnis erzielt werden konnte bzw. kann.
Allein schon Ralfs sprachliche Ausdrucksfähigkeit führt den festgestellten unterdurchschnittlichen IQ von 90 ad absurdum.
Vertiefung: Falls du bekannte Definitionen und Konzepte von Hochbegabung eher kritisch siehst, könnte die neue Hochbegabungsdefinition von Robert J. Sternberg interessant für dich sein: „Hochbegabt ist, wer der Menschheit nützt“ (Baudson, 2017).
Wie auch immer eine Hochbegabung definiert wird: Eine zweifelsfreie Feststellung ist in manchen Fällen tatsächlich schwierig. Häufig bietet die Biografie aber deutliche Anzeichen. Orientierung kann hier z. B. die schon in meinem Buch Kluge Köpfe, krumme Wege? (2015) enthaltene Checkliste zu Hochbegabung geben. Du findest sie auch online in der Mediathek zum Buch.
Wer sich in seriösen Beschreibungen von Hochbegabung wiedererkennt und in entsprechender Literatur einen wahrhaft hilfreichen Ansatz für die Lösung persönlicher Probleme findet, ist vermutlich hochbegabt – denn sonst würde er oder sie mit diesen Lösungsansätzen gar nicht viel anfangen können. Natürlich können Menschen sich auch eine Hochbegabung einreden, weil sie dies als schmeichelhafte Erklärung für Schwierigkeiten im eigenen Leben empfinden. Meine Erfahrung in vielen Jahren Beratung ist jedoch, dass dies nur sehr selten auftritt. Ein Indiz für eine Hochbegabung ist gerade, dass Betroffene es oft für kaum möglich halten, tatsächlich hochbegabt zu sein. Wenn sie also anfangen, die Hochbegabung für sich zu akzeptieren, geschieht dies meist am Ende einer längeren Phase des kritischen Hinterfragens und nicht leichtfertig.
Zusammengefasst …
… bedeutet Hochbegabung im Sinne dieses Buches: Hochbegabt sind Menschen, die in einem oder mehreren Bereichen eine stark überdurchschnittliche Lernfähigkeit, Verknüpfungsfähigkeit, kreative Lösungsfindung, Eigenständigkeit, Tiefe und Intensität im Denken und in der Wahrnehmung aufweisen, die sie in dieser Form nur mit sehr wenigen Menschen teilen. Zur Hochbegabungserfahrung gehört meist auch, sich in Alltagssituationen häufiger bremsen zu müssen, um andere mit der Komplexität und Schnelligkeit und Assoziationsneigung des eigenen Denkens und Redens nicht vor den Kopf zu stoßen. Sehr viele Hochbegabte haben hohe ethische Ideale und möchten sich gern mit ihrem Potenzial für diese einsetzen.
Ist dies bei dir selbst oder bei Menschen, die dir wichtig sind, der Fall?
Dann kann es wichtig und hilfreich sein, sich der Hochbegabung als Teil der eigenen Identität bewusst zu werden und sie in allen Lebensbereichen, ganz besonders auch in der Liebe, als Einflussfaktor mitzudenken. In diesem Buch wirst du dazu passende Erkenntnisse und Anregungen finden.
Hochsensibilität und emotionale Intensität als häufige Co-Faktoren einer Hochbegabung
Meine Beobachtung ist, dass ein Großteil der Hochbegabten auch hochsensibel ist, also eine erhöhte Reizoffenheit und Wahrnehmungsfähigkeit sowie eine besonders intensive Emotionalität und oft (nicht immer) auch ein erhöhtes Einfühlungsvermögen aufweist. Unter meinen Interviewpartner:innen haben nur zwei auf die Frage „Siehst du dich eher als hochbegabt oder hochsensibel oder als beides?“ nicht mit „beides“ geantwortet. Eines dieser abweichenden Statements lautete „Ich weiß es nicht“ und eins „Ich sehe mich eher als hochbegabt, da ich erfahren habe, dass hochsensible Personen noch intensiver auf Geräusche reagieren können, als ich es tue“. Letzteres schließt meiner Einschätzung nach eine Hochsensibilität jedoch nicht aus, da Geräuschempfindlichkeit ein häufiges, aber kein zwingendes Kriterium hierfür ist.
In manchen anderen Befragungen hat dagegen offenbar ein größerer Anteil der befragten Hochbegabten angegeben, nicht hochsensibel zu sein (Heil, 2021b; Müller-Martin, 2017).
Meine persönliche Einschätzung ist, dass die der Hochsensibilität zugrunde liegende Reizoffenheit bei einer intellektuellen Hochbegabung fast immer vorhanden ist, dass es aber (nicht nur bei Personen im Autismusspektrum, denen z. B. gerade der Punkt Einfühlungsvermögen ja schwerfällt) zahlreiche Faktoren geben kann, die verhindern, dass ein hochbegabter Mensch die ursprünglich angelegte hohe Sensibilität auslebt. Natürlich kann diese auch unterdrückt und überdeckt werden.
Hochbegabung und Hochsensibilität sind nicht ein und dasselbe
Ein verminderter Reizfilter bzw. eine „Filterschwäche“ und eine damit verbundene Hochsensibilität können auch ohne eine kognitive Hochbegabung vorliegen, eine kognitive Hochbegabung wiederum geht fast immer mit einer besonderen Reizoffenheit und häufig auch einer Hochsensibilität einher.
Oft werden Hochbegabung und Hochsensibilität in einem Atemzug genannt. Dennoch sollten sie nicht gemeinsam in einen Topf geworfen werden, denn Hochbegabte, die zusätzlich hochsensibel sind, und Hochsensible, die aber nicht hochbegabt sind, können durchaus unterschiedlich „ticken“.
Teilweise unterdrücken Hochbegabte auch eigene hochsensible Anteile, um nach außen nicht als verletzlich oder dünnhäutig wahrgenommen zu werden.
Das Zusammenspiel von Hochbegabung und Hochsensibilität kann beide Phänomene „unsichtbar“ machen, andererseits aber auch bereichernd sein
Viele Hochbegabte sind also auch hochsensibel. Dabei bedeutet Hochsensibilität zwar häufig eine besondere Schärfung der Sinne (Geruchsempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, Berührungsempfindlichkeit o. a.), ist aber vor allem zu verstehen als allgemein erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, oft mit einem höheren Einfühlungsvermögen und einer erhöhten emotionalen Intensität einhergehend. In dieser Weise hat sie zahlreiche Auswirkungen auf die in diesem Buch betrachteten Facetten der Liebe und auf die seelische und körperliche Gesundheit der betreffenden Menschen. Wie auch die intellektuelle Hochbegabung ist sie Herausforderung und Chance zugleich.
Viele Leser:innen meines Buches Kluge Köpfe, krumme Wege? (2015) haben es als für sie besonders wichtige Erkenntnis rückgemeldet, dass eine intellektuelle Hochbegabung und eine Hochsensibilität sich, wie dort beschrieben, gegenseitig verdecken können. Kurz gefasst handelt es sich um folgende Beobachtung: Wenn hochbegabte und zugleich hochsensible Personen etwas Bewegendes erleben, das sie durch ihre Hochsensibilität in Aufruhr bis hin zu innerer Not versetzt, können sie dies zum Teil durch ihre Hochbegabung kompensieren und trotzdem „gut genug“ funktionieren und Prüfungssituationen oder Alltagsherausforderungen meistern. Die intellektuelle Hochbegabung wird also zur Kompensation der Hochsensibilität eingesetzt, sowohl die Leistungen als auch die Belastbarkeit der Person wirken „normal“ – und weder die besondere Begabung noch die besondere Sensibilität werden sichtbar. In Wirklichkeit aber ist diese durch und durch „normal“ wirkende Person innerlich in höchstem Aufruhr und einem großen Stresspegel ausgesetzt.
Hochbegabte empfinden es häufig als sehr frustrierend, dass sie ihr besonderes Potenzial und all das, was sie gern verwirklichen würden, aufgrund ihrer Hochsensibilität nicht ausleben können, sondern viel Energie gebunden wird, um ihre vielen Wahrnehmungen, Gedanken und Emotionen überhaupt zu verarbeiten, und dass sie Rücksicht nehmen müssen auf ihr Bedürfnis nach Rückzug und Erholung.
Auf der anderen Seite kann eine Kombination aus Hochbegabung und Hochsensibilität auch vor typischen „Fallen“ bewahren, die die jeweiligen Phänomene mit sich bringen können: Wer die eigene Hochbegabung neu entdeckt oder den Fokus vor allem hierauf richtet, läuft manchmal Gefahr, übergroße Ansprüche an sich selbst und die eigene Leistungsfähigkeit zu richten: „Mit all diesen Begabungen muss ich doch Großes leisten!“ Wer wiederum zuallererst die eigene Hochsensibilität in den Blick nimmt, kann dazu neigen, sie als Rechtfertigung einzusetzen, um die Verantwortung für sich selbst an andere zu delegieren: „Die Welt ist zu laut, zu schnell, zu wenig einfühlsam, die anderen sollen sich ändern, ich bin hier das Opfer.“
Das Zusammenspiel beider Phänomene ist aus meiner Sicht bereichernd: Die Hochbegabungsseite mit ihrer Neigung zum lösungsorientierten Anpacken und ihrer oft zugrunde liegenden Selbstwirksamkeitserfahrung kann der Hochsensibilitätsseite dabei helfen, Verantwortung für das eigene Lebensglück zu übernehmen und sich selbst nicht als Opfer zu begreifen. Die Hochsensibilitätsseite mit ihrer Feinfühligkeit für eigene Bedürfnisse und für jene anderer Menschen wiederum kann die Hochbegabungsseite dazu befähigen, eigene Grenzen und Bedürfnisse sowie auch die anderer Personen besser zu achten.
Maja (38) ermöglicht das Wissen um die Schwierigkeiten und Vorteile, die ein Zusammentreffen von Hochbegabung und Hochsensibilität bedeuten, ein umfassendes Verständnis ihrer eigenen Persönlichkeit:
Manchmal streiten sich diese beiden Seiten regelrecht: Ich habe immer Lust auf Neues, brauche Anregungen, will eigentlich ganz viel machen und schnell erkunden und lernen. Gleichzeitig bin ich aber leider nicht wirklich experimentierfreudig und schrecke gerade vor vermeintlich zu intensiven Erfahrungen schnell zurück. Und meine hochsensible Seite will alles ganz gründlich und genau wahrnehmen. Insgesamt werden mir Dinge schnell zu viel und ich brauche viele Ruhe- und Auszeiten bzw. ein Zusammensein mit mir sehr vertrauten Menschen. Das ist schon ein Problem, weil ich dadurch oft das Gefühl habe, mein intellektuelles Potenzial nicht wirklich ausleben zu können, z. B. möchte ich nicht alleine in eine andere Stadt umziehen für eine wissenschaftliche Karriere. Ich trete auch insgesamt eher leise und nicht so forsch auf, wie es vielleicht nötig wäre, brauche viel Stabilität und Sicherheit, die ich aber auf der anderen Seite dann schnell langweilig finde und die mich als langfristige Zukunftsperspektive auch klaustrophobisch machen.
Gleichzeitig gleiche ich aber das eine mit dem anderen aus: Durch die Hochbegabung ziehe ich mich nicht vollständig in mich zurück, sondern bin immer auf der Suche nach neuen Dingen, initiiere Projekte, unterrichte z. B. gerne, gehe auch auf Menschen zu und gehe viele Dinge an. Die Hochsensibilität ermöglicht mir, in sehr gutem Kontakt mit anderen zu sein und auf sie einzugehen. Zusammenbringen kann ich die beiden Seiten tatsächlich in der Literaturwissenschaft, denn da wird beides gebraucht – das Einfühlen und die Sensibilität für Figuren und Text und die analytischen Fähigkeiten, die die eigenen Beobachtungen dann mit größeren theoretischen und lebensphilosophischen Kontexten verbinden. Da fühle ich mich ganz.
Da ich also Hochsensibilität nicht als „anstrengendes Beiwerk“ der intellektuellen Hochbegabung, sondern für viele Lebensbereiche als wertvolle Bereicherung sehe, verbinde ich in diesem Buch einen ganzheitlichen, die ganze Persönlichkeit umfassenden Blick auf die Hochbegabung mit dem Wissen um die häufig gleichzeitig vorhandene Hochsensibilität. Gerade in der Kombination beeinflussen beide die Fähigkeit zur Selbstliebe, die Gestaltung von Liebesbeziehungen und anderen zwischenmenschlichen Beziehungen und die Lebensliebe.
1.2 Liebe ist …
Liebe ist uns einerseits ein so selbstverständlicher Begriff, dass er keiner Erklärung bedarf. Andererseits gehören für uns zur Liebe individuell und je nach Kontext und kulturellem Setting ganz unterschiedliche Gefühle: Zuwendung, Annahme, Berührtsein, miteinander teilen, einander erkennen, Anziehung, Lust, Leidenschaft, Vertrauen, Geborgenheit, Zusammengehörigkeit, Sicherheit, Erfüllung … Es gibt so viel, was wir uns von der Liebe versprechen. Kaum etwas kann uns glücklicher oder unglücklicher machen als Liebe – je nachdem, ob sie uns gerade trägt oder wir gerade einen Verlust erleben. Einigen können wir uns vermutlich darauf, dass Liebe ein starkes Gefühl inniger Verbundenheit und Zuneigung ist.
In diesem Buch betrachte ich Liebe als Dreiklang aus Selbstliebe, Liebe in zwischenmenschlichen Beziehungen und Lebensliebe. Alle drei Bereiche sind essenziell wichtig für ein erfülltes Leben.
Was ist hier mit „Selbstliebe“ gemeint?
Selbstliebe verstehe ich als eine wohlwollende, annehmende, ermutigende Haltung sich selbst gegenüber. Wer sich selbst liebt, ist deshalb nicht selbstverliebt – im Sinne einer Überhöhung des eigenen Selbst als „schöner, besser, wichtiger“ als alle anderen. Wer sich selbst liebt, ist in der Lage, das Schöne, Gute, Besondere, die eigenen Anstrengungen und Erfolge an sich selbst wahrzunehmen und zu würdigen, zugleich auch das Unperfekte, noch nicht Gelungene, Fehlgeschlagene im eigenen Leben und an der eigenen Person anzunehmen und sich freundlich zuzugestehen, dass aus Fehlern gelernt werden darf und dass das Ziel eher Entfaltung und nicht Perfektion ist. Selbstliebe (manche übersetzen sie für sich vielleicht auch lieber als „Selbstannahme“ bzw. „Selbstakzeptanz“) als ein freundliches Zu-sich-selbst-Stehen und Mit-sich-selbst-auf-dem-Weg-Sein ist die Basis, um für beide Seiten glückliche Beziehungen zu anderen Menschen eingehen zu können und das eigene Leben aktiv und erfüllend zu gestalten.
Selbstliebe bzw. Selbstannahme ist auch die Basis (aber kein Synonym!) für ein gutes Selbstwertgefühl, für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
Welche Art von „Liebe in zwischenmenschlichen Beziehungen“ wird hier betrachtet?
Schwerpunktmäßig geht es hier um Liebesbeziehungen im eigentlichen Sinne – ob zwischen Mann und Frau oder in queeren partnerschaftlichen Konstellationen. Vom Kennenlernen und Einander-Finden über die Phase des Verliebtseins, von Erotik und Sexualität über geistige Verbindung, von langjährigen Beziehungen über wechselnde Begegnungen oder lange Phasen des Single-Lebens: All diese Formen und Phasen drehen sich am Ende doch immer um den Wunsch, so, wie wir sind, gesehen zu werden, angenommen zu sein, Gefühle miteinander teilen zu können, nicht allein zu sein.
Liebesbeziehungen werden in unserer heutigen stark individualisierten Gesellschaft oft idealisiert als Garant für Lebensglück. Dabei sind gelingende Beziehungen in der Familie, mit Freund:innen, Kolleg:innen oder anderen Bekannten in Wirklichkeit ein ebenso wichtiger Teil, um sich im Leben geliebt und aufgehoben fühlen zu können. So werden auch platonische Beziehungen betrachtet und es wird auch hierbei um die Frage gehen: Wie gelingt Kommunikation, wie gelingen Beziehungen, die allen Beteiligten das Gefühl eines respektvollen oder sogar liebevollen Miteinanders geben?
Und was soll „Lebensliebe“ heißen?
Mit dem eigenen Leben zufrieden zu sein, neugierig zu bleiben, morgens gern aufzustehen, sich an Beobachtungen und Ereignissen und Begegnungen zu erfreuen, glückliche Momente genießen zu können, Krisen mutig zu bewältigen, Lust auf die Gestaltung des eigenen Lebens zu haben – dies und noch mehr macht wohl Lebensliebe aus. Ihr Gegenteil wäre demnach die Depression, die tiefe Enttäuschung und Verzweiflung an sich selbst und am Leben, ein Abgeschnittensein von der Welt und von den eigenen Emotionen, häufig auch eine Antriebslosigkeit.
Alle drei Säulen der Liebe sind miteinander verwoben und bedingen sich gegenseitig. Und alle drei werden durch eine Hochbegabung beeinflusst. Manchmal kann es Sinn machen, zunächst in einem „Liebesbereich“ Entwicklung und Entfaltung anzugehen – und dies strahlt dann gleichsam auf die anderen Bereiche aus.
TEIL I: SELBSTLIEBE
2. Ohne Selbstliebe ist alles nichts
Dass wir uns selbst ruhig etwas liebevoller betrachten sollten, ist ja fast schon eine Binsenweisheit und Inhalt zahlreicher Zeitschriften und Blogs. Aber ist Selbstliebe so etwas wie Wellness? „Nice to have“ und irgendwie ein bisschen Luxus?
Nein, das ist sie nicht! Wenn Menschen sich selbst nicht lieben, sie sich also selbst mit Abwertung begegnen, fehlt das Fundament für jegliches Lebensglück und auch für die Fähigkeit, erfüllende zwischenmenschliche Beziehungen mit anderen Menschen zu führen.
Ausreichend Selbstliebe als Basis bedeutet, dass wir zugleich stabil und flexibel sein können: Stabil, weil wir auch bei Fehlern, Rückschlägen und Misserfolg unseren Wert nicht infrage stellen, auf unsere grundsätzlichen Fähigkeiten und unsere Lernfähigkeit vertrauen und wir in gutem Kontakt mit uns selbst sind. Flexibel, weil wir uns zugestehen, uns auch immer wieder zu entwickeln und aus Misserfolgen zu lernen.
Deshalb geht es nun zuerst um Selbstliebe als Basis – und danach erst um Liebe in der Begegnung mit anderen Menschen und um Lebensliebe.
2.1 Das ambivalente Verhältnis Hochbegabter zur Selbstliebe
Ich muss gestehen, dass mich alles Reden über Selbstliebe und Selbstfürsorge früher manchmal auch abgestoßen hat, weil ich dabei einzelne Menschen vor Augen hatte, die es – für mein Empfinden – mit dem Fokus auf sich selbst übertrieben haben, die trotzig bis aggressiv das eigene Wohlbefinden ins Zentrum gestellt und kaum noch wahrgenommen haben, dass sich in Wirklichkeit nicht alles um sie dreht und auch andere Menschen berechtigte Bedürfnisse haben. Wenn diese Menschen angesprochen auf ein eher rücksichtsloses Verhalten argumentiert haben, sie hätten eben gelernt, wie wichtig Selbstfürsorge sei, und würden sich das nicht mehr nehmen lassen, gruselte es mich etwas.
Inzwischen sehe ich Selbstfürsorge, richtig verstanden, tatsächlich als ganz zentral für ein auch anderen Menschen gegenüber offenes und liebevolles Leben an. Wir sollten uns weder in überzogener Anpassung an andere verlieren noch in pure Egozentrik abdriften, sondern eine Balance finden aus Mitgefühl und Rücksichtnahme auf andere einerseits und dem Wahren der eigenen Grenzen und einem guten Kontakt zu uns selbst andererseits.
Nur wenn wir lernen, uns selbst liebevoll anzunehmen, können wir andere lieben und unser Leben aktiv und kreativ gestalten – und sind dann eben nicht mehr übermäßig mit uns selbst beschäftigt.
Vielleicht fühlt sich manchmal der Begriff „Selbstliebe“ als Ziel zu groß an. Dann können wir ihn ersetzen durch „Wohlwollen mir selbst gegenüber“.
Mangelnde Selbstliebe kann bedeuten, ständig kritisch an sich selbst herumzumäkeln, sich lieblos mit anderen zu vergleichen, sich abhängig zu machen vom Urteil anderer. Kaum ein Mensch wird das noch nie erlebt haben. Ein echtes Problem ist es aber, wenn der lieblose Blick auf sich selbst überwiegt bzw. zur Gewohnheit wird. Und leider kann sich dies steigern bis zu regelrechtem Selbsthass und kann ebenso zu Depressionen führen. Selbstzerstörerisches Verhalten auf unterschiedlichen Ebenen (das Eingehen von erniedrigenden Beziehungen, Suchtverhalten, Selbstverletzung …) kann die Folge sein. Auch Wutanfälle und Aggressionen gegen andere können auf Selbstverachtung beruhen, wobei Mädchen und Frauen tendenziell eher autoaggressiv zu sein scheinen und Jungen und Männer ihre Aggressionen häufiger nach außen richten.
Natürlich ist dies kein exklusives Problem Hochbegabter. Der Mangel an Selbstannahme oder Selbstliebe ist ja in unserer heutigen Gesellschaft weitverbreitet. Dennoch gibt es mehrere Faktoren, die gerade bei Hochbegabten die Entwicklung einer stabilen Selbstliebe erschweren können und auf die ich in den Folgekapiteln näher eingehen werde.
Hochbegabte neigen sehr häufig zu Selbstzweifeln und zu harter Selbstkritik. Zumeist kennen sie große Schwankungen in ihrem Selbstwertgefühl und leiden darunter. Auf der anderen Seite haben sie in vielen Fällen durchaus eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, weil sie die Erfahrung gemacht haben: Wenn ich etwas wirklich will, kann ich es schaffen. Oder: Wenn es mir richtig dreckig geht, kann ich mir nur selbst helfen – und das letztlich oft besser, als andere mir helfen können.
Ich glaube, dass unter Selbstabwertung und sogar Selbsthass oft noch ein Funken Selbstliebe verborgen liegt. Wir würden uns nicht leidenschaftlich ablehnen, wenn uns nicht eigentlich etwas an uns selbst läge. Nur weil es uns wichtig ist, wer und wie wir sind, sind wir ja verzweifelt über einen Ist-Zustand, den wir als ungut empfinden. Und oft kann sogar ein Hilferuf hinter der Selbstablehnung stecken: Ich mag mich überhaupt nicht, wäre so gern freier, wüsste so gern, wohin mit meinen intensiven Gefühlen, leide unter meinen hohen Ansprüchen an mich selbst, verachte mich dafür, dass ich keinen Ausweg aus meinem Unglück finde … Aber: Ich würde das so gern ändern und brauche Hilfe dabei, brauche jemanden, der oder die mich auch dann erkennt, wenn ich mich verberge, mir sagt, dass ich auch unperfekt in Ordnung bin, mir hilft, neue Wege zu finden, wo ich keine sehe.
Viele Hochbegabte berichten von Schwierigkeiten mit der Selbstliebe
Die überwiegende Mehrheit meiner hochbegabten Interviewpartner:innen hat mir davon berichtet, dass Selbstliebe für sie ein schwieriges Thema sei. Oft ist immerhin eine positive Entwicklung vom Jugendalter zum Erwachsenenalter zu beobachten und finden die Betreffenden im Laufe ihres Lebens Menschen, mit denen sie sich wohlfühlen – was sich positiv auf ihre Selbstliebe auswirkt. Aber Selbstannahme bleibt für viele Hochbegabte durchaus eine Herausforderung.
Elisa ist 55 Jahre alt und sagt immer noch von sich:
Selbstliebe ist eins meiner größten Themen und mein Selbsttherapie-Hauptfeld. Sie kann ich kaum empfinden und Zufriedenheit mit mir stellt sich häufig nur nach vollbrachten Leistungen ein. Das Umkippen in Selbsthass kenne ich auch. Das geht sehr gut mit Alkohol, den ich in selbstverletzender Weise bewusst einsetze, ohne je eine Abhängigkeit entwickelt zu haben. Bestätigung von außen? Die kann ich oft gar nicht annehmen, weil ich denke, die anderen durchschauen ja gar nicht, dass ich nicht so gut bin, oder sie haben egoistische Motive, mich zu loben.
Auf die Frage, ob sie sich selbst in ähnlicher Weise lieben und annehmen könne wie andere Menschen, die ihr wichtig sind und die sie liebt, steht Annas (35) Antwort stellvertretend für ähnliche Antworten vieler anderer Befragter:
Eher selten. Ich bin sehr oft mein härtester Richter und der Perfektionismus mein ständiger Begleiter. Ich habe oft sehr hohe Ansprüche und Erwartungen an mich selbst, genüge mir daher oft nicht und habe oft den Eindruck, ich selbst und vieles andere könnte noch viel besser sein.
Dass viele Hochbegabte immer wieder unter großen Selbstwertschwankungen leiden und sich mit der Selbstliebe schwertun, hat neben individuellen biografischen Erfahrungen und Ursachen zumeist auch Gründe, die in der Hochbegabung selbst liegen. Diese werde ich in den folgenden Abschnitten rund um das Thema Selbstliebe darlegen – und dabei insbesondere auf die Aspekte der mangelnden Spiegelung, der Leistungsorientierung und der Schamgefühle aufgrund des Andersseins eingehen, die allesamt ernst zu nehmende „Bremsen“ für die Selbstliebe sein können.
Vertiefung: Online findest du eine Kurzübersicht über diese begabungsspezifischen Selbstliebe-Bremsen und ebenso Ideen zum Umgang damit.
2.2 Mangelnde Spiegelung und ihre Auswirkungen
Alle Menschen brauchen insbesondere in der Kindheit und Jugend ausreichend Spiegelung, um ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und sich selbst mit Stärken wie Schwächen liebevoll annehmen zu können, die Erfahrung: „Ich werde gesehen, wie ich bin, und werde so geliebt und geschätzt, wie ich bin.“ Hochbegabte haben aus verschiedenen Gründen geringere Chancen, diese Spiegelung zu erfahren.
Nur wenige Menschen sind in der Lage, nachzuvollziehen, wie Hochbegabte denken und fühlen: Hochbegabte Kinder und Jugendliche lernen nicht nur vieles schneller, sondern denken auch viel komplexer als die meisten Gleichaltrigen. Sie machen sich Gedanken um Dinge, die andere ignorieren, stören sich mehr als andere an Inkonsequenz und Ungerechtigkeiten, entscheiden sich oft für weitsichtigere und konsequentere und vielleicht auch durchaus eigenwillige Lösungen. Hinzu kommt, dass sie oft mehr und anders wahrnehmen und fühlen, z. B. intensiv mit jemandem mitleiden, ihren Lebensmut angesichts des Zustands der Welt verlieren können, außergewöhnlich tiefgehende Gefühle von Glück, Begeisterung, aber auch Wut und Traurigkeit und Enttäuschung kennen.
Wenn ihr Umfeld aus Familie, Lehrpersonen und Gleichaltrigen, so wohlwollend es vielleicht sogar sein mag, ihre Gedanken und Gefühlswelt nicht begreift, fühlen sich hochbegabte Kinder und Jugendliche nicht wirklich gesehen: Ihnen fehlen Menschen, die tatsächlich erkennen, wer sie sind, was sie ausmacht, was in ihnen steckt und herauswill.
Umso schlimmer ist es, wenn sie – was leider häufig vorkommt – aufgrund ihrer Denk- und Verhaltensweise sogar subtile oder offene Abwertung, Ausgrenzung und Verhöhnung erfahren, belächelt, als arrogant oder spinnert oder streberhaft abgestempelt werden, als nervig wegen ihrer häufigen Kritik, ihrer Sensibilität, ihrer abschweifenden Gedanken. „Sei doch nicht so empfindlich / kritisch / abgehoben …!“ oder „Was für schräge Ideen du auch immer hast!“ und zahlreiche andere Kommentare oder vielsagende Blicke führen bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen oft zu der Erkenntnis, dass sie besser verbergen, wer sie wirklich sind. Wenn sie dies aber tun und sich nicht mehr mit ihrer wahren Persönlichkeit zeigen, werden sie natürlich erst recht nicht gesehen, wie sie sind, und können die wichtige Erfahrung der bestärkenden Spiegelung erst recht nicht machen.
So beschreibt es auch Alexander (38) mit Blick auf sein früheres Verhalten im schwierigen Elternhaus und in seinem sonstigen Umfeld:
Ich habe in der Kindheit starke Selbstschutzreflexe aufgebaut, sodass ich mir immer eine Restschicht vorbehalte, mit der ich nicht in Kontakt gehe, mich nicht voll zeige, was natürlich dazu führt, dass man sich nie voll gesehen fühlt.
Erfahrungen der Ablehnung und Nicht-Passung aus Pubertät und Jugend sind nicht weniger prägend als Kindheitserfahrungen
In der Psychologie wird häufig angenommen, ein gesundes oder eben gestörtes Selbstwertgefühl bilde sich aus Kleinkinderfahrungen im Elternhaus heraus. Mein Eindruck ist aber, dass die spätere Kindheit und Jugend auch mit den Erfahrungen, die mit Peers und Lehrpersonen gemacht werden, mindestens ebenso entscheidend für die Entwicklung der Selbstannahme und Selbstliebe eines Menschen sind.
Der Sexualpsychologe Christoph Joseph Ahlers sieht prägende Jugenderfahrungen wie etwa erste unerwiderte Verliebtheit als genauso wichtig für die Entwicklung des Selbstwertgefühls an wie frühe Kindheitserfahrungen:
„Die Grundlage unseres Selbstwertgefühls wird in den ersten zwei Lebensjahrzehnten gelegt, vor allem in der Kindheit. Diese Grundstruktur prägt uns auch als Erwachsene nachhaltig. Hinzu kommen aber natürlich lebensphasische Einflüsse: Mangelnde Liebe, Wärme und Annahme in der Kindheit, aber auch unerwiderte Verliebtheit in der Jugend, können (…) eine starke Bedrohung des Selbstwertgefühls bis hin zur klinisch relevanten Selbstwertstörung auslösen. Andersherum führen sicheres Bindungserleben in der Kindheit, erwiderte Verliebtheit in der Jugend und gelingende Liebesbeziehungen im Erwachsenenalter zu einer Stabilisierung des Selbstwertgefühls, ausgelöst durch die Erfahrung, trotz aller Fehler und Schwächen Annahme zu finden. Dass Sympathie oder Verliebtheit erwidert werden, stärkt unser Selbstwertgefühl wie nichts anderes.“
(Ahlers, 2017, S. 107)
Für Hochbegabte, die anders sind als die Norm, ist meiner Erfahrung nach das Risiko besonders groß, in der Kindheit oder auch noch im Jugendalter durch die Nicht-Passung und infolgedessen durch das Unverstandensein, durch Anpassungsdruck und Ausgrenzung in ihrer Selbstliebe nachhaltig verunsichert zu werden. So beschreibt es auch die Psychotherapeutin Christina Heil in ihren aktuellen Studien zu Hoch- und Höchstbegabten (Heil, 2021a, 2021b).
Die Psychologin Britta Sperling spricht in ihrem sich um Hochbegabung und Hochsensibilität drehenden Podcast „Sensibel Sein“ (Folge 6) von einer „traumatisierten Begabung“, die sich entwickeln könne, wenn besonders begabte und sensible Kinder in vielen kleinen, aber häufigen, immer wiederkehrenden Situationen erleben, dass sie mit ihrem Sosein auf Ablehnung stoßen.
Ich selbst habe ähnlich prägende Jugenderfahrungen gemacht, die ich erst im Lichte der Hochbegabung rückblickend besser verstehe. Ab dem Alter von elf Jahren fühlte ich mich mit meinen Sorgen und meinem Entsetzen angesichts der Weltlage (atomares Wettrüsten, Umweltzerstörung, Rassismus, Unterdrückung …) von Gleichaltrigen nicht gesehen und verstanden, sogar belächelt und abgelehnt. Ihre Themen wiederum sprachen mich nicht an. Ich kannte mich nicht aus mit Musik und TV-Serien, hatte keine Ahnung, welche Kleidung gerade modern war, und lehnte rollenspezifisches weiblich assoziiertes Verhalten und Auftreten ab. Ich wollte einerseits verzweifelt dazugehören, spürte aber andererseits, dass ich anders war als die anderen und ich mich auch mitten unter ihnen einsam fühlte, also irgendwie auch doch nicht zu ihnen gehören wollte. Von einer glücklichen Grundschulzeit gestärkt, ging ich zunächst selbstverständlich davon aus, dass mein Umfeld auch in der weiterführenden Schule positiv auf mich reagieren würde. Als dies nicht immer der Fall war, hat mich das so tief verunsichert, dass ich viele Jahre gebraucht habe, um mich davon zu erholen und wieder leichter daran glauben zu können, dass andere mich erkennen und mögen werden, wie ich bin. Unter meinen Interviewpartner:innen haben viele von entsprechenden Erfahrungen berichtet. Silas, 27 Jahre alt, hat Unverständnis und sogar Mobbing erlebt:
Kritisiert, irgendwie nicht ganz zugehörig, manchmal auch absichtlich ausgegrenzt, missverstanden, etwas allein … fühle ich mich leider auf mein ganzes Leben betrachtet ziemlich oft. Die Härte dieser Erfahrung geht von direkter Ausgrenzung bis hin zu Mobbing mit dem Gefühl, mich nicht begreiflich machen zu können und mit meinen Ideen und Erwartungen den Rahmen zu sprengen. Besonders stark war dies im Alter von ungefähr elf bis 13 Jahren, weil ich andere Interessen als meine Mitschüler:innen hatte und sie mich anstrengend und kompliziert fanden. Ich hatte in der Zeit kaum Freunde, versuchte immer wieder, Anschluss zu finden, und war oft traurig, frustriert und einsam. Wurde teilweise ausgelacht, schief angeguckt, lief oft alleine durch die Gänge oder wartete alleine vor Klassenräumen, bekam dumme Kommentare ab und fühlte mich oft fehl am Platz und unglücklich.
Sara (26) hat ihr Anderssein besonders geschmerzt, als auch die Erklärung, hochbegabt zu sein, nicht mehr stimmig erschien:
Gerade in der Teenagerzeit hatte ich wenig Liebe für mich selbst, ich habe mich wie ein Alien gefühlt und in einer Identitätskrise gesteckt. Ich habe mir damals sehr gewünscht, einfach nur normal zu sein und „reinzupassen“, konnte meine Besonderheiten nicht wertschätzen. Ich hatte das Gefühl, eine Maske zu tragen, und wusste gar nicht mehr richtig, wer ich eigentlich im Kern bin und was mich ausmacht. Ich habe viel daran gezweifelt, ob ich denn nun wirklich hochbegabt bin, ob die Testung fehlerhaft war … Mit Mathe und Physik habe ich mich in der Schule z. B. sehr schwergetan und ein besonders taktloser Mathelehrer sagte meinen Eltern in meinem Beisein, dass ich ja wohl kaum hochintelligent sein könne, wenn es in Mathe so hapert. Eine andere Lehrerin händigte mir in der sechsten Klasse meinen schlechten Englischtest mit den Worten „nun trennt sich wohl die Spreu vom Weizen“ aus, so was hat bei mir damals starke Selbstzweifel gesät und ist bei mir bis heute hängen geblieben. Ich brauchte drei Jahre, um wieder Freude am Englischunterricht zu haben und gute Leistung zu zeigen.
Wenn die Spiegelung in der Kindheit und Jugend gefehlt hat, bleibt bei Erwachsenen oft eine Abhängigkeit von Bestätigung
Auch wenn die Pubertät Vergangenheit ist und Hochbegabte später im Leben mehr und mehr zu sich stehen und – im günstigsten Fall – Freundschaften mit Menschen schließen, die sie so schätzen, wie sie sind, haben Kindheits- und Jugenderfahrungen oft lebenslang einen prägenden Einfluss. Sobald sich Erfahrungen von Ablehnung und Unverstandensein wiederholen, kann dies auch im Erwachsenenalter noch zu Selbstzweifeln bis hin zu Selbstablehnung führen. Einige Hochbegabte empfinden sich so auch als Erwachsene als sehr abhängig von Rückmeldungen anderer. Sophias (51) Selbstliebe war lange abhängig von der Bestätigung durch stabile Beziehungen:
Die Selbstliebe war oft nicht so ausgeprägt in meinem Leben. Manchmal hat sich das nicht gezeigt, wenn mein Umfeld stabil war, z. B. mit kleineren Kindern in einer festen Partnerschaft oder in einer guten Ehe mit meinem ersten Mann. Oder in einer guten Wohngemeinschaft – einer Lebensform, in der ich 20 Jahre meines Lebens verbracht habe. Tatsächlich war Selbstliebe bei mir wohl viel von der Bestätigung von außen oder von stabilen Rahmenbedingungen abhängig.
In der Kindheit und Jugend gesäte Zweifel daran, „in Ordnung“ und liebenswert zu sein, brechen wieder auf, wenn sich im Erwachsenenalter die Erfahrung, abgelehnt zu werden, wiederholt. Gerade Partnerschaften sind hier ein sensibles Feld.
Das „Ambivalenzdilemma“: sich zwischen Authentizität und Anerkennung durch andere entscheiden müssen
Schon in der Kindheit lernen Hochbegabte häufig, dass sie sich anpassen müssen, um akzeptiert zu werden. Die Psychotherapeutin und Hochbegabungsexpertin Frauke Niehues bezeichnet die selbstverleugnende Anpassung Hochbegabter als „Ambivalenzdilemma“, im englischsprachigen Raum auch als forced choice dilemma beschrieben:
Hochbegabte befinden sich oft in einer Lose-lose-Situation: Wenn Sie sich authentisch zeigen und ihren Bedürfnissen nachgehen (zum Beispiel kritisch nachfragen, ihre Fähigkeiten nutzen, um sich durchzusetzen, ihr Wissen zeigen u. Ä.), laufen sie Gefahr, abgelehnt zu werden. Wenn sie ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse verstecken, vermeiden sie, abgelehnt zu werden, aber verleugnen sich selbst, und es drohen Langeweile, Unterforderung und Frustrationsgefühle.
Als Hochbegabter muss man sich immer wieder für eine der beiden Alternativen entscheiden. Aufgrund von Sozialisierungs- und Erziehungsprozessen geschieht dies nicht selten automatisiert und unbewusst. Da keine Lösung befriedigend ist, entstehen immer wieder innere Spannungen. Manche Hochbegabte sind diese so gewohnt, dass sie sie kaum noch wahrnehmen oder als normal empfinden.
Wenn ich hochbegabten Klient:innen das Ambivalenzdilemma erläutere, bewegt sie das meist sehr, weil sie sich so sehr darin wiederfinden und damit endlich eine einleuchtende Erklärung für oft verwirrende und enttäuschende Kommunikationserfahrungen finden, die sie zuvor als persönliches Versagen interpretiert haben und die sie sich häufig gar nicht so richtig erklären konnten. So berichtet Maja (38), sie habe sich wie ein Chamäleon an ihre Umgebung angepasst, wodurch sie aber erst recht nicht wirklich erkannt worden sei:
Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich mich sehr früh sehr stark in mich selbst zurückgezogen habe und nach außen in gewisser Weise eine Art Chamäleon war / bin, indem ich den anderen das zeige, was sie meiner Meinung nach gerne sehen wollen und mögen, und anderes verberge. Das sorgt vordergründig natürlich für das Gefühl, gemocht zu werden, hintergründig hatte ich aber oft das Gefühl, dass man mich eigentlich gar nicht wirklich kennt.
Das Ambivalenzdilemma kann Hochbegabte auch im Erwachsenenalter noch sehr belasten und immer wieder zu Identitätskrisen und Selbstzweifeln führen.
Sich gesehen fühlen und Wertschätzung erfahren
Da es also für Hochbegabte schon in der Kindheit und Jugend weniger wahrscheinlich als für durchschnittlicher Begabte ist, in ihrem Sosein gesehen und positiv gespiegelt zu werden, kann ihr Bedürfnis nach Spiegelung im Erwachsenenalter groß bleiben.
Was können erwachsene Hochbegabte tun, um diesen Mangel an „Sich-gesehen-Fühlen“ wirksam auszugleichen?
Die eigene Hochbegabung erkennen und sich selbst Bestätigung geben
Uns selbst annehmen heißt, uns grundsätzlich wohlwollend zu betrachten und in gewisser Weise „selbst zu bestätigen“. Wesentlich für die Entwicklung dieser Selbstannahme ist, dass wir auch durch andere Angenommensein erfahren haben und dass wir uns selbst und unsere Bemühungen, Ziele und Sehnsüchte annähernd verstehen. Für dieses Verständnis wiederum spielt die Erkenntnis der eigenen Hochbegabung oft eine ganz wichtige Rolle.
Sie ändert den Blick auf uns selbst und die eigene Biografie und eröffnet neue Perspektiven, um sich selbst endlich verstanden und gespiegelt zu fühlen. Der erste Schritt ist dabei oft, auf Websites oder in der Literatur zu Hochbegabung zu erkennen: Da gibt es ja doch noch andere Menschen, die auch so denken und empfinden wie ich! Als Autorin erhalte ich regelmäßig Mails von Leser:innen meines ersten Buches zu Hochbegabung, die mir schreiben: „Ich habe mich so sehr gesehen und verstanden gefühlt“ oder „Ich habe mich in Ihrem Buch wiedergefunden“ bis hin zu „Ich habe mich beim Lesen gefragt: Kennen Sie mich?“.
In einigen Fällen verbringe ich mit Klient:innen die erste Beratungssitzung damit, gemeinsam auf „Spurensuche“ zu gehen und zu schauen, welche Anzeichen für eine Hochbegabung es im eigenen Leben gibt und was durch diese erklärbar und verständlich wird. Dabei handelt es sich um für die Betreffenden sehr bewegende Erkenntnisprozesse, die sowohl das Verhältnis zu sich selbst als auch das zu anderen Menschen betreffen. Für Sonja (51) war die Erkenntnis, hochbegabt zu sein, wie die befreiende und zugleich schmerzhafte Entdeckung von etwas, von dem sie gar nicht wusste, dass sie es hätte suchen sollen:
Da das ungefähr mit 34 Jahren war, war es einerseits erleichternd und befreiend, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt verstehen und akzeptieren, aber gleichzeitig auch schmerzhaft und traurig. Denn es war ja auch schon ein großer Teil meines Lebens gelebt mit doch tiefgreifenden Schwierigkeiten. Das Thema hat mich dann sehr intensiv beschäftigt. Wenn man sich, was in meiner Pubertät sehr extrem war, als nicht dazugehörig fühlt, „fremd“ fühlt, und dann begreift, dass es eben nur wenige, aber doch einige andere von der Sorte gibt, bringt einen das weiter. Man hat das Gefühl, noch nie so nah bei sich gewesen zu sein; ohne vorher gewusst zu haben, wie und wo man hätte suchen sollen.
Stephanie (27) versteht und akzeptiert nun sich selbst und ihr Umfeld besser:
Ich weiß jetzt, warum ich Gefühle besonders tief empfinde, warum ich von den allermeisten Menschen nicht erwarten kann, dass sie so ähnlich „ticken“ wie ich, bin seltener frustriert, wenn andere länger brauchen, um ihre Gedanken zu sortieren, und achte auch beim Sprechen darauf, dass alle den Sinn mitbekommen können. Insgesamt hat das Wissen um meine Hochbegabung dazu geführt, dass ich mich und meine Mitmenschen viel besser annehmen kann, weil es so vieles erklärt.
Alexander (38) berichtet von einer etwas anderen Perspektive: Er habe sich selbst auch vor dem Wissen um seine Hochbegabung eigentlich immer in Ordnung gefunden. Aber er habe die Welt nicht verstanden:
Ehrlich gesagt, konnte ich mich nie mit der Hochbegabungsbewegung oder dem entsprechenden Label identifizieren. Ich habe nie an mir gezweifelt in dem Sinne, dass ich dann durch solch ein Label mental hätte erlöst werden können. Es ging mir immer um praktische Sachen wie: Wie in der Schule den Konflikt zwischen Sehnsucht nach Gemeinschaft und Abneigung gegen die rebellischen, lauten anderen bewältigen? Wie auf der Arbeit meinem Bedürfnis nach Ruhepausen zwischen Phasen extremer Konzentration nachkommen? Und so weiter und so fort – das „Warum bin ich so?“ war bei mir stets weniger wichtig als das „Arrghhh, warum ist die Welt nicht so eingerichtet, dass ich meinen doch recht bescheidenen Bedürfnissen nachkommen kann, ohne ständig anzuecken?“. Für mich besitzt nicht der Gedanke, hochbegabt oder besonders zu sein, eine besondere Kraft, sondern der, dass die ganze Welt völlig anders funktioniert, als ich denke, dass sie funktionieren würde, wenn ich von mir auf sie schließe.
Wenn Menschen ihre Hochbegabung erst als Erwachsene erkennen, wird endlich erklärbar und nachvollziehbar, warum es in der eigenen Biografie überhaupt einen Mangel an Spiegelung und Gesehen-Werden gegeben hat. Nämlich nicht, weil sie die falsche Nase haben oder die Welt sich gegen sie verschworen hat, sondern weil sie in ihrem Denken, Fühlen und Wahrnehmen ungewöhnlich sind und sich teilweise in Bereichen bewegen, die anderen nicht gut zugänglich sind.
Dies wiederum kann helfen, Frieden mit der eigenen Biografie und mit manchmal im Rückblick vielleicht nicht so glücklich erscheinenden Bewältigungsversuchen zu schließen und sich selbst und anderen Menschen weniger Vorwürfe zu machen.
Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, Gefühle von Bitterkeit mehr und mehr loszulassen, sich selbst zu verstehen sind wiederum Voraussetzungen, um auch in der Gegenwart wahrnehmen zu können, was an der eigenen Person liebenswert ist, und ebenso wahrnehmen und annehmen zu können, wenn andere mir Positives spiegeln. Je mehr ich dann zu mir stehe und zu dem, was ich tue, desto mehr akzeptieren es auch andere.
„Liebe dich selbst wie deine Nächsten!“
Oft lieben wir uns selbst auf eine „strengere“ Weise, als wir andere lieben. Um wohlwollender mit uns zu sein, weniger hart mit uns ins Gericht zu gehen, uns auch mal selbst für etwas anzuerkennen, kann es hilfreich sein, uns vor Augen zu führen, dass wir selbst mit anderen ja auch nicht so hart umspringen. Idealerweise lernen wir, uns selbst so zu lieben, wie wir andere sehr vertraute, nahestehende Menschen lieben – mit Wohlwollen, Nachsicht, Verzeihen, Stabilität und dem Glauben an die guten Absichten dieser Personen.
Es ist aber für soziale Wesen wie uns Menschen kaum möglich, sich diese Bestätigung ausschließlich selbst und völlig unabhängig vom Außen zu geben. Dies führt uns zum zweiten Ansatzpunkt:
Positive Erfahrungen mit der Spiegelung durch andere und mit dem Gesehen-Werden machen
Erst einmal ist wichtig: Das Bedürfnis nach Bestätigung, nach Spiegelung und Gesehen-Werden an sich ist nichts, was wir uns auch noch vorwerfen sollten. Hilfreicher finde ich, sich zu sagen: Es hat gute Gründe, dass ich in bestimmten Situationen Bestätigung brauche und mich danach sehne, gesehen zu werden, und dass ich öfter an mir selbst und meinem Wert zweifle. Auch diese bedürftigen Seiten kann ich annehmen. Sie sind allerdings nur ein Teil von mir: Wenn ich sie nicht verurteile und wegschiebe, kann ich daneben auch meine starken, autonomen Seiten besser wahrnehmen.
Verknüpft mit fehlender Selbstannahme ist häufig ein schwaches Selbstwertgefühl, das sich bei Hochbegabten aus der Erfahrung speisen kann, wenig Wertschätzung durch andere erlebt zu haben, also eben nicht unbegründet ist. Hier lohnt sich eine genauere Betrachtung: Wer oder was bestimmt denn eigentlich den Wert eines Menschen?
Ethisch betrachtet, sind wir Menschen alle gleich viel oder wenig wert und ist die Kategorie „Wert“ für Menschen somit fragwürdig. Weder Bewunderung oder Verachtung durch andere noch besondere Leistungen oder aber Misserfolge geben oder nehmen uns in Wirklichkeit unseren Wert. Wir werden geboren und sind damit „wertvoll“, weil wir leben. Alles andere ist subjektiv – und es hängt vom jeweiligen Umfeld oder von der uns umgebenden Kultur ab, ob wir wegen bestimmter Handlungen oder Eigenschaften als besonders wertvoll empfunden oder deswegen in unserem Umfeld eher abgewertet werden.
Auch wenn unser Wert in Wirklichkeit also nicht davon abhängt, wünschen wir uns, von anderen Menschen als wertvoll eingeschätzt zu werden, was uns in unserem Selbstwertgefühl bestärkt. Mangelt es uns an Wertschätzung anderer, können wir Minderwertigkeitsgefühle entwickeln. Insofern ist „Selbstwert“ also ein individuell geprägtes Verständnis davon, welchen Wert wir uns beimessen.
Da der Wert eines Menschen nicht objektiv bestimmbar ist, hat mein Kollege, der Psychotherapeut Patrick Schwarz, im kollegialen Austausch im von Frauke Niehues initiierten „Fachkreis Hochbegabung“ eine interessante Idee eingebracht: Statt sich abstrakt mit dem Ziel der Selbstwertsteigerung auseinanderzusetzen, kann es hilfreicher sein, zu betrachten, welche ganz konkreten Gefühle und Bedürfnisse hinter Empfindungen eines Mangels an Selbstwert eigentlich stehen: Wir können konkrete Situationen und Interaktionen anschauen und dann herausfinden, wie sich unsere Bedürfnisse identifizieren und besser erfüllen lassen.
Du kannst dich fragen:
Was ist in dieser konkreten Situation passiert?
Wie fühle ich mich? (Habe ich mich für einen Misserfolg geschämt? Habe ich Angst vor Unterlegenheit oder Zurückweisung gehabt? Fühlte ich mich schuldig, weil ich jemanden mit meinen Worten verletzt oder vor den Kopf gestoßen habe? Fühlte ich mich ausgeschlossen? Oder welche anderen Gefühle sind aufgetaucht?)
Die Gefühle wiederum sind Wegweiser, um herauszufinden:
Was brauche ich, was ist mein konkretes Bedürfnis? (Brauche ich mehr Klarheit oder mehr Sicherheit? Wünsche ich mir ein liebevolleres Miteinander? Brauche ich mehr Passung? Oder was fehlt mir?)
Was kann ich tun, um mein Bedürfnis zu erfüllen?
Mit diesen konkreten Situationen und Bedürfnissen lässt sich dann viel besser konstruktiv arbeiten als mit dem abstrakten Selbstwert und es lassen sich häufig Entwicklungs- und Veränderungsoptionen finden.
Ein stimmiges Umfeld ist das A und O für Wertschätzungserfahrungen
Egal, wie subjektiv die Einschätzung unseres Werts durch das Umfeld ist: Unser Selbstwertgefühl ist in seiner Entwicklung stark davon abhängig. Daraus folgt: Es macht einen Riesenunterschied, ob wir ein stimmiges Umfeld haben oder nicht. Wenn Menschen uns nicht besonders wertvoll finden, kann das schlicht und einfach daran liegen, dass wir es für sie eben nicht sind – und dass es uns guttäte, ein Umfeld zu suchen, für das wir wertvoll sind, weil dieses Umfeld besser zu unserer Persönlichkeit, unseren Werten und dem, was wir im Leben gestalten wollen, passt. Spiegelung im positiven, selbstwertbestätigenden Sinne ist also abhängig von der Gruppe, mit der wir uns umgeben. Und manchmal brauchen wir vielleicht beruflich oder privat schlicht andere Menschen um uns, mit denen wir mehr Gemeinsamkeiten haben.
Natürlich gibt es Begabte, die schon in ihrer Jugend glücklich mit sich selbst und ihrem Umfeld waren. Oder die von Kindesbeinen an mit bemerkenswerter Resilienz ausgestattet ihren eigenen Willen durchgesetzt haben und ein Umfeld hatten, das dies zumindest toleriert hat. Sophia (51) zum Beispiel sagt von sich:
Ich habe mich in vielen Dingen nicht angepasst und bin meinen eigenen Weg gegangen. Daran hat mich niemand gehindert, viele fanden das gut. Meine Eltern waren mit sich selbst beschäftigt – auch das hat es mir ermöglicht, mein eigenes Ding zu machen. Das hat mir sehr gutgetan. Soweit ich mich erinnere, hat es mich nicht großartig geschert, wenn doch mal jemand Einwände vorgebracht hat. Ich hatte immer schon einen starken Willen. Mein Vater hatte auch einen besonderen Lebensweg (auch hochbegabt vermutlich), war ein Rebell. Daher fiel es auch nicht arg auf, dass ich genauso war. Mein Freundeskreis bestand hauptsächlich aus Individualisten (Pfadfinderinnen). Nur in der Schule gab es Kreise, wo ich gern drin gewesen wäre, aber nicht wirklich reingekommen bin.
Leider gibt es auf der anderen Seite auch jene, die sich in ihrer Jugend und manchmal auch noch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter einsam und ungesehen fühlen. Meist finden sie mit zunehmendem Lebensalter aber doch einen Weg, immer mehr zu sich selbst zu stehen und sich ein passendes Umfeld im Job wie auch im privaten Leben zu suchen, wo sie die Erfahrung von Wertschätzung und Anerkennung machen können. Da gibt es oft noch Luft nach oben, aber immerhin: Oft ist die Entwicklung positiv und viele können als Erwachsene von stärkenden, stimmigeren Erfahrungen berichten. Alexander (38) sieht eine Parallele im eigenen Reifungsprozess und dem Aufbau eines passenden Freundeskreises:
Ich bin oft nicht verstanden und nicht geschätzt worden, aber es geht ja auch darum, ob man sich selbst kennt (und wertschätzt). Es fühlt sich viel verwirrender an, nicht verstanden zu werden, wenn man es selbst auch noch nicht hat. Man sucht und sucht und bekommt vielerorts leichte Signale, dass es noch nicht ganz das Richtige ist. Es hat bis spät in mein Studienleben hinein gedauert, bis ich ein gut zu mir passendes soziales Umfeld gefunden und aufgebaut habe, was ja auch mit dem „Gesehen-Werden“ zu tun hat. Ich kann mich nur dann gesehen fühlen, wenn ich mich in Kreisen bewege, die eine potenziell „wohltuende“ Haltung haben.
Hochbegabung kann von anderen durchaus positiv wahrgenommen werden
Wenn erwachsene Hochbegabte beschreiben, was ihnen inzwischen positiv gespiegelt wird, wird deutlich, dass es schon auch viele hochbegabungstypische Eigenschaften gibt, die von anderen Menschen geschätzt werden können. Sophia (51) ist z. B. eine unterhaltsame und zugleich einfühlsame und tiefsinnige Gesprächspartnerin. Ebenso ist sie für andere häufig eine „Anstifterin“ und Mutmacherin für ungewöhnliche Wege:
Seit der Kindheit gelte ich wohl als geistreich und witzig – eben sehr unterhaltsam. Das wurde und wird bis heute geschätzt. Außerdem mein klarer Blick, wenn Freund:innen mir von schwierigen Lebenssituationen erzählen oder wenn ich Kund:innen berate. Auch meine Empathiefähigkeit wird oft geschätzt, auch schon als Jugendliche. Vielleicht bin ich auch oft Impulsgeberin gewesen für meine Umwelt, weil ich manchmal ungewöhnliche Dinge tue, sehr individuell bin und öfter mal Mitmenschen dazu „anstifte“, aus ihrem Trott auszubrechen und auch Ungewöhnliches zu tun. Gespräche mit mir wurden und werden oft geschätzt, weil sie tiefsinnig, philosophisch, verbindend sind.
Auch im Umgang mit dem Ambivalenzdilemma („Ich bin, wie ich bin – und erfahre Ablehnung; ich passe mich an und werde gemocht – bin aber nicht ich selbst“) finden Hochbegabte im Laufe ihres Lebens oft Lösungen, die es ihnen ermöglichen, zumindest phasenweise authentisch zu sein und anerkannt und wertgeschätzt zu werden (mehr dazu in den Abschnitten 5.3 und 8.2). Dafür ist es zunächst wichtig, zu verstehen, welche Ursachen die Erfahrung des Abgelehnt-Werdens bei authentischem Verhalten im konkreten Einzelfall überhaupt hat: An welcher Stelle ich also andere Menschen im Gespräch z. B. „verliere“ oder vor den Kopf stoße.
Sophia berichtet, dass es für sie hilfreich war zu verstehen, dass in ihrem Fall Schnelligkeit ein wesentlicher Punkt dabei ist:
Ich denke, man hat mich wohl oft auch nicht verstanden in Diskussionsrunden, weil ich sehr knapp erkläre, Zwischenschritte in Gedankengängen, die ich für selbstverständlich halte, weglasse, um andere nicht mit ausschweifenden Argumentationen zu langweilen. In meiner systemischen Ausbildung habe ich die Rückmeldung bekommen, dass ich daher manchmal nicht gut verstanden werde, weil ich „ein Schnellboot wäre und die Gruppe ein Tanker“. Das habe ich mir zu Herzen genommen und kann es nun besser machen.
Auch wenn Hochbegabte es lernen, ihr Gesprächstempo oder ihre Art des Denkens anderen anzupassen und dabei viel soziales Verständnis entwickeln können, halte ich es für wichtig, dass sie zumindest „Inseln“ im eigenen Leben haben, wo gegenseitiges Verstehen im unverstellten So-sein-wie-ich-Bin möglich ist und wo das „Schnellboot“ sich nicht dem „Tanker“ anpassen muss.