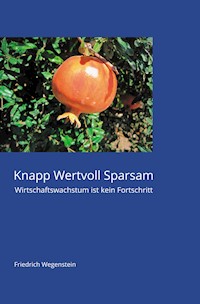
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wirtschaftswachstum erscheint uns selbstverständlich. Gleichzeitig wird zunehmend deutlich, dass die Verschuldung einen ungedeckten Scheck auf unsere Zukunft darstellt. Das Wachstum kann sich nicht ewig fortsetzen und steht daher zur Schuldentilgung immer weniger zur Verfügung. Die Freihandelsabkommen unterlaufen mit den durch sie ermöglichten Billigimporten unsere demokratisch beschlossenen Sozial- und Umweltstandards. Die Interessen der Wirtschaft werden damit über die Interessen der Bürger gestellt. Die Geldmenge wächst stärker als die Wirtschaft und verursacht Blasen im Immobilienbereich und auf den Finanzmärkten. Gleichzeit nimmt die Fähigkeit, für Beschäftigung zu sorgen (nicht nur wegen der Digitalisierung) ab. Die Folge ist eine zunehmende Ungleichheit an Einkommen und Vermögen sowie die politische als auch wirtschaftliche Destabilisierung. Es hilft nichts, Umweltstandards in den Konsumentenländern einzuhalten, wenn gleichzeitig durch deren ungebremsten Konsum die Emissionen in den Produktionsländern weiter steigen. Zusätzlich zwingt uns die ansteigende Weltbevölkerung in Zukunft mit einem geringeren Ressourcenverbrauch mehr Menschen das Leben auf dieser Erde zu ermöglichen. Die demokratischen Kräfte der Gesellschaft haben die Aufgabe, sich vom derzeitigen Wachstumsdenken abzuwenden und den Wirtschaftsliberalismus durch einen ausgewogenen Interessenausgleich im Sinne der Volkswirtschaft einzuschränken. Die Demokratie kann diese Aufgabe aber nur bewältigen, wenn sie von der Überzeugung der Bürger getragen wird. In unserer begrenzten Welt sind alle Dinge knapp und wertvoll. Wir müssen daher mit den Ressourcen sparsam und vorsorglich umgehen. Der Wert und die Knappheit kann nur dann für alle spürbar zum Ausdruck kommen, wenn man entgegen der bisherigen Praxis jedem Wirtschaftsgut die tatsächlichen und vollständigen Kosten (inklusive Recycling und Wiederherstellung des vorhergehenden Zustandes) zuordnet und in den Verkaufspreis einrechnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Copyright © 2019 Friedrich Wegenstein
Vertrieb:
epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Eine Gesellschaft, die der Wirtschaft alle Freiheit einräumt und dabei ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, gefährdet sich selbst. Die Wirtschaft verkauft uns ihr Streben nach unbegrenztem Wachstum als unseren Fortschritt.
Dabei nimmt sie die Überschuldung der Haushalte, mögliche Geldentwertungen, Verlust an Arbeitsplätzen, soziale Ungleichgewichte sowie die Erosion unserer Demokratie in Kauf.
Vor allem bedeutet Wirtschaftswachstum aber den Verbrauch aller Ressourcen, die für uns lebensnotwendig sind.
In der Demokratie ist die Freiheit des einen dort begrenzt, wo sie in die Rechte des anderen eingreift.
Vorwort
Ich bin Betriebswirt und habe mich als solcher mehr als 30 Jahre mit dem wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen befasst. Es ist für mich klar, dass der Erfolg eines Unternehmens von staatlichen Eingriffen in der Regel behindert und nicht gefördert wird. Ebenso ist für mich evident, dass Staaten und deren Organisationen schlechte Unternehmer sind. Nahezu jedes im Privatbesitz befindliche Unternehmen wird besser geführt. Frei Handel betreiben zu können, seine unternehmerischen Chancen und Potenziale ungehindert entwickeln und nutzen zu können, ist zweifellos der ideale Nährboden für ein gut geführtes Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Aus meiner betriebswirtschaftlichen Sicht bin ich daher ein Anhänger der freien, möglichst unbehinderten Marktwirtschaft.
Allerdings bin ich nicht nur Betriebswirt, sondern auch ein Mensch mit philosophischen Interessen und vor allem Vater und Großvater. Der Wachstumsfetischismus unserer Wirtschaft war mir schon in meinen jungen Jahren nicht selbstverständlich. Alles was wächst, muss auch einmal damit aufhören.
Der Missbrauch und die Zerstörung unserer Umwelt, die Industrialisierung der Landwirtschaft, die Kommerzialisierung fundamentaler Lebensbereiche als Geschäftsfelder und vieles mehr, waren für mich Zeichen einer bedrohlichen Entwicklung.
Mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall der UdSSR schien die Begeisterung der westlichen Welt, über den Kommunismus gesiegt zu haben, nicht mehr zu bremsen. So als ob zuvor die UdSSR gerade noch eine grenzenlose Dominanz der Wirtschaft im Westen zurückgehalten hätte, folgte 1989 ein weltweiter Durchbruch der wirtschaftsliberalen Ideen, beginnend mit Reaganomics und Thatcherismus. Die Staatsverschuldung setzte zu einem teilweise schwindelerregenden Höhenflug an, der durch die Krise des Jahres 2008 nochmals heftig angeheizt wurde.
Ich war verwirrt, denn gerade ein so renommierter, eher dem linken Lager zugerechneter Volkswirt wie Stiglitz setzte sich trotz dieser Krise heftig für eine zusätzliche Neuverschuldung ein.1 Für ihn basiert die Behauptung, dass der Staat durch seine Ausgabenpolitik die Wirtschaft ankurbeln könne, auf einer ihm simpel erscheinenden Logik: Wenn die Regierung die Ausgaben erhöht, wächst das BIP um ein Mehrfaches. Er meinte, Staatsausgaben fließen selbstredend in arbeitsplatzgenerierende Wirtschaftsinvestitionen2.
Er übersah u. a., dass diese Investitionen keineswegs erfolgreich sein müssen oder nur dazu genutzt werden, die Kapitalrendite zu steigern und/oder in einer globalen Wirtschaft Arbeitsplätzen an anderen Orten der Welt zu schaffen. Er glaubte scheinbar, dass man Staatsschulden direkt gegen Arbeitsplätze im eigenen Land tauschen könne und die Schuldenrückzahlung ohnedies kein Problem wäre.
Das Prinzip, die Wirtschaft zu fördern, alle Freiheiten zu gewähren, bei schlechter Konjunktur durch die Aufnahme von Staatsschulden in die Wirtschaft zu investieren, um Beschäftigung und Arbeitseinkommen für die eigene Bevölkerung zu generieren, begann jedoch bald, Risse zu zeigen.
Die Moral eines Teiles der Bankenwelt, die bis 2008 hemmungslos Betrug mit sogenannten Asset Backed Securities3 betrieb, war ein lautes Warnzeichen. Hier schrie eine ganze Branche aus den USA in die Welt hinaus: Wir nehmen euch alles Geld ab, das wir kriegen können und scheren uns nicht um die Folgen!
Was aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll erschien, gewann aus volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht eine zunehmend andere Bedeutung. Der Mensch ist zwar der kleinste gemeinsame Nenner dieser Entwicklungen, aber keineswegs deren Mittelpunkt, sondern oftmals lediglich Hilfsmittel oder gar Werkzeug. Für wen tun wir aber dann das alles, wenn nicht für den Menschen?
In diesem Buch werde ich an Hand öffentlich zugänglicher Daten eine gegenwärtige Entwicklung aufzeigen, die meiner betriebswirtschaftlichen Sicht gänzlich widerspricht.
Damit meine ich besonders, dass unser liberales Wirtschaftssystem sich nicht nur zunehmend selbst bedroht, sondern auch unsere Demokratie, unsere Volkswirtschaften und vor allem unsere Umwelt.
Infolge dieses Wirtschaftsliberalismus konnte die Wirtschaft uns und unseren Planeten in Besitz nehmen und nutzen. Diese Nutzung ist jedoch immer unverantwortlicher geworden und bedroht unsere ökonomische Zukunft, die Gesundheit und den Fortbestand nicht nur unserer Spezies.
Die Freiheit des Menschen, die Würde und Achtung des Lebens, die Schönheit und Vielfalt unserer Welt werden gröblich missachtet, wenn sie auf ihre wirtschaftliche Bedeutung reduziert und bis zur ökonomischen Unbrauchbarkeit genutzt werden.
Ich halte nichts davon, so weiter zu wirken wie bisher, im unerschütterlichen Vertrauen, dass wir zwei Meter vor dem Abgrund schon eine Lösung finden werden. Dazu ist mir das Leben meiner Kinder und Kindeskinder zu wichtig.
Ich möchte mich in meiner Kritik jedoch von jeder politischen Zuordnung fernhalten. Es erscheint mir notwendig, keiner der gängigen politischen Kategorien das Wort zu reden. Dies nicht nur, um persönlich Distanz zu wahren, sondern auch, weil ich keinen politischen Standpunkt kenne, der ein funktionsunfähiges Wirtschaftssystem befürworten würde.
Mein Ansatz zur Änderung, zur Emanzipation des Lebens gegenüber den ökonomischen Interessen der Wirtschaft, ist die Erneuerung und Erstarkung der Demokratie.
In einer aufgeklärten Welt wird die Macht des Volkes von der Demokratie repräsentiert. Diese hat die Aufgabe, diese Kraft gegen die globalen Kräfte einer sich verselbstständigenden Wirtschaft einzusetzen. Die Demokratie zu stärken, ist keineswegs leicht oder einfach. Das zunehmende Ungleichgewicht von Einkommens- und Vermögensverteilung fördert Protest- und Rechtswähler-Potenzial und keineswegs demokratische Kräfte.
Dennoch führt kein Weg an der Demokratie vorbei. Ein Konzept der Verantwortung für uns, unsere Nachkommen, für die Mitmenschen und für den gesamten Lebensraum und seine Mitbewohner ist unausweichlich notwendig. Das Streben nach einer gerechten Verteilung von Knappheit und Überfluss klingt in einer Zeit, in der Bildung zumeist nur mehr Berufsausbildung bedeutet und die Nachrichten des Tages nicht gelesen, nicht gesehen oder nicht verstanden werden, fast utopisch. Aber genau diese Utopie ist lebensnotwendig – dorthin sollte unser Weg führen.
Ein demokratisch hilfreicher Gedanke, der sich durch die Themen dieses Buches zieht, ist der einer inneren Verwobenheit, der gegenseitigen Abhängigkeit in Form von verschiedenen Kreisläufen.
Dem gegenüber versteht sich die Wirtschaft eher eindimensional und linear: Weniger Kosten bessere Wettbewerbsfähigkeit mehr Umsatz mehr Gewinn.
Weniger Kosten bedeuten aber mehr Verbrauch einer Umwelt, die nur deshalb keinen Preis hat, weil sie niemand verkaufen kann. Ihre Kosten holen uns aber dennoch über die Emissionen, den Verlust an Lebensraum und an Biodiversität ein. Wie werden unsere Nachfahren ihre Eltern und Großeltern beurteilen, wenn sie ihnen nur den Abfall eines industriellen und postindustriellen Zeitalters hinterlassen?
Der Umsatz des Unternehmens resultiert letztlich aus dem Konsum der Kunden, welcher, volkswirtschaftlich gesehen, aus jenem Arbeitseinkommen, das seinerseits die Lohnkosten des Unternehmens darstellt, finanziert wird. Umsatz und Arbeitseinkommen sind daher untrennbar aufeinander angewiesen. Beide sind allerdings gefährdet, wenn Arbeitsplätze durch Verlagerung oder Rationalisierung verloren gehen. Sie sind ebenso bedroht, wenn Umsätze immer mehr mangels Einkommen aus Krediten finanziert werden, welche infolge der steigenden Überschuldung nicht zurückbezahlt werden können.
Viele sehen diese Kreisläufe nicht und meinen, überall nur ihren Vorteil einseitig für sich nutzen zu können. Dabei verhalten sie sich wie Zechpreller, die im Glauben leben, ihren Konsum niemals bezahlen zu müssen: Diesen Konsum halten sie für Fortschritt.
Nach den Zerstörungen des 2. Weltkrieges war vieles wiederaufzubauen und es galt die Not und die Entbehrungen durch Fleiß, Einsatz, Mut und Ideen zu lindern.
Heutzutage dagegen sitzen wir alle in einem Zug, der längst seine Haltestelle übersehen hat. Wir haben in vielen Ländern angemessenen Wohlstand erreicht, fahren jedoch weiter und weiter, so als ob dieses Geleis nie enden wollte. Doch auch in unserer Welt enden Geleise natürlich irgendwo, auch wenn man den Zug nicht bremst.
1 Joseph Stiglitz, geboren 1943, Professor für Volkswirtschaft in Yale, Princeton, Oxford, Stanford und Columbia, Wirtschaftsberater der Clinton Regierung, Wirtschaftsnobelpreisträger 2001, 1997 bis 2000 Chefökonom der Weltbank und von 2011 bis 2014 Präsident der International Economic Association
2 Josef Stiglitz, Der Preis der Ungleichheit, Pantheon Verlag 2014, Seite 306, 307
3 Asset Backed Securities sind Wertpapiere, hinter denen Kreditforderungen einer Bank stehen. Diese Kredite werden in Pakten zusammengefasst und als Wertpapier verkauft. Dieserart kommt die Bank früher zu ihrem Geld und hat auch gleichzeitig das Kreditrisiko abgegeben. Wenn diese Kredite an Kreditnehmer gewährt werden, deren Bonität nicht ausreichend geprüft wurde und die nicht in der Lage sind diese Kredite zurückzuzahlen, ist das Wertpapier wertlos.
1. Der freie Markt funktioniert nicht
1.1. Die Illusion des Adam Smith
Medizin hat die Aufgabe, dort zu helfen, wo es medizinisch notwendig ist. Ebenso hat die Wirtschaft die Aufgabe, dort für die ausreichende Versorgung mit Wirtschaftsgütern wirksam zu werden, wo diese gerade gebraucht werden.
Wirtschaft ist ein Versorgungssystem und der Erfolg der Wirtschaft besteht darin, Überschüsse sinnvoll zu verwenden sowie Mängel zu verhindern bzw. abzubauen. Mangel und Knappheit sind also mit Überflüssen möglichst auszugleichen und dieser Ausgleich ist fair zu gestalten.
Dafür ist zuerst ein Überfluss erforderlich, denn ohne diesen kann überhaupt kein Ausgleich stattfinden.
Allerdings ist nicht jeder Überfluss ausreichend oder dafür geeignet, Knappheit auszugleichen. Überfluss bedarf somit der vorhergehenden Gestaltung (Anpassung), um Knappheit gerecht werden zu können. Dieses Zusammenspiel zwischen Knappheit und Überfluss ist nicht nur auf der Seite der menschlichen Arbeitskraft, sondern ebenso auf der Seite jener Ressourcen und Kapazitäten gegeben, die zur Lieferung und Herstellung benötigter Wirtschaftsgüter erforderlich sind. Wirtschaft hat somit sowohl auf der Nachfrageseite (des Käufers) als auch auf der Seite des Angebotes bzw. des Beschaffungsmarktes mit Knappheit und Überfluss zu kämpfen.
Das Gesetz von Angebot und Nachfrage besagt nun, wenn sich das Angebot des Beschaffungsmarktes hinsichtlich Qualität, Menge und Preis mit der Nachfrage der Käufer trifft – wenn also der Käufer genau jene Ware zu jener Qualität, Menge und Preis kauft, wie sie ihm am Markt angeboten wird – dann ist das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gegeben.
Dieses Gleichgewicht resultiert nach Adam Smith aus dem Wettbewerb der eigennützig-rationalen Einzelinteressen der Wettbewerber.
»Die maximale Wirtschaftlichkeit (der vollkommene Markt) zeichnet sich dadurch aus, dass die Zufriedenheit aller Marktteilnehmer erreicht wurde und keine Änderungen in der Herstellung als auch im Vertrieb des Wirtschaftsgutes daher notwendig sind. Die maximale Wirtschaftlichkeit erfordert, dass alle Unternehmen perfekte Konkurrenten sind und keine wettbewerbsverzerrenden Faktoren wie z. B. Umweltverschmutzung oder Informationsvorteile vorliegen. Die maximale Wirtschaftlichkeit ist gegeben, wenn (a) die Zufriedenheit des Konsumenten deshalb vorliegt, weil sein Grenznutzen4 seinem Kaufpreis entspricht und (b), wenn die konkurrierenden Unternehmen die Wirtschaftsgüter in jener Menge anbieten, bei der der Verkaufspreis ihren Grenzkosten5 entspricht. Allerdings kann der Wettbewerb, auch wenn maximale Wirtschaftlichkeit vorliegt, zu Ergebnissen führen, die sozial nicht erwünscht sind6.«
Dieses Zitat aus dem weit verbreiteten Wirtschaftslehrbuch von Paul Samuelson beschreibt das Ideal der maximalen Wirtschaftlichkeit als ein Gleichgewicht der auf dem Markt wirksamen Kräfte. Die Selbstorganisation des Marktes besteht darin, dieses Gleichgewicht zu ermöglichen.
So selbstverständlich diese noch heute als gültig angesehene These auch scheinen mag, sie geht von komplett unrealistischen Annahmen aus.
Was hat die Knappheit, die es zu überwinden gilt, mit jenen auf den Märkten wirksamen Kräften zu tun? Wie soll jener, der unter der empfindlichsten Knappheit leidet, seine (doch oftmals schwachen) Kräfte am Markt überhaupt zur Geltung bringen? Es liegt im Wesen wirtschaftlicher Schwäche, dass daraus Knappheit und Mangel resultieren. Flüchtlinge werden z. B. erst am Markt wirksam, wenn sie in entsprechend hoher Anzahl bei uns in Westeuropa landen. Ihr Bedarf, ihre Knappheit hat schon lange zuvor ohne für uns erkennbare Auswirkungen bestanden, ohne dass der Markt etwas gegen ihren Mangel getan hätte. Erst wenn sie unseren ethischen Vorstellungen entsprechend versorgt werden, wird deren Knappheit an Lebensmittel, Bekleidung, medizinischer Versorgung, Wohnraum etc. wirksam. In ihren Heimatländern existieren, wenn überhaupt, kaum Märkte, weil weder das Angebot noch die notwendigen Geldmittel zur Befriedigung der Nachfrage vorhanden sind.
Es geht aber nicht nur um die mangelnde Marktkraft infolge wirtschaftlicher Schwäche, sondern z. B. ebenso um sinnvolle Interessen, die gar nicht oder nur unzureichend wahrgenommen werden.
Ein Wissenschaftler, der z. B. darauf hinweist, dass wir unsere Nachkommen gefährden, wenn wir weiterhin die Umwelt mit Kunststoffen belasten, wird am Markt so lange nicht gehört, bis erhebliche Schäden eingetreten sind. Als Wissenschaftler hat er weder einen Zugang zum Markt, noch eine Möglichkeit, auf den Markt einzuwirken. Seine Stimme wird nicht infolge seiner Kompetenz oder des Gewichtes seiner Botschaft gehört, sondern zumeist nur wegen der zu berichtenden, bereits eingetretenen Schäden.
Wirtschaftlich Unterprivilegierte, an Konsum uninteressierte Menschen, Menschen ohne aktuellen eigenen Bedarf, unzureichend wirtschaftlich Informierte, Vertreter der Kunst, Philosophie und Wissenschaft sind am Markt bestenfalls als Autoren von handelbaren Büchern, nicht aber als aktive Teilnehmer anzutreffen.
Anderseits bestehen Überflüsse, die dem Markt nicht zur Verfügung stehen, weil jene, die darüber verfügen könnten, deren Wert entweder gar nicht erkennen oder an keinem materiellen Vorteil interessiert sind. Immer wieder beobachte ich zum Beispiel in Griechenland die herabfallenden und verderbenden Feigen und Kaktusfrüchte, die in Mitteuropa vermutlich ihre Käufer finden würden, wenn sie am internationalen Markt im Ausmaß ihres vorliegenden Überflusses angeboten werden würden. Mancher Überfluss erreicht den Markt nicht, weil die Kosten, um ihn handelbar zu machen, zu hoch sind. Umgekehrt wird mancher drohende Preisverfall dadurch verhindert, dass Teile des Überflusses, z. B. bei einer guten Kaffeeernte, vernichtet werden.
Mit zunehmender Knappheit, aber auch mit wachsendem Überschuss fällt der freie Markt als Ort des sinnvollen Ausgleichs gänzlich aus: Je größer die Armut, desto größer die Knappheit, umso geringer die Fähigkeit am Markt teilzunehmen bzw. einen Marktpreis zu bezahlen. Umgekehrt führt ein höherer Überfluss nicht zu einer noch besseren Versorgung, sondern zu einem Preisverfall. Dadurch erscheint es aus der Sicht des Produzenten sinnvoller, den Preisverfall durch teilweise Vernichtung des Überschusses zu verhindern, um mit weniger Ware, aber höheren Preisen den gleichen oder höheren Gewinn zu erzielen.
Welches Gleichgewicht kann sich unter derartigen Umständen überhaupt bilden?
Knappheit und Überfluss können am Markt nie vollständig wahrgenommen werden, die sogenannten verzerrenden Faktoren sind allgegenwärtig, die Konkurrenten sind zwangsläufig niemals perfekt (im Sinne eines gleichen Potenzials) und die zunehmende Intensität von Knappheit und/oder Überfluss führt nicht zu einem Gleichgewicht, sondern zu einem Totalversagen des Systems.
Das Gleichgewicht, das Adam Smith vorschwebte, ist eine kaufmännische Fiktion. Weder gibt es den von ihm unterstellten vollkommenen Markt, auf dem alle Marktteilnehmer über die gleiche Marktmacht verfügen, noch gibt es die vollständige Information, die allen Marktteilnehmern zur Verfügung steht. Keineswegs verfügen alle Beteiligten über die Möglichkeit, den Markt zu beeinflussen.
Der Umgang mit Knappheit und Überfluss kann von einem derartigen Markt nicht reguliert werden: Er repräsentiert weder die Interessen der Gesellschaft insgesamt, noch ist er in der Lage, die tatsächlich vorhandenen Knappheiten und Überflüsse zu erfassen. Der Markt als Ort des Zusammentreffens aller Angebote und Nachfragen sowie aller gesellschaftlichen Interessen scheint ohne gesellschaftliche Eingriffe nicht möglich (so viel Freiheit wie möglich – so viel Eingriffe wie notwendig).
Der von Adam Smith beschriebene Markt ist dagegen in der Wirklichkeit ein Treffpunkt ausgewählter Wirtschaftstreibender, die über höchst ungleiche Chancen verfügen. Deren Konkurrenz gleicht einem Wettkampf unter Athleten, die keineswegs von Gleichgewicht und Zufriedenheit, sondern nur von Sieg und Niederlage geprägt ist.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Berufsgruppe der Kaufleute wie Heilsbringer ihre so nett klingende Fassade eines freien Marktes allen anderen Menschen als alleingültige Sichtweise übergezogen hat. Hinter dieser Fassade geht es jedoch in Wirklichkeit nicht darum, Marktkräfte frei wirksam werden zu lassen, sondern darum, die Marktkräfte so zu beeinflussen, dass auf den Märkten jenes Preis-Leistungsgefüge eintritt, welches für das eigene Unternehmen vorteilhaft ist. Nicht das freie Spiel der Marktkräfte, sondern die Manipulation der Marktkräfte zum Zweck des eigenen Vorteiles ist das Ziel. Informationen, die Preis- und Produktpolitik werden strategisch so gestaltet, dass angestrebte, vorteilhafte Marktsituationen möglichst wahrscheinlich eintreten.
Es wird alles versucht, um keine perfekte Konkurrenz und um möglichst viele verzerrende Faktoren entstehen zu lassen, um aus einem möglichst großen Ungleichgewicht eigene Vorteile ziehen zu können. Täglich können wir miterleben, wie Unternehmen im wirtschaftlichen Wettkampf miteinander umgehen. Kaufmännische Konkurrenten besiegen entweder einander (was zum Untergang des Unterlegenen führt) oder, wenn sie tatsächlich über ähnlich große Potenziale verfügen, dann trachten sie danach, ihre Vorteile so zu maximieren in dem sie sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern sich gegenseitig zu Lasten der Gesellschaft unterstützen.
Ähnlich wie bei den heutigen Neoliberalen7 meinte man auch in der Aufklärung, dass das freie Spiel der Marktkräfte zur allgemeinen Zufriedenheit führen würde.
Die von der Aufklärung8 geschätzte freie Wirtschaft stellt einen vom Wunschdenken geprägten Trugschluss dar. Nicht die Gesellschaft wird durch eine freie Wirtschaft frei, sondern lediglich einige Akteure, vor allem in der Wirtschaft, können frei, scheinbar ungehindert von den Interessen der Mehrheitsgesellschaft, agieren.
Dieses Verhalten ähnelt mehr einem Glücksspiel oder einem unsportlich geführten Wettbewerb als einem vernünftigen Wirtschaften.
1.2. Das Märchen vom Fortschritt
Begriffe wie Entwicklung, Fortschritt, Modernität sind vor allem dann positiv besetzt, wenn man der Gegenwart oder Vergangenheit wenig Positives abgewinnen kann. Dabei sind verschiedene Argumentationslinien erkennbar.
Eine besteht darin, mit Geld jeden Mangel beheben zu können. Wenn man krank ist, besteht Fortschritt in der wieder erlangten Gesundheit, wenn man Hunger hat, darin, satt zu werden, wenn die Behausung kalt und zugig ist, über eine bessere Wohnung zu verfügen und wenn man ungebildet ist, darin, Bildung zu erlangen und Schulen zu besuchen. Hat man Geld, kann man sich den Arzt und die Medikamente, die notwendigen Lebensmittel, die Wohnung sowie die Kosten der Ausbildung leisten. Wie kommt man zu Geld? In dem man am Spiel der Kaufleute teilnimmt! Geld ist also das Mittel, um fortschrittlich sein zu können! Daher, wenn alle den freien Markt anstreben und sich selbst auch an die kaufmännischen Regeln halten (immer den eigenen Vorteil anstreben), dann haben alle Geld und der Fortschritt ist gesichert.
Eine zweite Argumentationslinie liegt im sogenannten technischen Fortschritt. Dahinter steht der Wunsch des Menschen, sich von seinen natürlichen Restriktionen weitestgehend frei und unabhängig zu machen. Um sich vor Krankheiten zu schützen, um neue medizinische Behandlungen zu finden, um Entfernungen zu überwinden, um neue, gesunde Wohnungen bauen zu können, um sich jederzeit informieren, aber auch unterhalten zu können – dazu bedarf es neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und einer Wirtschaft, die daraus neue Produkte zum Wohl der Menschen entwickelt. Durch diese immer wieder neuen Produkte entständen auch immer wieder neue Arbeitsplätze, so dass immer mehr Menschen genau jenes Einkommen, genau jenes Geld verdienen, welches für den persönlichen und gesellschaftlichen Fortschritt notwendig ist. Und, da man wohl gegen diesen sogenannten Fortschritt, durch den alles ja besser wird, kaum argumentieren kann, ist Fortschritt etwas, von dem man nie genug haben kann!
Der Wettbewerb der Marktteilnehmer, das Wachstum der Wirtschaft, ist nicht an einem bestimmten Ziel zu Ende, sondern setzt sich als Mittel des Fortschrittes endlos fort. Die Vorteilsmaximierung wird mit dem Fortschritt gleichgesetzt. Diese Vorteilsmaximierung ist somit unbegrenzt, denn sie kennt keinen konkret messbaren Zielpunkt, sondern nur den endlosen Fortschritt.
Dort, wo die materiellen Grundbedürfnisse bereits befriedigt sind, stellt jeder neue Vorteil zwar bereits einen Überfluss dar, es wird aber keine Sättigung wahrgenommen. Der Überfluss wäre aus dem Vergleich mit dem vorhergehenden Status, oder aus einer bestimmten Notwendigkeit erkennbar. Da aber kein Ziel definiert ist und kein Vergleich im Sinne einer Befriedigung stattfindet, ist der maximale Vorteil ein letztlich unerreichtes und daher immer neu anzustrebendes Ziel.
Dieser Überfluss ist eine direkte Auswirkung des hier beschriebenen Begriffes von Fortschritt: Er stellt etwas selbstverständlich Unendliches dar, auf das man sogar meint, einen persönlichen Anspruch zu haben. Man hat diesen Überfluss angestrebt, um im sozialen Rang höher als andere zu stehen, um es schlicht besser zu haben als es einmal war, und dennoch, man nimmt ihn nicht wirklich wahr. Man meint, darin den Nachweis bisheriger Fortschritte zu erkennen, empfindet aber nicht jene Befriedigung, die dazu führen würde, im weiteren Streben nach Überfluss nachzulassen.
Dieser Fortschritt ist wie eine Droge, welche man konsumiert, von dem man aber nie satt wird.
Gleichzeitig wird es immer selbstverständlicher, mit den erworbenen Wirtschaftsgütern immer weniger fürsorglich umzugehen. Deren kurzfristige Lebensdauer wird zum Ausdruck des dauernden Verlustes an Wertschätzung und Beziehung, es entsteht die sogenannte Wegwerfmentalität. Der Zuwachs an wirtschaftlichen Vorteilen führt zum Zuwachs an Wirtschaftsgütern, die jederzeit nachbeschafft werden können und dadurch an Bedeutung verlieren.
Diese Art von Überfluss bedingt den Verlust der Fähigkeit, mit tatsächlicher Knappheit umzugehen ebenso, wie den Verlust des Strebens nach Werthaltigkeit. Was an sich überflüssig ist, dem kann keine besondere Wertschätzung zukommen und was keinen subjektiven Wert besitzt, kann diesen auch nicht halten. Abgesehen davon scheint die Vorstellung der andauernden Wiederbeschaffbarkeit nicht nur auf Dinge, sondern immer mehr auch auf Menschen (sowohl als Partner wie auch als Mitarbeiter) bezogen zu werden. So ist scheinbar ein von Werte- und Beziehungslosigkeit geprägtes Wirtschaftsleben vom restlichen Leben nicht mehr zu trennen.
Jene Strategie, deren Ziel in der Vorteilsmaximierung liegt, entfernt sich mit zunehmendem Erfolg von ihrem eigentlichen Ziel. Zwar besitzen die Menschen immer mehr an Vorteilen und Gütern, der subjektive Wert des Einzelgutes aber nimmt mit der Summe der Vorteile und Güter immer mehr ab. Jeder kennt das Phänomen, dass etwas hohen Wert besitzt, das besonders schwierig zu bekommen ist und worauf man lange warten muss. Und wie schnell ist es mit dieser Wertschätzung vorbei, wenn man es nicht nur einmal sondern x-mal haben kann und alle anderen es ebenso besitzen?
Der subjektive Wert, die Wertschätzung und damit auch die Sinnhaftigkeit und die Beziehung liegen im Besonderen. Das Besondere ist aber niemals das beliebig verfügbare, sondern das knappe Gut.
Es liegt auf der Hand, jene Knappheit, vor allem, wenn sie lebensbedrohend werden kann, möglichst rasch zu überwinden. Auch stellen Knappheit hinsichtlich von Behausung, Bekleidung und Bildung von Menschen eine nicht zu begründende Einengung und Reduktion der Entwicklung des Einzelnen dar. Andererseits führt jeder Überfluss zur Reduktion der Sparsamkeit, zur Verringerung jenes sorgsamen Umganges, der zur besonderen Wertschätzung zwingt.
Not und Lebensbedrohung ist zu überwinden, aber nur jener Wohlstand, der immer noch Knappheit spüren lässt, stellt bildungsunabhängig den sparsamen Umgang mit den Ressourcen sicher und führt zu einem reichen Beziehungsleben. Jede Wertschätzung, auch den einfachen Dingen gegenüber, stellt eine neue Beziehung dar, die vielleicht nur für kurze Momente, aber dennoch beglücken kann.
Die Beziehung zu Dingen mag gegenüber den Beziehungen zu Menschen unwichtig erscheinen. Aber die Beziehung zu unserem Umfeld und seinen einzelnen Dingen ist Voraussetzung zu einem universellen Lebensverständnis. Jede Beziehung und sei sie noch so klein und scheinbar unbedeutend, ist Teil eines sinnstiftenden Lebensverständnisses.
Das Märchen vom Fortschritt durch die Wirtschaft führt nicht zu einer Optimierung der Verwendung von Überschüssen zur Minimierung der Knappheit. Das Fortschrittsmärchen ist nur dazu da, immer neue Produkte, immer neue Umsätze und damit neue Gewinne zu tätigen. Der dauernde Überschuss auf der einen Seite und die Unterversorgung auf der anderen Seite und deren Folgen, sind dabei in Kauf genommene Kollateralschäden.
Dem gegenüber gibt es jedoch auch sinnvollen und durchaus wesentlichen Fortschritt: Ob es sich um den medizinischen Fortschritt handelt, der sich in der Verringerung der Säuglingssterblichkeit oder der Verlängerung der Lebenszeit ausdrückt, die Verbesserung elektronischer Kommunikation, der Transportmöglichkeiten, der Erforschung unseres Planeten und des Weltalls – alles das sind Beispiele für eine Art von Fortschritt, die dem Leben dienen kann und der menschlichen Spezies tatsächlich hilft.
Offenbar hat das Wirtschaftssystem bisher beide Entwicklungsstränge hervorgebracht.
1.3. Der Fortschritt der Wirtschaft orientiert sich am wirtschaftlichen Ergebnis und nicht an der Ethik
Unternehmen fühlen sich nicht der Gesellschaft, sondern den Unternehmenseignern und dem eigenen Ergebnis gegenüber verantwortlich. Die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wird nicht als dem Wohl der Gemeinschaft, deren Kultur und deren Entwicklung verstanden, sondern beschränkt sich oft auf die Einhaltung von Gesetzen. Die derart generierten Wirtschaftsgüter dienen daher in erster Linie nicht dem Fortschritt, nicht der Gesellschaft, sondern dem Unternehmen und deren Umsatz- und Gewinnzielen.
Diese Entwicklung hat durch die Globalisierung eine unbeherrschbare Dimension angenommen. Über alle nationalen, kulturellen und ethischen Vorstellungen hinweg ist der wirtschaftliche Vorteil die einzige, global gültige Wertvorstellung. Die philosophisch-ethische Entwicklung der Menschen wird zu einer Parallelentwicklung zurückgedrängt. Die gesellschaftliche Organisationsform der Demokratie ist für die Wirtschaft eher hinderlich als hilfreich. Lobbying, wirtschaftlicher Druck und Handelsverträge helfen der Wirtschaft, die Willensbildung in den Staaten auszuhöhlen. Dieser Gedanke wird im Abschnitt „2. Die Wirtschaft hat sich der Ethik zu beugen“. ausgeführt.
Das sinnlose Streben nach dauerndem Zuwachs und Überschuss führt zu unverantwortlicher Ressourcenverschwendung. Nicht nur, dass der ökologische Fußabdruck des Menschen vor allem in den Ländern der Nordhalbkugel laufend wächst, es werden Ressourcen teilweise unwiederbringlich aufgebraucht und/oder zerstört. Immer mehr Produkte, die mehr schaden als nützen werden produziert. Allerdings sitzen in der Regel die Menschen, welche einen Nutzen aus dieser Entwicklung ziehen können in den reichen, und die Menschen, die die Nachteile tragen müssen, in den armen Ländern.
Dazu kommt, dass die wertvollste Ressource, die Freiheit des Menschen, einer Datenabsaug- und Überwachungsmentalität geopfert wird. Das Internet wird zur Vollendung des Gedankens, den Menschen zum Gewinnlieferanten der Wirtschaft, auf eine Ware zu reduzieren. Es ist eine neue Form des Sklavenhandels: Die Natur und der Mensch werden versklavt, wobei es der menschliche Sklave möglichst nicht bemerken soll. Dazu mehr im Abschnitt„3. Der Verbrauch von Ressourcen zerstört unseren Lebensraum“.
Der endlose Fortschrittsbegriff führt zu der Vorstellung eines endlos möglichen Wirtschaftswachstums. Wachstum jedoch resultiert aus zusätzlichem Umsatz, den irgendjemand als Abnehmer bezahlen muss. Endloses Wachstum führt somit zu endlosem Umsatz und dieser wieder zu endlosen Geldmitteln. Da es diese nicht gibt, besteht der Lösung darin, die Geldmengen zu steigern und endlos Kredite zu gewähren. Der Schritt zur Überschuldung ist die logische Konsequenz. Nachdem aber Endlosigkeit bestenfalls als Vorstellung und nicht in der Realität existiert – jede überschießende Entwicklung führt zum Kollaps – gibt es weder endloses Wachstum noch endlose Geldmittel. Dazu Daten und Entwicklungen im Abschnitt „4. Das Schuldenwachstum für das Wirtschaftswachstum“.
Jene Menschen, die in der Wirtschaft erfolgreich sind, können tatsächlich ein höheres Einkommen und einen Zuwachs an materiellen Gütern erzielen. Was passiert aber, wenn ihre Arbeitskosten zu teuer werden und die Produkte in Billiglohnländern oder durch Roboter hergestellt werden? Der Kreislauf zwischen dem Arbeitsverdienst und den Ausgaben der bisher arbeitenden Menschen bricht mit den Folgen der Verarmung auseinander. Die sogenannte Dienstleistungswirtschaft kann dieses Problem nicht lösen. Eine Wirtschaft, welche den Kreislauf zwischen Käufer und Verkäufer, zwischen Einkommen und Umsatz, nicht berücksichtigt, kann niemals nachhaltig funktionieren. Der Abschnitt: „5. Wirtschaft ist ein Kreislauf“ zeigt diese katastrophale Logik des Wirtschaftssystems auf.
Die unbegrenzte Gewinnmaximierung als Ziel der Wirtschaft führt zwangsläufig dazu, dass jene von dieser Gewinnmaximierung profitieren, die mehr an Geld und Vermögenswerten besitzen. Allen anderen geht es dementsprechend schlechter. Es ist die alte Auseinandersetzung zwischen dem Kapital einerseits und der menschlichen Arbeit anderseits: Je weniger menschliche Arbeit kosten darf, je mehr diese durch Maschinen ersetzt wird, desto mehr steigt die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Jene, die über Einkommen aus Kapital verfügen, sind daher in einer besseren Lage, als jene, die nur Einkünfte aus menschlicher Arbeit erzielen. Auch wenn in Billiglohnländern neues Einkommen für die dortige Bevölkerung geschaffen wird, so ist das lediglich ein temporärer Nebeneffekt auf dem Weg, die Kapitalrendite zu steigern. Die Ungleichheiten, wie sie früher vor allem durch die Konzentration des Grundbesitzes und heute durch Konzentration des Kapitals verursacht wird, wachsen und destabilisieren die Gesellschaft. Lesen sie mehr dazu im Abschnitt „6. Die Ungleichheit“.
Fortschritt im Sinne der Wirtschaft degeneriert das menschliche Leben zum Produktionsfaktor. Dies stellt eine ungeheuerliche Abwertung des Lebens dar. Das Verständnis menschlicher Arbeit wird so durch autoritäre Erfahrung, Unterdrückung und Ausbeutung bestimmt. Arbeit als Produktionsfaktor zu betrachten ist bis heute ein unkritisch übernommener Teil der Volkswirtschaftslehre. Sie ist Ausdruck einer lediglich auf die Ökonomie der Kaufleute begrenzte Betrachtung. Wie der Bauer sein Vieh einschätzt, so wird von der Wirtschaft der Mensch als Arbeitstier (bis auf wenige Ausnahmen) gesehen.
Vermutlich liegt der Fehler im ursprünglichen Ansatz, die Wirtschaft von der Gesellschaft getrennt zu betrachten.
Diese Ausbeutung wird von Wirtschaft und Gesellschaft geschönt und maskiert. Scheinbar sehen auch die Gewerkschaften das Grundproblem nicht und versuchen lediglich die Bedingungen dieser Ausbeutung zu verbessern.
Die Qualität der Arbeit als Element einer sinnstiftenden und befriedigenden Lebensführung geht dabei verloren.
Quantitative Leistungsvorstellungen, die immer mehr aufgesplitterte Arbeitsteiligkeit, der häufige Orts- und Arbeitgeberwechsel, die Degradierungserfahrungen einer Kündigung, der Arbeitslosigkeit, verhindern jene Befriedigung, die aus der Arbeit selbst, aus der Identifikation mit den eigenen Fähigkeiten und der eigenen Leistung, aus der Freude an der Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen, erwachsen könnte.
Wie soll aber ein Mensch Selbstverantwortung übernehmen, wenn er sich mit dem, womit er die meiste Zeit seines Lebens verbringt, nicht identifizieren kann? Durch eine derartige Domestizierung von Menschen beginnen Demokratie und Wirtschaft einander auszuschließen.
Ebenso wird Bildung verfälscht und auf die Vorbereitung für die Tätigkeit in der Wirtschaft reduziert. Das damit verbundene Vorteilsdenken führt zur Erblindung gegenüber ethischen Bewertungen: Der Vorteilsbegriff ist auf seine materielle und zumeist auch kurzfristige Komponente reduziert.
Soziale Strukturen, wie die Familie, müssen sich dem ökonomischen Leben unterordnen. Mann und Frau sind dabei gleichermaßen zu Lasten ihrer Kinder gefordert.
Die Emanzipation der Frauen durch Berufstätigkeit war einmal der Kampf um die geistige und wirtschaftliche Unabhängigkeit gegen ein Patriachat. Heute dagegen stellt eine nicht berufstätige Frau eine von der Wirtschaft unerwünschte Störung dar. Sie würde womöglich die Vormachtstellung der Wirtschaft zu Gunsten ihrer familiären Interessen in Frage stellen.
Die Verteidigung dieser Dimensionen menschlichen Lebens können nur von den Menschen selbst wahrgenommen werden. Dazu bedarf es Freiheit und Bildung. Um diese Menschenrechte aber auch in der Gesellschaft zu vertreten, brauchen wir unbedingt die Demokratie. Die demokratische Organisation eines Staates stellt jene Plattform dar, auf der die Menschen den einseitigen Interessen der Wirtschaft gegenübertreten können. Der Abschnitt »„7. Die Demokratie ist der Gegenpol“« versucht Antworten für eine bessere Zukunft zu geben. Es wird darum gehen, klassische Denkmuster von Links und Rechts zu überwinden und die Funktionsfähigkeit eines Wirtschaftskonzeptes in Sinn der gesellschaftlichen und evolutionären Nachhaltigkeit neu auszurichten.
4 Grenznutzen: Der zusätzliche Nutzen einer zusätzlichen Einheit dieses Wirtschaftsgutes. Beispiel: Der Genuss des 2. Glases Glühwein in Relation zum Preis dieses 2. Glases.
5 Grenzkosten: Die zusätzlichen Kosten einer zusätzlich produzierten Einheit eines Wirtschaftsgutes. Beispiel: Wenn der Glühweinstand seine Fixkosten (Standmiete, Personal) durch die bisherigen Verkäufe bereits gedeckt hat, fallen beim Verkauf eines weiteren Glases Glühwein nur mehr variable Kosten (Wein, Gewürze, Energie etc.) an.
6»Allocative efficiency occurs when there is no way of reorganizing production and distribution such that everyone’s satisfaction can be improved. … Efficiency requires that all firms are perfect competitors and there are no externalities like pollution or improved information. Efficiency comes because (a) when consumers maximize satisfaction, the marginal utility just equals; (b) when competitive producer supply goods they choose output so that marginal costs just equals price; … The outcome of competitive markets, even when efficient, may not be socially desirable.« Samuelson, Paul A.; Nordhaus, William D.: Economics, The McGraw-Hill series economics. Boston: McGraw-Hill Irwin, 1998, page 152
7 Unter Neoliberalismus versteht man das politische Konzept, den Einfluss des Staates auf die Wirtschaft (der Staat ist ein schlechter Unternehmer) weitestgehend zurückzunehmen. Dies soll im Wesentlichen durch die Reduktion der Staatsquote (Steuersenkung), Privatisierung staatlicher Aufgaben und einem freien Kapitalverkehr umgesetzt werden.
8 Adam Smith ging davon aus, dass sich der Markt ohne Einmischung des Staates durch die sogenannte unsichtbare Hand, die Angebot und Nachfrage steuert, selbst reguliert.
2. Die Wirtschaft hat sich der Ethik zu beugen
2.1. Die Ethik von Kaufleuten
Bereits in der griechischen Mythologie wird der Gott Hermes9 als Götterbote, aber auch als Gott der Kaufleute und der Diebe bezeichnet. Vermutlich wird durch diese Mehrfachrolle bereits der schmale Grat zwischen einem fairen Geschäft und einem überhöhten Preis (der eigentlich schon Diebstahl darstelle) angedeutet.
Zweifellos ist es eine sittliche Versuchung für jeden Kaufmann, den höchstmöglichen Preis für seine Ware zu verlangen, auch wenn er damit vielleicht eine Notlage oder die Unwissenheit eines Kunden ausnutzt. Die kaufmännische Tugend der Vorsicht muss man als Eigeninteresse interpretieren: Wichtig ist, dass mein Risiko für mein Unternehmen so gut wie nur möglich abgesichert ist, auch wenn jemand anderer dabei draufzahlt.
Die Frage eines fairen, moralisch gerechtfertigten Preises ist kaum lösbar: Das kaufmännische Risiko kann man je nach angenommenem Szenario und vermuteter Eintrittswahrscheinlichkeit höchst unterschiedlich einschätzen, weshalb die daraus resultierende, in den Preis einkalkulierte, Risikoprämie unterschiedlich hoch sein muss. Auch zahlen Kunden um der Exklusivität willen (Snob-Effekt) manchmal bewusst gerne einen höheren Preis. Einschätzungen, Zukunftserwartungen, emotionale Entscheidungen lassen sich nicht einheitlich berechnen und sind daher lediglich dem Urteil der Handelnden unterworfen.
Kaufleute sind seit jeher im anspruchsvollen Spannungsfeld zwischen dem eigenen materiellen Vorteil und der gesellschaftlichen Verpflichtung des Interessenausgleiches tätig. Dabei sind sie in der Regel auf sich gestellt und entscheiden an Hand der Höhe des von ihnen kalkulierten Preises10, ob ihr Handeln ethisch vertretbar ist oder nicht. Allerdings kann ein überhöhter Preis auch von der Gesellschaft (dem Gesetzgeber) oder von Konkurrenten verhindert werden.
Die Einschränkung durch Konkurrenz ist allerdings nicht ethisch motiviert, sondern materiell: Der Kampf um den eigenen Vorteil lässt den überhöhten Preis des Konkurrenten zumeist nicht zu.
Die Ethik in der Wirtschaft befindet sich daher im gleichen Spannungsfeld wie die Ethik des täglichen Lebens: Es gilt, den Interessenausgleich zwischen Menschen in demokratischer Weise herzustellen. Jeder Interessenausgleich hat die Aufgabe, (sinnvolle) Einzelinteressen gegeneinander abzuwägen. Damit wird aber schon jetzt klar, dass eine ungebremste, uneingeschränkte Wirtschaft niemals den Anforderungen eines Interessenausgleiches genügen kann.





























