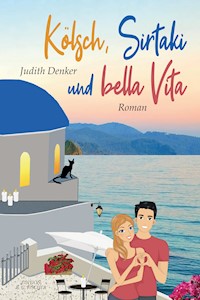
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: R.G. Fischer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Jessica hat eine gute Arbeit, eine kleine Wohnung, ihren geliebten Kater, einen netten Freundeskreis und eigentlich alles, was man zum Glück so braucht. Nach zwei beendeten Liebesaffären genießt sie ihr Singledasein. Dass ihr etwas fehlt, wird ihr erst nach einer Reise bewusst, nach der ihr Leben einen unerwarteten Verlauf nimmt und sie vor einer schwierigen Entscheidung steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
JUDITH DENKER
KÖLSCH, SIRTAKIUND BELLA VITA
ROMAN
Die Handlung dieses Romans sowie die darin vorkommenden Personen sind frei erfunden; eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Begebenheiten und tatsächlich lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 by R. G. Fischer Verlag
Orber Str. 30, D-60386 Frankfurt/Main
Alle Rechte vorbehalten
Schriftart: Arno Pro
Herstellung: RGF/bf/SU F1
ISBN 978-3-8301-9470-5 EPUB
INHALT
Vorwort
1. Kapitel: Reisepläne mit Hindernissen
2. Kapitel: Flashback – Abtauchen in die Vergangenheit
3. Kapitel: Eine Reise, eine Entscheidung und unzählige Bedenken
4. Kapitel: Ein Abflug und eine Ankunft
5. Kapitel: Eine neue Freundschaft und ein gelungener Urlaub
6. Kapitel: Ein Treffen, das den Gang des Lebens verändern könnte
7. Kapitel: Unverhofft kommt oft
8. Kapitel: Eine unerwartete Lovestory
9. Kapitel: Aus der Traum – rein in den Alltag
10. Kapitel: Es geht weiter
11. Kapitel: Bella Napoli
12. Kapitel: Trüber Herbst und kalter Winter
13. Kapitel: Liebe im Schnee
14. Kapitel: Ostern in Neapel
15. Kapitel: Freiheit erfordert Mut
16. Kapitel: Die Probe aufs Exempel: Sommer in Neapel
17. Kapitel: Grau in grau oder Es wird ernst
18. Kapitel: Der Betriebsausflug
19. Kapitel: Vorwärts oder rückwärts?
20. Kapitel: Ein klärendes Gespräch, das rein gar nichts klärt
21. Kapitel: Die Stimme
VORWORT
Warum wird aus einem Leben das, was es wird? Oder anders ausgedrückt: Welche Faktoren, Erlebnisse oder Voraussetzungen sind dafür verantwortlich, dass eine Lebensgeschichte genau diesen Verlauf nimmt, anstatt einen anderen? Vielleicht anstatt jenes Verlaufes, der eigentlich geplant war. Der Ausgang einer gegebenen Situation und eine mögliche Veränderung im Leben hängen nicht ausschließlich von den Entscheidungen, die wir treffen, ab, sondern auch von den Personen, denen wir in einem bestimmten Moment unserer Geschichte begegnen oder Stimmungen, Gemütslagen, die uns die Dinge in einem bestimmten Licht erscheinen lassen und den Ausgang einer Situation beeinflussen. Das gilt auch für ganz banale Entscheidungen, so wie die, wo und wann man einen Urlaub verbringt. Mallorca, Griechenland oder Urlaub zu Hause: Man sollte meinen, dass sich solch ein Entschluss erst einmal nur auf das körperliche und seelische Wohlbefinden der Person auswirkt. Und doch kann ein Ja oder ein Nein Weichen stellen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir unser Schicksal in den Händen haben und es mit einer einzigen Fehlentscheidung total verwirken können. Es könnte doch sein, dass es für jeden von uns einen »Plan« gibt, der sich dann einfach auf anderen Wegen konkretisiert, wenn unsere Entscheidungen uns von ihm entfernen. Also ist es unnötig, sich viele Gedanken über die Zukunft zu machen, denn unser Schicksal steht ja doch schon in den Sternen geschrieben? Das ist wiederum Fatalismus pur.
Ist es also der Zufall, der unser Leben bestimmt? Eine traurige Perspektive, die unserem Dasein den Sinn nimmt und eine bequeme Ausrede für all die Situationen der sozialen und persönlichen Ungerechtigkeit in unserer Welt. Wer hat jemals den Herrn oder die Frau Zufall kennen gelernt? Die größten Denker aller Epochen waren sich durchaus bewusst, dass hinter der Geschichte jedes Menschen und in seinem Ursprung jemand Höheres, jemand nicht menschliches stecken muss. Eben ein Schöpfer. Das heißt, dass es schon ein Projekt gibt, aber dass wir trotzdem frei bleiben in unserer Entscheidung es anzunehmen oder nicht.
Und um auf die oben gestellte Frage zurückzukommen: Warum wird aus einem Leben das, was es wird, liegt die Antwort vielleicht genau hier. Sind wir tatsächlich die Allmächtigen, die wir zu sein vortäuschen? Hängt wirklich der Gang der Dinge von unseren Handlungen, unseren Entscheidungen und unseren Unterlassungen ab? Auf diese Frage muss jeder seine persönliche Antwort finden. Und um eine befriedigende und gültige Antwort zu entdecken, ist es notwendig, die eigene Geschichte zu lesen. Ganz wie ein Betrachter von außen das eigene Leben wie einen Film vor sich abrollen zu lassen. Und dabei Zeichen zu suchen, die uns verstehen helfen. Indizien aufzuspüren dieses Jemands, den Millionen Christen Gott nennen, der uns und unsere Geschichte in seiner schützenden Hand hält, uns aber nicht in der Unmündigkeit, sondern in der Freiheit, seinen Plan anzunehmen oder zurückzuweisen, begleitet. Und das Lebensglück stellt sich oft als die Übereinstimmung des persönlichen mit eben seinem Plan dar.
1. Kapitel
REISEPLÄNE MIT HINDERNISSEN
»Sunshine – sunshine reggae«, tönte der etwas zu groß geratene Radiowecker auf dem Nachttisch. Ich öffnete langsam die Augen, reckte den Arm und drückte schnell die »Snooze«-Taste, um die Musik verstummen zu lassen – zumindest für 9 Minuten. Wenn man augenblicklich wieder in Tiefschlaf verfällt, können neun Minuten wie ein halbes Leben erscheinen. Auf jeden Fall vergeht irgendwann auch eine Ewigkeit, und als sich der Wecker mit einem weiteren Lied zurückmeldete, war es wirklich höchste Zeit aufzustehen. Ich warf einen kurzen Blick aus dem Fenster, um die Wetterkonditionen abzuschätzen: Es war ein durchschnittlicher, bewölkter Junitag – weder kalt noch warm. Nachdem ich mich fertig gemacht hatte, war es bereits zu spät für ein Frühstück. Heute hatte ich Dienst in der Hauptkasse der Bankfiliale, in der ich seit ein paar Jahren beschäftigt war, und das hieß Dienstantritt um 6.45 Uhr. Zwei Minuten, um meinen roten Perserkater Wusel zu verabschieden und, was noch viel wichtiger als ein Liebesbeweis war, um ihn zu füttern.
Glücklicherweise konnte ich zu Fuß gehen von meiner winzigen Zweizimmerwohnung unter dem Dachstuhl eines alten und etwas vernachlässigten Mietshauses im Ortszentrum. Erst die Adamstraße entlang, dann musste ich rechts in die Augustastraße einbiegen und dann weiter links über die Marktstraße bis zum Marktplatz, wo sich die Filiale der Bank an der Ecke befand. Zu dieser frühen Morgenstunde waren nur der Betriebsleiter, Niklas Schneider, und seine treueste Mitarbeiterin, Frau Mögler, schon zur Stelle. Ich machte mich an die notwendigen Vorbereitungen, zählte die über den Nachttresoreinwurf angekommenen Einzahlungen der umliegenden Geschäftsleute, bevor die Filiale um 8.30 Uhr geöffnet wurde. Um kurz vor acht kam Erika, meine Kollegin und engste Vertraute. Während wir Bargeld, Scheckformulare, Hartgeld, ausländische Sorten und alles andere in unseren Kassen verstauten, flüsterte sie mir zu: »Ich muss dir gleich etwas Wichtiges sagen! Du weißt doch, dass ich nächsten Monat Urlaub habe. Wie jedes Jahr will Helmut zu Hause bleiben. Urlaub ist für ihn eine unnötige Ausgabe, du weißt schon. Aber mir ist da eine Idee gekommen, und du musst mir dabei helfen.« Das hörte sich fast nach einer Verschwörung an. Sie tat mir ein bisschen leid. Seit sieben Jahren war sie nun mit Helmut verlobt, der in der 40 km entfernten Stadt Aachen wohnte, aber obwohl Erika über 10 Jahre älter war als ich, schien da von seiner Seite nicht die geringste Absicht zu bestehen, ein über eine Wochenendbeziehung hinausgehendes Verhältnis anzustreben. Überhaupt musste dieser Helmut, den ich noch nie getroffen hatte, ein merkwürdiger Kauz sein. Bei einem unserer üblichen Mittwochstreffen zusammen mit Christine, unserer gemeinsamen Kollegin und Freundin, hatte Erika zur allgemeinen Erheiterung von Helmuts Lieblingsbeschäftigung während der gemeinsamen Wochenenden in Aachen erzählt: Regelmäßig wurden alle Sparbücher aus der Wertkassette herausgeholt, die dann genüsslich betrachtet und in jedem Detail gelesen und analysiert wurden. Also nicht nur ein leidenschaftlicher Geldsammler, sondern offensichtlich auch noch ein authentischer Geizkragen. Nach einem ganzen Jahr Arbeit hat der Mensch wohl auch einen Urlaub verdient. ›Ich könnte tatsächlich auf vieles verzichten, aber Urlaub, insbesondere Reisen jeder Art, gehören zu den Dingen, die das Leben lebenswert machen‹, dachte ich bei mir. Leider vergingen noch einige Stunden, bevor ich mehr über die mysteriöse Idee und meine Beteiligung an der ganzen Sache erfuhr, denn unsere Kassen lagen zwar schräg gegenüber, waren aber durch einen breiten, von der Geschäftsstellenleiterin perfekt kontrollierten Korridor getrennt. Privatgespräche im Dienst waren ein Tab, und da wir beide ähnliche Aufgaben hatten, war es nicht möglich, die Pausen gemeinsam zu verbringen. Der Kundenbetrieb war an diesem Frühnachmittag außergewöhnlich schwach. Unsere Leitung ertrug aber den Gedanken nicht, dass die Kassierer eine Verschnaufpause haben könnten, und so wurde mir ein Stapel Eingabebelege für die Programmierung im Computersystem ausgehändigt. Auf meinen fragenden Blick hin antwortete mir der Betriebsleiter Schneider mit einem Lächeln unter dem Schnäuzer: »Nun, wenn Sie alles für sich behalten möchten, Frau Demmler, … aber Sie teilen ja sicher gern mit den Kollegen der anderen Kassenschalter.«
Also machte ich mich an eine gerechte Aufteilung und ging zuerst zur Kollegin Erika Donzella mit ihrem Anteil der Eingabebelege. »Was meintest du denn heute früh? Die Idee … und was habe ich damit zu tun?«, zischte ich ihr zu, während wir beide gekonnt den Blick auf die Eingabebelege fixierten, als ob wir Unklarheiten damit hätten.
»Diesmal werde ich Helmut nicht die Genugtuung geben. Wenn er wie üblich ein Wochenende mit der Frau Mama im Schwarzwald verbringen will, dann soll er mal. Ich will in den Süden, ich brauche Wärme. Ich bin die verregneten deutschen Sommer leid! Ich bin wild entschlossen. Wenn er nicht mitkommt, dann fahre ich eben allein.«
Stechend spürten wir den Blick der Vorgesetzten im Nacken und ich ging weiter zum nächsten Schalter, um auch Herrn Schlumm seinen Teil abzugeben.
Es wurde Abend, bis wir nach Dienstschuss Gelegenheit fanden, in Ruhe im Eiscafé miteinander zu sprechen. Erika war also entschlossen, allein in Urlaub zu fahren. Leider hatte ich zu einem späteren Zeitpunkt meinen Jahresurlaub, da wir innerhalb der Filiale die gleichen Aufgaben hatten, und daher nicht nur in der Pause, sondern auch im Urlaub nie gemeinsam fehlen konnten. Meine Aufgabe in der ganzen Sache war die, ihr Mut zu machen und eine Woche vor Urlaubsbeginn mit ihr zum Flughafen zu fahren, um eine Last-Minute-Reise mit ihr auszusuchen.
In letzter Zeit hörte man viel von diesen im letzten Moment gebuchten Reisen, die wesentlich günstiger waren. Es gab sogar Leute, die mit gepackten Koffern zum Flughafen fuhren, um dann wenige Stunden später direkt abzufliegen. Erika meinte, sie würde das Schicksal entscheiden lassen. Mir imponierten Erikas Mut und Entschlossenheit, auch wenn sie nicht der Typ Frau war, der sich allein in ein Ferienhotel setzt und mit tausend Bekanntschaften wieder nach Hause zurückkommt. Zum einen war sie eben charakterlich, wie im Übrigen auch ich selbst, nicht unbedingt eine Person, die beim Kennenlernen die Initiative ergreift und zum anderen hatte sie im Leben auch schon einige negative Erfahrungen gemacht, die sie zur Vorsicht mahnten.
So vergingen einige Tage bis zum traditionellen Mittwochstreffen, diesmal in der Bierstube. Auch wenn Christine, Erika und ich nicht zu den großen Biertrinkern gehörten, hatte es sich eingebürgert, unseren Treffpunkt in eins der Lokale um den Marktplatz unweit von unserer Arbeitsstelle zu legen. Nach rheinischer Tradition ließen wir das Bier mit alkoholfreiem Malzbier oder mit Cola verdünnen, diese im Rheinland Schuss und Drecksack genannten Getränke, da die Cola das Glasinnere schmutzig erscheinen lässt, und verbrachten den Abend im Austausch der letzten Neuigkeiten. Natürlich stand neben den betrieblichen Angelegenheiten auch das Thema Urlaub auf der Tagesordnung. Christine war schon dabei, sich für den Sommerurlaub zu rüsten, aber ihre Situation war etwas anders. Seit Jahren war sie fest liiert mit Sebastian, den sie praktisch von Kindesbeinen an kannte und mit dem sie auch ihren Urlaub verbrachte. Beide waren Motorradfans und fuhren auch dieses Jahr mit ihrer schweren Maschine bis nach Genua, um sich dann von dort aus nach Korsika einzuschiffen. Sie nahmen ein Zelt mit und erkundeten so die ganze Insel.
Anders war die Situation bei Erika, die zwar auch liiert war, aber in so mancher Hinsicht eben doch auf sich allein gestellt war, sofern sie nicht alles als gegeben und unabänderbar hinnehmen wollte. Christine war begeistert von der Idee, dass Erika einen Urlaub im sonnigen Süden verbringen würde.
»Was hast du denn gedacht, wohin du genau fahren möchtest?«
»Also am liebsten nach Italien oder vielleicht nach Spanien.«
»Also zu deinen Wurzeln«, warf ich ein, denn Erikas italienisch klingender Nachname »Donzella« kam wirklich von entfernten Verwandten aus der Gegend um Udine. Trotz dieser Herkunft sprach sie kein Italienisch und war auch sonst von einer typischen Deutschen nicht zu unterscheiden. Der einzige Unterschied war, dass ihr immer noch die italienische Staatsangehörigkeit erhalten geblieben war. Auf jeden Fall war sie entschlossen, eine Flugreise zu unternehmen und einige Tage vor ihrem Urlaubsbeginn mit meiner Unterstützung zum Kölner Flughafen zu fahren und eine Reise kurzfristig zu buchen. Und es war ja auch gar nicht unangenehm, dass sie so eine ganze Menge Geld sparen konnte.
Und was ist mit dir? Die Frage hatte ich nicht so recht erwartet. Tja, nun ja. Eigentlich hatte ich ja mit André, meinem ehemaligen Freund, an den Gardasee fahren sollen, aber als wir uns im Frühjahr getrennt hatten, hatte ich als erstes die Reise storniert und dabei auch noch Glück gehabt, dass der freundliche Hotelbesitzer keine Entschädigung verlangt hatte. Danach hatte ich bei all meinen Bekannten und Freundinnen herumgefragt, um Gesellschaft für einen gemeinsamen Urlaub zu finden, aber vergebens. Da war, wer bereits mit dem festen Freund einen Urlaub geplant hatte, und wer Mitte August keinen Urlaub nehmen konnte. Dann war auch noch dazu gekommen, dass André nach einigen Wochen Funkstille wieder angefangen hatte, mich zu kontaktieren, wobei mir seine Absichten aber völlig unklar waren. »Er meint, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, sollten wir doch gute Freunde bleiben«, erklärte ich meinen Freundinnen.
»So nennt man das also«, prustete Christine los, »ich wette mit dir, es vergeht keine lange Zeit, bis er dich besuchen kommt, und dann, weil es ja spät geworden ist, bei dir übernachten will.«
»Da hast du wahrscheinlich nicht unrecht, aber keine Sorge, ich habe die Nase voll von diesem komplizierten Verhältnis, auch wenn es insgesamt fast ein Jahr angedauert hat.«
»Ein bisschen bist du auch selbst schuld«, wandte Erika ein, »wenn man von einer Geschichte in die nächste stürzt, kommt selten etwas Gutes dabei heraus.« Die weisen Worte meiner älteren Freundin! Ich hatte André kennen gelernt, als ich schon zwei Jahre mit Robert, meinem 13 Jahre älteren Lebensgefährten zusammenlebte. Robert war die erste wirklich wichtige Beziehung meines Lebens gewesen. Wegen ihm war ich mit 19 Hals über Kopf zu Hause ausgezogen und musste diese Entscheidung bitter mit dem fast kompletten Verlust der Beziehung zu meiner Familie bezahlen. Anfangs hatte mich dieser Verlust in keiner Weise berührt, denn zu überwältigend war diese neue Liebe gewesen zu einem Mann, der reifer als ich war, sich aber gerne von meiner Jugend inspirieren ließ. Mit der Zeit aber hatten die Schwierigkeiten begonnen, die weniger mit dem Altersunterschied als mit dem schlechten Einfluss einiger seiner neidischen Freunde zusammenhingen. Und in dieser schwierigen Phase war André aufgetaucht, der als völlig Unbekannter bei einem Segeltörn auf dem Ijsselmeer erschien. Greta, meine Freundin, hatte ihn als sechsten Mann mitgebracht, um das Segelboot komplett zu nutzen. Und vom ersten Augenblick an hatte es zwischen uns geprickelt, was mein Freund Robert als einziger nicht bemerkt hatte oder nicht hatte bemerken wollen. Vielleicht war damals einfach der richtige Moment gekommen, um eine in die Sackgasse geratene Beziehung zu beenden und eine neue Lebensphase einzuläuten. In dieser Zeit hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass es mit uns einfach nicht sein sollte. So, als ob es irgendein großes, überirdisches Projekt für mich gäbe und mein Instinkt sagte mir, dass es keinen Sinn hatte, diesen Weg weiter zu gehen.
André war also die richtige Person im richtigen Moment gewesen und ich hatte die Initiative ergriffen, Robert zu verlassen. Einfach war das nicht gewesen, weder in emotionaler noch in praktischer Hinsicht. Ich hatte also, gestärkt vom offenkundigen Interesse von André, allen Mut zusammengenommen und eine kleine Wohnung gemietet. Unterstützt von meinen Eltern, die heilfroh und nun natürlich mir auch wieder mehr gewogen waren, hatte ich bei Freunden und Bekannten Hausrat und ausgediente Möbel gesammelt, da ich so schnell keine komplette Einrichtung kaufen konnte. Als ich Robert mitgeteilt hatte, dass ich ihn verlassen würde und auch schon eine neue Wohnung, ganz in der Nähe, gefunden hatte, nahm er dies gelassen auf, fast als hätte er so etwas schon erwartet. Aber als er herausgefunden hatte, wer der Beweggrund dieser Entscheidung war, hatte er schlagartig sein Verhalten geändert. Er hatte mir die für meinen Umzug zugesagte Hilfe versagt und zudem mein aus Gründen der Steuerersparnis auf seinen Namen zugelassenes Auto weggenommen. Als ich dann meine persönlichen Sachen in unserer gemeinsamen Wohnung hatte abholen wollen, hatte ich ein nagelneues Türschloss vorgefunden und meinen ehemaligen Lebensgefährten, der mein Hab und Gut im Hausflur deponierte. Also hatte ich meine Sachen vom Boden aufsammeln und mitnehmen müssen.
Trotz aller Schwierigkeiten und meines verletzten Stolzes stellte der 8.8. einen Gedenktag und einen neuen Anfang für mein Leben dar. Sicher war die Matratze der alten Gartenliege meiner Mutter, die ich im Schlafzimmer auf den Teppichboden gelegt hatte, kein ausgesprochen bequemes Bett gewesen, aber ich hatte herrliche Nächte allein darauf verbracht, denn ich wusste, dass ich nun dabei war, mir wirklich etwas aufzubauen. Etwas für mich allein, ohne von anderen abhängig und kontrolliert zu sein. Auch die Anstrengung, Roberts alte Küchenmöbel, Herd und Spüle in den 3. Stock zu schleppen, eine fast übermenschliche Leistung angesichts meiner körperlichen Statur, war bald vergessen. Es schien, dass mir in jenen Tagen einfach alles gelang. Vielleicht hatte ich einen Schutzengel an meiner Seite gehabt. Auf André hatte ich als Hilfe nicht zählen können, da er bevorzugte, sich bedeckt zu halten, denn er wollte nicht den Anschein geben, der Verursacher dieser Situation zu sein. Aber war er das nicht irgendwie schon? Natürlich, aber es gibt eben sehr wenige Menschen, die wirklich bereit sind, die Verantwortung für ihr Reden und Handeln zu übernehmen. Diese Erkenntnis sollte sich noch oft in meinem Leben wiederholen.
2. Kapitel
FLASHBACK – ABTAUCHEN IN DIE VERGANGENHEIT
Sehr schnell war es mit meiner Wohnungseinrichtung bergauf gegangen, denn glücklicherweise hatte ich mich auf ein angemessenes Gehalt von meiner Bank stützen können. Nach und nach hatte ich das Schlafzimmer mit einem supermodernen schwarzen, mit knallbuntem Grafikmuster bedeckten Polsterbett eingerichtet, einem weißen Kleiderschrank und ebensolchen Kommoden, die genau unter die Dachschräge passten. Das zweite Zimmer, das gleichzeitig Küche und Wohnzimmer war, hatte an der rechten Seite Platz für die besagte Kücheneinrichtung aus hellem Kiefernholz, wenn sie auch schon ein wenig abgenutzt war. Links hatte ich eine Couch mit einem passenden Schreibtisch hingestellt und unter dem Fenster stand ein kuschliger Sessel mit einer schrägen, ein wenig unbequemen Sitzfläche, der aber der Stammplatz von Wusel war. Auch wenn ich meinen hübschen, kleinen, knallroten Renault »verloren« hatte, war ich doch froh, dass Roberts Rache sich nicht an dem roten Perserkater ausgelassen hatte, denn das wäre unendlich viel schmerzhafter gewesen.
Auch für das Auto-Problem hatte sich eine Lösung gefunden. Mein Vater hatte sich in seinem Bekanntenkreis umgehört und sein langjähriger Freund und Opelvertreter hatte einen Kadett günstig abzugeben. Der weiße Wagen war ein älteres Modell und entsprach nicht so ganz meinen Vorstellungen, denn in so einem sportlichen Auto hatte eine so kleine Person wie ich nicht die günstigste Sitzposition, aber dennoch nahm ich ihn. Manchmal muss man sich eben mit dem begnügen, was sich gerade so bietet. Ohne Auto wäre ich in meinen Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt gewesen.
Meine Beziehung zu André startete am 8.8., wenn auch auf eine äußerst unangenehme, aber wegweisende Manier. Auf dem Weg zu unserem ersten Treffen war ich durch eine kleine Ortschaft auf einer Landstraße gefahren, auf der wirklich niemand die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer einhielt. Es hatte gerade angefangen zu regnen, nach mehreren Wochen der Trockenheit. Ich war sehr aufgeregt gewesen und meine Gedanken hatten sich mit dem bevorstehenden Treffen mit André beschäftigt, als plötzlich rechts aus der Einfahrt eines Blumenladens ein Transporter herausgekommen war und sich anschickte, meine Fahrtrichtung einzuschlagen. Ich hatte zu spät gebremst, die feuchte Fahrbahn war extrem rutschig gewesen und mein Wagen war auf den Transporter aufgefahren, der wiederum auf das davor fahrende Fahrzeug auffuhr. Für einen Moment schien alles in Zeitlupe abzulaufen und ich hatte bei mir gedacht: ›Nein, es passiert nichts. Es wird schon gutgehen!‹ Aber leider war es nicht gutgegangen. Die beiden anderen Fahrer waren ausgestiegen. Die Frau aus dem ersten Auto hatte sich entsetzlich aufgeregt, während der Fahrer des Lieferfahrzeuges aus dem Blumengeschäft versucht hatte, sie zu beschwichtigen. Er hatte die Polizei angerufen, die dann alles regelte. Es hatte sich um den ersten Unfall in meiner Führerscheinkarriere gehandelt, daher war ich bass erstaunt gewesen, als einer der Polizisten wirklich freundlich, fast herzlich, mir als erstes einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit verpasste. Ganz naiv hatte ich gefragt: »Aber wie können Sie denn wissen, wie schnell ich gefahren bin? Sie waren ja nicht dabei. Also verlassen Sie sich blind auf die Aussagen der anderen beiden Fahrer. Und wenn die nicht die Wahrheit sagen?« Der Polizist hatte mich honigsüß angelächelt, wie man ein Kleinkind anlächelt, das gerade entdeckt hat, dass der Weihnachtsmann nicht existiert.
»Nee Frollein, dat is janz einfach. Se müsse immer su schnell fahre, dat Se in jedem Fall rechtzeitisch zum Stehe kumme, wenn ne KFZ vuer Inne bremst.« – »Nein, Fräulein, das ist ganz einfach. Sie müssen immer so schnell fahren, dass Sie rechtzeitig zum Stehen kommen, wenn ein KFZ vor Ihnen bremst.«
Ich hatte gespürt, dass ich rot wurde. Nur zu logisch war diese Antwort. Ab jetzt würde ich nie mehr vergessen, dass gewöhnlich immer der letzte Wagen im Auffahrunfall die Schuld trägt. Die gesamte Abwicklung des Unfalls hatte natürlich einige Zeit gedauert, auch wenn zum Glück niemand verletzt worden war und auch der Blechschaden die Fahrmöglichkeit der Autos nicht einschränkte. Mein Wagen hatte nur die Stoßstange leicht eingedrückt.
Zum ersten Rendezvous mit André im Restaurant einer Tennishalle war ich dennoch mit einer Stunde Verspätung gekommen, was meinem Wesen gänzlich widersprach. »Des Kaufmanns Pünktlichkeit ist fünf Minuten vor der Zeit«, hatte mich mein Vater gelehrt, der tatsächlich davon überzeugt war, dass derjenige, der sich exakt zur vereinbarten Uhrzeit präsentiert, eigentlich schon verspätet war. André war fast beleidigt gewesen und war im Begriff, wegzufahren, als ich auf dem Parkplatz der Tennishalle angekommen war und ihm von meinem Unfall berichtete, aber dann hatte er doch Verständnis gezeigt. Wir waren zurück ins Restaurant der Tennishalle gegangen, wo wir zum ersten Mal alleine über uns reden konnten. Es war ein untypisches Treffen gewesen. Irgendwie hatte die Romantik des ersten Rendezvous gefehlt, auch wenn uns die gegenseitige Anziehungskraft durchaus bewusst war. Es hatte mich leicht verwirrt, dass André, als ich ihm von meinem Entschluss berichtete, Robert definitiv zu verlassen, keine Freude oder ähnliches zeigte, sondern vielmehr Besorgnis, als der hierfür Schuldige betrachtet zu werden. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass dies meine persönliche, von ihm unabhängige Entscheidung sei, auch wenn dies tief in meinem Herzen einen üblen Nachoder besser gesagt Vorgeschmack hinterlassen hatte.
Dieser erste Abend war irgendwo symptomatisch gewesen für eine Beziehung, die so vieles hätte sein können, weil irgendwie alles stimmte, aber die gleichzeitig so vieles nicht war. André war ein sympathischer, fröhlicher, nett aussehender Mensch, ohne auf irgendeinem Gebiet etwas Außergewöhnliches darzustellen. Vielleicht war es eben diese Normalität, nach der ich eine so große Sehnsucht hatte. Die vergangenen drei Jahre waren eben nicht so ganz durchschnittlich gewesen. Wir hatten viel miteinander gescherzt und fühlten uns wohl in der Gesellschaft des anderen, und ich versuchte mir seines Mangels an Verantwortung nicht allzu sehr bewusst zu werden. An diesem Abend war ich zum vorletzten Mal in die Wohnung zurückgekehrt, die ich fast drei Jahre mit Robert zusammen bewohnt hatte. Die Wohnung hatte sich in der letzten Woche stark verändert. Lange Zeit hatte ich darauf gedrängt, die angefangenen Renovierungsarbeiten in der Küche zu Ende zu bringen, aber, wie das eben so ist, wenn die Meinung des Partners völlig an Stellung und Wichtigkeit verloren hat, war meine Nachfrage bei Robert auf taube Ohren gestoßen, und so war es dabei geblieben, dass der Gefrierschrank und der Wäschetrockner einfach so mitten im Raum standen, anstatt in eine Einbauwand eingefügt zu werden. Und es war mir klar geworden, wie sich Verhältnisse zwischen Personen verändern können. Einmal ist deine Meinung die kompetenteste und interessanteste der ganzen Welt für eine Person, die dir gegenüber unvoreingenommen ist, während du für die gleiche Person innerhalb kürzester Zeit die inkompetenteste Person der Welt werden kannst: himmelhochjauchzend und gleich danach zutiefst betrübt. Extreme Positionswechsel gegenüber einer Person bringen ebenso krasse Veränderungen in der Achtung des Anderen mit sich.
Nachdem ich Robert aber gesagt hatte, dass es zwischen uns aus sei, war ich einen Tag lang zu meiner Schwester Rebekka gefahren, die 100 km entfernt wohnte, um etwas Abstand zu gewinnen und um die Gelegenheit zu haben, mit jemandem über die Sache sprechen zu können. Nach meiner Rückkehr hatte ich alle seit Monaten angesammelten Arbeiten und unerledigten Renovierungen im Haushalt wie durch Zauber erledigt vorgefunden. Selbst die Dunstabzugshaube hatte nun ein Abluftrohr direkt im Luftschacht.
An jenem Abend, nach meinem Unfall und dem Treffen mit André, hatte Robert mich unverzüglich nach meinem Eintreten einer Prüfung »auf Herz und Nieren« unterzogen. Er kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich nicht fähig war, mich zu verstellen oder zu lügen. Auf seine Frage, ob denn eine andere Person im Spiel sei, antwortete ich gezwungenermaßen mit »ja«. Natürlich hatte er nicht locker gelassen, als ich den Namen der Person nicht preisgeben wollte. In diesem Moment waren mir im Bruchteil einer Sekunde unendlich viele Dinge durch den Kopf gegangen. Wie konnte man fast drei Jahre mit einer Person zusammenleben und noch nicht einmal bemerken, dass diese dabei war, sich in einen anderen zu verlieben? Und wie konnte man Tage auf engstem Raum auf einem Segelboot und Abende gemeinsam in Lokalen verbringen, ohne dass einem auffiel, dass da zwei Personen sich immer mehr annäherten, was allen anderen Mitfahrern des besagten Segeltörns, Greta inbegriffen, nicht entgangen war? Meine Gefühle waren in diesen kritischen Sekunden, in denen Robert auf meine Antwort wartete, eine Mischung aus verletztem Stolz und Genugtuung, mich für diese Interessenslosigkeit zu rächen. Ich hatte fast ein Lächeln auf den Lippen, als ich ihm antwortete: »Es ist André!« Aber das Lächeln sollte mir bald vergehen, denn Robert hatte einen Wutausbruch, den ich nicht so leicht vergessen hätte. Er wurde puterrot und schrie seine Wut aus dem Bauch. Von nun an drehte sich die Situation, denn bisher hatte er so etwas wie Einsicht in die von ihm in unserer Beziehung begangenen Fehler verspürt. Deshalb hatte er auch diese lange vernachlässigten Arbeiten im Haushalt erledigt. Nach dem Motto: Siehst du, jetzt musst du zufrieden sein, ich habe alles gemacht, was du wolltest. Nachdem er die Wahrheit kannte, fühlte er sich aber wie der Betrogene, auch wenn er dies bis heute Abend nicht wirklich gewesen war. Leider war ich gezwungen gewesen, mich an diesem Abend noch in der gemeinsamen Wohnung aufzuhalten, und es wurde eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Robert schwankte ständig zwischen Wut, Selbstmitleid und Versuchen, mich zu überzeugen, doch bei ihm zu bleiben. Es gibt Nächte, in denen man aufs Morgengrauen hofft und sehnlichst wartet, dass ein Lichtstrahl das Leben erhellt. Und diese war eine davon gewesen!
Aber nun saß ich doch hier im Bierstübchen, einem Ort, der fest mit Erinnerungen an viele gemeinsame im Freundeskreis mit Robert verbrachten Abende verbunden war, mit Christine und Erika. Erikas Reisepläne standen fest, während meine ein einziges Fragezeichen waren. Nach der Stornierung der mit André gebuchten Reise ins Paradies der Surfer am Gardasee, war ich etwas orientierungslos und hätte gerne irgendetwas zusammen mit einer Freundin unternommen. Aber mit Erika war es unmöglich, da unsere Betriebsleitung niemals zwei Servicemitarbeiter gleichzeitig in Urlaub geschickt hätte, bei Christine und Sebastian das fünfte Rad am Wagen zu spielen war undenkbar, und Greta hatte in diesem Sommer aus betrieblichen Gründen gar keinen Urlaub.
»Na dann«, sagte Erika, »ist doch klar, dass du alleine fahren musst, so wie ich.«
»Mit dem Gedanken kann ich mich so gar nicht anfreunden, Erika. Wenn ich nur denke, dass ich in einem Speisesaal allein am Tisch sitze und die Leute mich anstarren, wird mir ganz anders«, antwortete ich.
»Diejenigen, die dich anstarren, können nur Deutsche sein, die sind so engstirnig. Sicher wird sich keiner der ausländischen Gäste etwas dabei denken, dass eine Frau allein Urlaub macht«, warf Erika ein.
»Na los schon, Jessica, lass dich mal ein bisschen gehen«, machte mir Christine Mut.
Ich bat mir Bedenkzeit aus. Es war ja schließlich noch etwas Zeit bis dahin. Wir verabschiedeten uns und ich ging zu Fuß die kurze Strecke bis nach Hause. Wusel schlief in seinem Kuschelsessel unter dem Fenster.
»Mein armer kleiner Kater, du bist immer allein. Du bist der allerbeste. Kein anderer Mann auf der Welt ist wie du.« Sobald ich anfing, ihn zu streicheln, setzte sein Schnurren ein, das so laut wie ein gedämpfter Rasenmäher war. Dieses überdimensionale Schnurren hatte mich schon immer zum Lachen gebracht. Wusel war mit acht Wochen zu mir gekommen, ein Wattebausch, der lauthals schnurrte. Ich hatte nie vorgehabt, mir eine Rassekatze zuzulegen, denn eigentlich war ich Liebhaber der ganz normalen Hauskatze. Meine Familie hatte seit Jahr und Tag Katzen gehabt. Zuletzt hatten wir bis zu fünf oder sechs gleichzeitig. Kaum zu glauben, dass meine Mutter Tiere zutiefst hasste, als ich klein war. Die erste Katze hatte uns der ehemalige Freund meiner Schwester Rebekka ins Haus geschleppt. Er war Vertreter und diese arme Mieze verbrachte fast den ganzen Tag im Auto. Also bot meine Mutter aus purer Barmherzigkeit an, die Katze manchmal bei uns zu lassen. Zudem war es ein ausgesprochen ruhiges und liebesbedürftiges Tier, das sein Besitzer auf der Autobahn gefunden hatte, und das das Herz meiner Mutter eroberte. Aus manchmal wurde dann ständig und irgendwann war »Leidenfix« dann unsere Katze. Der merkwürdige Name rührte von Rebekkas Freund her, der die Katze oft in seine großen Hände nahm, sie mit dem Bauch nach oben drehte und mit österreichischem Akzent schrie: »Du armes Tier, du musst so leiden«, woraufhin die Katze – brav dressiert – anfing, kläglich zu miauen. Die arme Leidenfix hatte kein langes Leben, denn schon in jungen Jahren, als Folge einer vielleicht nicht ganz gelungenen Sterilisierung, bekam sie eine Wassersucht, an der sie elendig zu Grunde ging. In unserer Familie wurde getrauert. Vielleicht hatten wir bis dahin gar nicht bemerkt, wie sehr wir an dem niedlichen, zierlichen, weißen Kätzchen hingen.
Um die Trauer zu überwinden, hatten wir Nicki ins Haus geholt, eine dunkelgrau-weiße Hauskatze vom Reiterhof, auf dem ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht hatte. Zudem wurden in unserem Garten, hinter der zusammengeklappten Tischtennisplatte gut versteckt, fünf Katzenbabys einer halbwilden Mutter geboren. Der Freund meiner Schwester, als großer »Katzenexperte«, fasste diese Katzenkinder schon kurz nach der Geburt an, und die Mutter, die an ihren Jungen den Menschengeruch verspürte, wies diese zurück. Also blieb uns nichts anderes übrig, als die Katzenbabys in unseren warmen Heizkeller zu bringen und sie mit dem Fläschchen zu ernähren. Dies erwies sich als gar nicht so einfach, aber mit ein bisschen Glück schafften wir es, alle fünf, eine Katze und vier Kater, großzuziehen. Als ich im Alter von 19 Jahren dann Hals über Kopf mit Robert zusammengezogen war, hatte ich Nicki natürlich mitgenommen, denn sie lebte fast ausschließlich in meinem Zimmer und ich betrachtete sie als meine Katze. Meine Eltern waren, milde ausgedrückt, unwillig gewesen, diese Beziehung zu akzeptieren und hatten Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um uns auseinanderzubringen. Unter Druck gesetzt, hatte ich innerhalb weniger Stunden meine Sachen gepackt, mein Kätzchen unter den Arm genommen und war bei Robert eingezogen, der uns freudestrahlend zusammen mit seinem Hund George, einem wilden Bobtailrüden, erwartete. Wir hatten ein wenig Angst vor dem Zusammentreffen zwischen Hund und Katze gehabt, aber es war besser als erwartet gelaufen. George hatte höchsten Respekt vor der Katzendame, die sich sofort in der dominanten Rolle wohlgefühlt hatte und den riesigen, zottligen Hund mit Herablassung behandelte. Nach einiger Zeit hatte sich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt, die aber von extremer Vorsicht seitens des Hundes gekennzeichnet war. Nach einigen Monaten schien auch die Wut meiner Eltern über meinen überstürzten Auszug, und zudem auch noch zu einem viel älteren Mann, abzunehmen. Also hatte ich mir Mut gemacht und meine Mutter gefragt, ob sie auf Nicki aufpassen könnte, während ich in Urlaub fuhr. Ich hatte es kaum zu hoffen gewagt, aber sie hatte sofort zugesagt. Ich hatte Nicki mit ihrem Körbchen und allem Notwendigen zu meinen Eltern gebracht und war unbesorgt in Urlaub gefahren, denn die Katze war ja in ihrer altbekannten Umgebung. Nach meiner Rückkehr hatte mich aber eine schreckliche Überraschung erwartet. Als ich meine Mutter angerufen hatte, um einen Termin für Nickis Abholung auszumachen, tat sie so, als ob sie überhaupt nicht wüsste, wovon ich denn redete.
»Katze, welche Katze? Nicki? Das ist unsere Katze. Die kannst du nicht haben!«, sagte sie mir. Ich war völlig niedergeschlagen und konnte es einfach nicht glauben. Wie hatte mir meine Mutter so etwas antun können, wo sie doch wusste, wie sehr ich an Nicki hing? Die Katze hatte immer in meinem Zimmer gelebt, in meinem Bett geschlafen, hatte mit mir gespielt. Sicher, ich konnte verstehen, dass meine Eltern böse auf mich waren, hatte ich doch nicht nur ihre guten Ratschläge, die Hände von diesem Mann zu lassen, in den Wind geschlagen, sondern war auch noch zu ihm gezogen, als sie versuchten, die Beziehung mit Gewalt auseinanderzubringen, indem sie mich buchstäblich im Haus einschlossen. Obwohl es für mich eine enorme Erniedrigung darstellte, hatte ich erneut bei meinen Eltern angerufen und sie weinend angebettelt, mir die Katze zurückzugeben, denn die hatte es wirklich viel besser bei mir als bei ihnen, die so gut wie nie zu Hause waren. Vergebens. Der Verlust meiner geliebten Katze hatte mir einen fürchterlichen Schlag versetzt, was nur derjenige verstehen kann, der schon einmal eine so enge Beziehung zu einem Haustier gehabt hat. Wer eine intensive Beziehung zu einem Tier lebt, sieht irgendwann kaum mehr einen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Tagelang hatte ich mich dahingeschleppt. Es war, als ob Nicki gestorben wäre, denn ich sah keine Chance, sie je wieder zu sehen.
Ein paar Tage später hatte ich mich in einem Supermarkt zum Einkaufen befunden, als eine Werbedurchsage aus dem Lautsprecher erklang: »Nicki Katzenstreu ist heute im Angebot, Sonderpreis nur …« Mir war schwarz vor Augen geworden, als ich den Namen meiner Katze hörte und ich hatte fast das Bewusstsein verloren. Ich hatte mich mitten im Geschäft einen Augenblick zu Boden gesetzt. Eine freundliche Verkäuferin hatte mir ein Glas Wasser gebracht und nach ein paar Minuten war es mir besser gegangen. Abends hatte ich Robert von diesem Erlebnis erzählt. Am darauf folgenden Samstag hatte er mir eine Annonce in der Tageszeitung gezeigt: »Perserkatzen mit Stammbuch zu verkaufen …«
»Komm mir bloß nicht mit so etwas«, wehrte ich unverzüglich ab, »du weißt, ich kann Rassekatzen nicht ausstehen. Und außerdem kann man ja auch keinen Menschen einfach so durch einen anderen ersetzen.«
»Ich will doch keine Perserkatze kaufen«, antwortete er, »wir haben doch auch den Hund, aber wir können doch einfach mal zu der Züchterin fahren, du spielst ein wenig mit den Kätzchen und dann fahren wir wieder und sagen, wir müssten es uns noch mal überlegen. Ich meine, Katzenluft schnuppern tut dir vielleicht gut.«
Ich war einfach nicht in der Stimmung gewesen, große Diskussionen zu führen, deshalb hatte ich keine weiteren Einwände vorgebracht, obwohl ich keine besondere Lust hatte, dorthin zu fahren. Gegen Mittag, als Robert sein Geschäft geschlossen hatte, war ich also wie vereinbart gegangen, um ihn abzuholen und hatte gesehen, während ich um die Ecke der Werkstatt bog, in der er sein Auto geparkt hatte, dass er eine alte Wolldecke und einen Karton in den Kofferraum legte. Aha, also hatte ich doch richtig verstanden. ›Na, die Suppe werde ich dir versalzen‹, hatte ich gedacht. Es war wirklich nett gemeint von ihm, aber der Gedanke an eine andere Katze erschien mir wie ein Verrat. Das konnte ich Nicki nicht antun. Außerdem waren Rassekatzen wirklich dämlich und Perser noch mehr. Die hatten so eine abgestumpfte Nase, die ihr Gesicht ganz flach aussehen ließ. Nein danke, das war nichts für mich. Aber gut, es konnte mich ja niemand zwingen. Ich wollte es tatsächlich so machen, wie Robert gesagt hatte: »Wir fahren hin, aber kaufen keine Katze.« Es erschien mir sowieso undenkbar, eine Katze zu kaufen, eine Sache, die ich noch nie getan hatte. Es gab so viele niedliche Kätzchen, für die händeringend ein Frauchen oder Herrchen gesucht wurde. Das war doch nicht korrekt, Geld für Tiere auszugeben. Wir waren also in Roberts schönem Auto zu der Züchterin, die annonciert hatte und am entgegengesetzten Ende der Stadt wohnte, gefahren. Es war ein sehr anmutiges Einfamilienhaus mit Garten. Und mehr als eine Zucht schien es eine Katzenfamilie zu sein, die auch ein menschliches Ehepaar im Haus duldete. Die Katzenmutter war eine riesengroße wunderschöne, dunkelgraue Katzendame, eine tatsächlich edle Gestalt. Sogar der Vater gehörte zur Familie. Ich hatte selten eine so große Katze gesehen. Unter dem Fellbündel hatten sich circa 15 Kilo Kater versteckt. Außer uns waren weitere Interessenten dort, die die Züchterin aber schon persönlich kannte, da diese schon Katzen bei ihr abgenommen hatten. Wir waren also die einzigen Neulinge. Die ganze Umgebung schien ein Paradies mit Körbchen, Kratzbäumen, Gehegen und viel Auslauf im Garten zu sein. Es waren fünf kleine Kätzchen, wovon mich eins – ein blaues – wider Erwarten doch faszinierte. Ich hatte sein samtweiches, langes Fell, das von einer phantastischen graublau-Färbung war, bewundert. Als das Tierchen dann das Gesicht zu mir gedreht hatte, war ich doch etwas perplex gewesen, denn es hatte das typische, eingedrückte Persergesicht. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ja gar keine Katze wollte und sah mir das andere Weibchen des Wurfes, ein hellbeigefarbenes Kätzchen an. Während ich das Tierchen mit den Augen fixierte, verspürte ich ein Kratzen am rechten Schienbein, das sich langsam intensivierte und Richtung Oberschenkel wich. Ich schaute auf mein Bein: Am rechten Hosenbein meiner Jeans kletterte ein kräftiger, roter Perserkater herauf. Zum ersten Mal seit Tagen musste ich so richtig lachen, nahm den kleinen Schlawiner auf den Arm und sah ihn mir so richtig an. Er war der größte des Wurfes, sein Name war »Dimple von Schauenberg« und mir wurde klar, dass ER MICH ausgesucht hatte. Sofort hatte er angefangen zu schnurren und sein ganzer Körper vibrierte. Wir hatten keinen Moment gezögert. Die Züchterin machte die Papiere fertig. Dimple war bereits acht Wochen alt, hatte alle notwendigen Impfungen und konnte sofort mit uns nach Hause fahren. Die Züchterin hatte beim Abschied Tränen in den Augen gehabt, denn es handelte sich um eine Tierliebhaberin und nicht um eine Person, die kommerziellen Nutzen aus den Tieren ziehen wollte.
Während der Fahrt nach Hause hatte sich der kleine Kater auf meinen Schoß gekuschelt. Sofort war mir klar, dass »Dimple von Schauenberg« zwar sein offizieller, adeliger Name war, aber keinesfalls konnte ein so wuscheliges Kügelchen einen so steifen Namen tragen. Da kam mir die Idee: »Wusel!«
»Was?«, fragte Robert
»Wusel«, wiederholte ich, »er heißt Wusel.« Im gleichen Moment musste ich dreimal hintereinander niesen.
»Vielleicht sind mir seine Haare in die Nase geraten«, sagte ich, »hatschi, hatschi.«
»Das scheint mir eher eine richtige Erkältung zu werden«, meinte Robert.
Die Vorstellung zwischen Hund und Katze verlief diesmal herzlicher. Wusel kannte keine Hunde und war völlig unvoreingenommen, während George einen Vaterinstinkt entwickelte.
Die nächsten Wochen nach der Enthüllung unserer Reisepläne verliefen ruhig. Ich arbeitete in meiner Bankfiliale. Nach der Arbeit ging ich oft meine Eltern in ihrem nahe gelegenen Sportgeschäft besuchen. Mittwochs hatten wir unseren Mädelsabend: Christine, Erika und ich. Montags traf ich mich zum Squash mit meiner Freundin Greta Schuster. Donnerstag, unser längster Arbeitstag, mündete regelmäßig in der neben der Bank gelegenen Kneipe auf ein Bier mit fast allen Kollegen. Die Wochenenden waren manchmal langweilig, denn meine Freundinnen verbrachten die freie Zeit mit ihren Freunden und ich war eben momentan der einzige Single. Sonntags besuchte ich häufig meine Eltern, wo ein warmes Mittagessen raussprang. Ich hatte, seit ich zu Hause ausgezogen war, schon recht gut gelernt zu kochen, hatte aber festgestellt, dass ich nicht fähig war, allein eine von mir gekochte Mahlzeit einzunehmen. Sobald ich mich an den Tisch setzte, verging mir regelmäßig der Appetit. Eine Tatsache, die mir zu denken gab. Eigentlich war ich ja unheimlich glücklich über meine eigene Wohnung und hatte alle Freiheit der Welt, das zu tun, was ich wollte. Aber irgendwie war da doch eine Leere. Ich konnte nicht behaupten, einsam zu sein, hatte ich doch Freunde, Arbeitskollegen, eine Familie und auch finanziell fehlte es mir an nichts. Doch manchmal überlegte ich doch, ob das nun wirklich alles an Glück war, oder ob vielleicht für mich noch etwas anderes reserviert war. Jedes Mal, wenn sich vor dem Teller sitzend mein Magen schloss, fragte ich mich, ob ich mich nicht selbst belog. Sicher hatte ich im Gegensatz zu vergangenen Zeiten in der aktuellen Lebensphase keine großen Probleme, aber Glücklichsein war vielleicht doch etwas anders.
3. Kapitel
EINE REISE, EINE ENTSCHEIDUNG UND UNZÄHLIGE BEDENKEN
In der Zwischenzeit war der Monat Juli gekommen und mit dem zumindest kalendarischen Sommer war auch André wieder stärker in mein Leben zurückgekommen.
Durch Greta hatte ich erfahren, dass er sich ständig nach mir erkundigte und mehrmals versucht hatte, mich anzurufen. Wie der Zufall es wollte, hatte er mich nie erreicht und hatte daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass ich sehr beschäftigt sei, was seinerseits Fragen der Art »Mit was oder wem ist sie denn beschäftigt?« hervorgerufen hatte. Es bereitete mir Genugtuung, dass er nach den Gründen meiner Abwesenheit forschte, die aber eher zufällig war, da ich leider mit niemandem besonders beschäftigt war. Greta kannte unsere Geschichte nur zu gut, denn sie hatte alle Ereignisse von Anfang an miterlebt und erzählte ihm daher mit reiner Genugtuung, dass ich neue Bekanntschaften geschlossen hätte und deshalb immer unterwegs sei.
Wie schon gesagt, hatte André bereits nach einigen Monaten unserer Beziehung begonnen sich zurückzuziehen. Und zwar in Folge eines rein theoretischen Gespräches über seine und meine Zukunftsvorstellungen, in dem ich den fatalen Satz »Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich einmal heiraten werde, und – warum auch nicht – einmal Kinder haben werde«, aussprach, der zutiefst meiner Überzeugung entsprach. André hatte buchstäblich die Farbe gewechselt und etwas wie »diese Perspektive ist mit meiner Lebensvorstellung unvereinbar …«, gestottert. Nach einer längeren Diskussion, in der er klargestellt hatte, dass er keinerlei Absicht hatte, sich fest zu binden, hatte er den Fernsehapparat, den er mir geliehen hatte, kommentarlos unter den Arm genommen und war verschwunden. So dumm und beschämend diese Situation auch war, hatte ich mich doch sehr verletzt gefühlt. Wie so oft war ich zunächst traurig gewesen, bis sich die Trauer in Wut umgewandelt hatte.
Es hatte mehrere Monate gedauert, bis André plötzlich wieder in meinem Leben aufgetaucht war und so getan hatte, als wäre nichts vorgefallen. Aber ich hatte geraume Zeit gebraucht, bis ich wieder Vertrauen zu ihm finden konnte. Nun war er es, der Familienanbindung suchte, und zwar zu meiner. Er hatte darauf bestanden, mich zur Feier des 40. Geburtstages meiner Schwester Rebekka zu begleiten, was mir einige Schwierigkeiten verursacht hatte, da meine Eltern, wie üblich, von meinem Freund nicht besonders angetan waren. Zudem hatte er mich auch seiner Mutter vorgestellt, was mir wiederum nicht so recht gewesen war.
Und auch diesmal hatte ich auf Gretas Rat hin mit der »paradoxen Psychologie« das gewünschte Resultat erreicht. Je weniger Interesse ich zeigte, desto mehr Interesse entwickelte er. Sicher hatte ich diese Beziehung mit großer Hoffnung angefangen, denn es sprach nichts dagegen, dass es mit uns funktionieren könnte, so sah ich das wenigstens. Das, was sich aber geändert hatte, könnte man vielleicht »meine Leidensbereitschaft« nennen. Immer wenn ich wieder Vertrauen zu ihm gefasst hatte, zog er sich zurück. Jedes Mal, wenn ich die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft aufgegeben hatte, näherte er sich. In einem dieser Momente der Öffnung hatte er mich sogar nach Wiesbaden mitgenommen, um ihn bei einem seiner Kundenbesuche zu begleiten. Er arbeitete als Vertreter einer Einrichtungsfirma, die alles Notwendige für Optiker lieferte. Seine Arbeitswelt war ein völliges Tabu, in die er niemanden wirklich hineinließ. Jedes Gespräch über das Thema tat er ab mit der Bemerkung, jeder Tag, den der Mensch nicht arbeite, sei ein dazu verdienter Tag. Wirklich setzte er sich nicht sonderlich für seine Firma ein. Auf einen Tag, an dem er Kunden besuchte, folgte eine Serie, an denen er zu Hause blieb. Eine Konstante dabei blieb aber die Tendenz, chronisch über die eigenen Verhältnisse zu leben. Eine Tatsache, die für mich als Bankangestellte schon etwas befremdend war, aber als Tochter eines extrem korrekten und peinlich genau wirtschaftenden Vaters außerhalb jedes Verständnisses blieb. Dieser zweite Anlauf war trotz allem irgendwie besser gelaufen als der erste, so dass wir in den ersten Monaten des Jahres sogar gemeinsame Urlaubspläne geschmiedet hatten. Surfen war eins von Andrés geliebten Hobbys, und deshalb hatte er vorgeschlagen, an den Gardasee zu fahren. Er hatte in der Zeitung die Annonce einer Familienpension gelesen. Surfen gehörte gar nicht zu meiner Welt, aber da der Gardasee in Italien lag, und ich zudem wusste, dass André von seinem Vorhaben nicht sehr weit abgewichen wäre, hatte ich zugestimmt. Italien war mein erklärtes Lieblingsland. Als Kind hatte ich jedes Jahr die Ferien in der Nähe von Venedig verbracht und fühlte mich dem Land sehr verbunden. Alles Italienische war schön: die Sprache, die Küche, einfach alles. Um mich im Urlaub besser verständigen zu können, hatte ich an der Volkshochschule mehrere Sprachkurse absolviert. Daher war mir die Aufgabe zugefallen, die Reservierung am Gardasee zu erledigen. Ich hatte auf Italienisch an den Besitzer geschrieben und nach kurzer Zeit die Bestätigung erhalten. Als wir uns Ende April dann – wiederum wegen eines banalen Streites um die Wochenendplanung – getrennt hatten, hatte ich all meine Sprachkenntnisse zusammennehmen müssen, um die Reservierung zu stornieren, ohne dass Kosten entstanden.
Im Juli 1989 rief mich André also wieder ständig an und als er mich schließlich doch einmal erreichte, sagte er mir, dass er sich mit mir treffen wollte. Ich brauchte nicht zu lügen, als ich ihm sagte, dass ich keine Zeit hätte, mich mit ihm zu treffen.
Denn Erikas Urlaub näherte sich und wir hatten vereinbart, zusammen zum Flughafen zu fahren, um eine Last-Minute-Reise für eine Alleinreisende zu buchen. Wir waren aufgeregt wie die Schulmädchen. Man hörte viele Geschichten von Leuten, die mit gepackten Koffern zum Flughafen fuhren, um sofort nach der Buchung in irgendein Flugzeug einzusteigen und zu einem Spottpreis eine Traumreise zu machen. Natürlich musste man flexibel sein, wenn man solch eine Unternehmung vorhatte.
»Erika, so würde ich das nieeeee machen«, gestand ich, »ich wüsste ja noch nicht mal, was ich in den Koffer legen sollte. Man braucht ja nicht die gleichen Sachen für eine Bildungsreise nach Ostafrika oder für einen Badeurlaub in Rimini.«
»Haha, Kulturreise, um Himmels Willen«, antwortete Erika und wir lachten, »aber Rimini, das wär schon was. Überhaupt Italien, Pizza, Nudeln und dann diese gutaussehenden Italiener.«
»Ach, das hast du also vor. Pass aber gut auf, Italiener sind auch Gigolos.«
Wir schüttelten uns vor Lachen. Übermütig kurbelte ich das Autofenster herunter und rief im Vorbeifahren einem dunkelhaarigen, südländisch aussehenden jungen Mann »Ciao, Bello« zu. Wir zogen die Köpfe ein, um nicht gesehen zu werden, und Erika gab Gas. Wir waren in Hochstimmung. Am Flughafen angekommen lagen die Dinge etwas anders, als wir gedacht hatten. Der gesamte Abflugbereich war mit Reisebüro-Schaltern gepflastert, die mit Angebotszetteln tapeziert waren. Es brauchte etwas Zeit, bis wir uns in diesem Dschungel zurechtfanden. Die Angestellten waren viel zu beschäftigt, um uns Auskunft zu geben. Barcelona, Costa del Sol, Dominikanische Republik, New York, Insel Rab, … Milano Marittima …





























