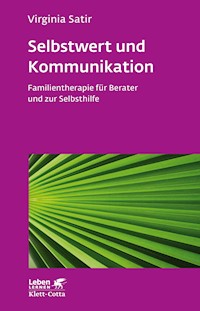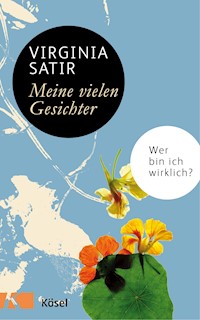19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Leben lernen: kurz & wirksam
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Sobald ein Mensch zur Welt gekommen ist, ist Kommunikation der zentrale Faktor, der über sein weiteres Leben bestimmt. Wie gut gelingt es ihm, vertraute Beziehungen zu knüpfen? Wie produktiv ist er? Kann er Sinn im Leben finden? Dieses Buch gibt Einblick in die Wirkweise von Kommunikation und vor allem, wie wir sie verbessern können, wenn wir auf diesem wichtigen Feld Defizite verspüren. Virginia Satir lädt mit vielen Übungen dazu ein, den eigenen Kommunikationsmustern auf die Spur zu kommen, doppeldeutige Botschaften zu erkennen, die eigenen Reaktionsweisen spielerisch zu verändern, um schließlich zu einem guten Interaktionsstil und zu befriedigenden Beziehungen zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Ähnliche
Virginia Satir
Kommunikation ist ein riesiger Regenschirm
. . . der alles umfasst, was unter Menschen vor sich geht
Mit einer Einführung von Gerd F. Müller
Aus dem Amerikanischen von Maria Bosch und Elke Wisshak
Zu diesem Buch
Virginia Satir, die zu den bekanntesten Familien- und Psychotherapeuten zählt, hat mit ihrer innovativen Herangehensweise zahllose Praktiker aus den helfenden Berufen inspiriert und bereichert und die wichtigsten Grundlagen der Familientherapie gelegt. Dieses Buch widmet sich ihrem Kommunikationsansatz, der Frage, wie Kommunikation wirkt, und vor allem, wie wir sie verbessern können. Zahlreiche Übungen laden dazu ein, den eigenen Kommunikationsmustern auf die Spur zu kommen, doppeldeutige Botschaften zu erkennen und die eigenen Reaktionsweisen spielerisch zu verändern. Eine Einführung in das Werk und Erbe der herausragenden Therapeutin von Gerd F. Müller zeigt die heutige Relevanz auf.
Klienten gelingt es oftmals gerade durch kurze und überraschende Interventionen in der Therapie, neue Perspektiven und Lösungsansätze für das eigene Problem zu finden. »kurz & wirksam« stellt in kompakter Form die effektivsten Kurzinterventionen praxisnah und bündig vor.
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Kapitel 1 – 3 wurden dem Buch entnommen: Virginia Satir: Selbstwert und Kommunikation. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart, 22. Aufl. 2016. Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel »Peoplemaking« © 1972 by Science and Behavior Books Inc., Palo Alto, Kalifornien.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © Adobe Stock/Curioso Photography
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-89231-4
E-Book: ISBN 978-3-608-11086-9
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20392-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Gerd F. Müller
Einführung
1. Begegnung mit Virginia Satir
2. Von der klassischen systemischen Familientherapie zur systemischen Psychotherapie
3. Skizze der Entwicklung in Deutschland
4. Ausgewählte Ingredienzien des wachstumsorientierten Modells von Virginia Satir
5. Integration einiger Werkzeuge und Praktiken von Virginia Satir in meine Art der systemisch-ressourcenorientierten Therapie und Beratung
6. Schluss
Literatur zur Einführung
Zum Autor der Einführung
1. Kapitel
Kommunikation: Sprechen und Hören
2. Kapitel
Kommunikationsmuster
2.1 Beschwichtigen
2.2 Anklagen
2.3 Rationalisieren
2.4 Ablenken
3. Kapitel
Kommunikationsspiele
Gerd F. Müller
Einführung
1. Begegnung mit Virginia Satir
Anfang der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts begegnete ich Virginia Satir zum ersten Mal live. Die TeilnehmerInnen saßen im Stuhlkreis, Virginia Satir stand während des ganzen Seminars und schien nicht zu ermüden. Nein, sie stand nicht, sie bewegte sich im Raum, ging auf Einzelne zu, stellte sich vor eine Teilnehmerin hin, ergriff ihre Hände und verwickelte sie in einen kurzen Dialog. Bei anderer Gelegenheit bat sie die Teilnehmenden, sich in Zweier- oder Dreiergruppen zusammenzufinden und eine der für sie typischen Wahrnehmungsübungen zu machen. Sinnlich erfahrbar wurde, wie unterschiedlich sich diverse Positionen in Triaden anfühlten oder welche Wirkung die einzelnen Kommunikationsformen auf die Gruppenmitglieder hatten. Wenn ein Teilnehmer eine Bemerkung machte oder eine Frage stellte, modellierte Virginia Satir rasch eine Skulptur und gab auf diese Weise ihre Antwort.
Ich war sprachlos, aufgeregt und neugierig zugleich. Noch nie zuvor hatte ich eine Fortbildung erlebt, die so dynamisch, emotional berührend und voller Aktion war. Ich war fasziniert und wollte diese Art zu arbeiten erlernen. Ausführliche Gelegenheiten dazu ergaben sich in den darauffolgenden Jahren bei Fortbildungskursen mit Virginia in den USA und Kanada, später dann auch in Deutschland. Sie war für mich die einfallsreichste, kreativste und außergewöhnlichste Lehrerin, die mir jemals begegnet ist. Zu den Highlights zählten zweifellos die jeweils 10-tägigen Seminare mit Familienrekonstruktionen, die Virginia Satir am Münchner FamilienKolleg zwischen 1982 und 1987 durchführte. Dabei entstand auch ein Film über ihr Leben und ihre Arbeit (Südwestfunk 1983).
2. Von der klassischen systemischen Familientherapie zur systemischen Psychotherapie
Virginia Satir war die Begründerin der system- und wachstumsorientierten Familientherapie und eine der Wegbereiterinnen dafür, dass die Behandlung von psychisch kranken und beeinträchtigten Menschen in vollkommen neuem Licht gesehen wurde. Ihre für den damaligen therapeutischen Kontext ungewöhnliche zentrale Aussage war, dass jeder Mensch psychisch wachsen und sich verändern kann. Offen und vorurteilsfrei arbeitete sie mit Menschen jeglicher Herkunft und mit jeglichem Problem oder Anliegen. Sinngemäß sagte Virginia Satir: »Wenn ich aufhöre, Menschen zu beurteilen, kann ich beginnen, sie zu entdecken.« Ihre Sicht- und Arbeitsweise – ein Gegenentwurf zum damals übermächtigen medizinischen Krankheitsverständnis – brachten psychische Leiden und Krankheiten aus der Ecke des Verrückten, Gestörten, hinter verschlossenen Türen Ablaufenden ins Licht des Normalen und Alltäglichen. Die neuen Wege, die sie im Feld der Psychiatrie, Psychotherapie und Beratung betrat, vermittelte sie in Demonstrationen, die sich unter anderem durch ausdauernde Präsenz, emotionale Wärme und Genauigkeit im Gespräch mit den KlientInnen auszeichneten. Bei den Beobachtern weckte ihre Vorgehensweise Bewusstheit und die Bereitschaft dafür, diese neue Sichtweise – das Gesundheits- und Wachstumsmodell – in die Welt der Therapie und Beratung zu integrieren.
Virginia Satir hielt in der konkreten Arbeit nicht an bestimmten, einmal entdeckten Ideen oder Vorgehensweisen fest, sondern beobachtete präzise, was im Augenblick wirksam und hilfreich für KlientInnen, deren Ziele und Lösungssuche sowie deren Kontext war. Ohne Umschweife veränderte sie ihr Vorgehen, um auf anderen Wegen hin zu den gewünschten Zielen zu gelangen.
Ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Techniken und Methoden sind so zahlreich und vielgestaltig, dass sie in dieser Einleitung nur angedeutet und in begrenzter Auswahl erwähnt werden können. Zum Glück gibt es umfangreiche Literatur von ihr selbst und von den ihr nahestehenden SchülerInnen, ferner eine sehr große Anzahl von Videoaufnahmen. Unvoreingenommen und mutig ließ sie sich schon in den Anfängen der Videotechnik bei ihrer therapeutischen und lehrenden Tätigkeit aufnehmen; so ist zu beobachten und zu hören, wie und was sie konkret tat. Dies ist insofern bedeutsam, als Virginia intuitiv prozessgeleitet und sich an den Antworten der KlientIn orientierend vorging, statt nach einem festen Therapieplan zu arbeiten. Sie realisierte so eine später formulierte Maxime des systemischen Arbeitens: Schließe dich an die Antworten der KlientIn an, vertraue auf den Prozess und sei dir gewahr, dass dein Handeln wirksam sein wird, ohne im Voraus zu wissen, was die Intervention letztlich hervorruft.
Die sich in den 1980er-Jahren entwickelnde systemische Therapie hätte sicher nicht so leicht Eingang in das Feld der Psychotherapie finden können, wenn nicht der Boden für die neue Art, mit Menschen zu arbeiten, durch Virginia Satir und andere Pioniere der klassischen systemischen Familientherapien, wie Salvador Minuchin, Walter Kempler, später auch Martin Kirschenbaum, gelegt worden wäre. Nach der erkenntnistheoretischen Wende – unter anderem bekannt wegen der Nutzung des konstruktivistischen Denkens – würdigten die Vertreter der systemischen Therapie in Abgrenzung zur systemischen Familientherapie die Verdienste von Virginia Satir nicht. Aus heutiger Sicht ist jedoch nicht zu verleugnen, wie fortschrittlich und vorausschauend Virginia Kernpunkte des systemischen Denkens und Handelns in die Tat umsetzte, die erst später als besondere systemische Qualitäten formuliert wurden. Sicher hing dies damit zusammen, dass der Stil ihrer Schriften so gar nicht den sogenannten wissenschaftlichen Standards der Mediziner und Psychologen entsprach. Ihre Texte zeichnen sich durch lockere, eingängige Sprache, Direktheit und schlichte Alltagspraktikabilität aus. Meist sind die Bücher aus Transkripten ihrer Lehrtätigkeit entstanden und deshalb auch in direkter Ansprache der LeserIn gehalten.
Virginia betonte, dass sie in ihrer Tätigkeit an Forschung und theoretisch-wissenschaftlichem Arbeiten nicht interessiert sei; ihre Art zu forschen sei das Beobachten dessen, was im therapeutischen Kontext wirkt. Sie ziehe ihre Schlüsse bevorzugt aus der konkreten Arbeit mit Abertausenden von Menschen. Welche Gewissheit, welcher Wagemut! Man bedenke: Sie war damals – in den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts – die einzige Frau und Nicht-Medizinerin in der männerdominierten therapeutischen Gesellschaft.
Aus heutiger Sicht erscheinen ihr dynamisches Tun und manche ihrer Texte direktiv und belehrend. Man könnte jedoch auch sagen, dass ihre überzeugende Rede den gewollten Effekt der leichten Verstörung beim Klienten zur Folge hatte, sodass dieser die angebotenen oder sich ergebenden Lösungsansätze leichter annehmen, verwerfen oder passend machen konnte. Entwicklungsunterstützend wirkte die von Virginia Satir angebotene Vielfalt der Eindrücke, die die KlientIn im Verlauf eines Prozesses erlebte: auditiv, visuell, kinästhetisch, emotional. Die KlientIn sollte mit all ihren Sinnen wahrnehmen und lernen können.
3. Skizze der Entwicklung in Deutschland
Anfang der 1970er-Jahre reiste Virginia Satir zum ersten Mal nach Europa. Dadurch lernten einige der späteren deutschsprachigen Wegbereiter der klassischen Familientherapie ihren Ansatz als Erste kennen. Fast zeitgleich brachte Salvador Minuchin den strukturellen Ansatz nach Deutschland. Beide waren über Jahre die maßgebenden Vertreter der damals neuen Familientherapie. In deren Gefolge kamen zahlreiche amerikanische FamilientherapeutInnen nach Deutschland und trugen zur Blütezeit der klassischen Familientherapie bei. Diese Entwicklung spiegelte sich in der Gründung der ersten regionalen Institute in Deutschland wider: Gegründet wurden im Juni 1974 das Münchner FamilienKolleg (MFK) von Gaby Moskau und Gerd F. Müller, 1975 das Münchener Institut für Integrative Familientherapie von Carole Gammer und Martin Kirschenbaum sowie das Weinheimer Institut von Maria Bosch.
Das MFK hat sich seit Ende der 1980er-Jahre in der Gruppe der früh gegründeten Institute deutlich von der klassischen Familientherapie zur systemischen Therapie entwickelt und dabei sowohl systemisch-konstruktivistische Vorgehensweisen als auch Ingredienzien des lösungsorientierten und narrativen Ansatzes integriert, dabei jedoch die ursprünglichen Satir’schen Wurzeln, insbesondere hinsichtlich der therapeutischen Haltung, nicht außer Acht gelassen.
Welche Spuren zu finden sind, welche Elemente aus ihrer Arbeit sich bestens mit der zeitgenössischen systemisch-ressourcenorientierten Therapie verbinden lassen, werde ich im 5. Kapitel skizzieren. Zuerst aber möchte ich wesentliche Aspekte des erlebniszentrierten system- und wachstumsorientierten Modells von Virginia Satir darlegen.
4. Ausgewählte Ingredienzien des wachstumsorientierten Modells von Virginia Satir
»Kommunikation umfaßt alle Möglichkeiten, mit denen Menschen Informationen hin und her senden; sie umfaßt die Nachricht, die sie geben und empfangen, und die Weise, wie von dieser Nachricht Gebrauch gemacht wird. Zur Kommunikation gehört auch, wie die Menschen diese Nachricht mit einer Bedeutung versehen. Jede Art der Kommunikation ist gelernt (s. Seite 51 in diesem Buch).« Einmal Gelerntes kann ich auch verlernen oder stattdessen Neues erlernen. Hierzu kann jeder Mensch seine Kognition, seinen Körper, seine Art zu sprechen, seine Werte und Regeln, seine Erwartungen und all seine Sinnesorgane nutzen. Diesen von Virginia Satir beschriebenen Bestandteilen des Kommunikationsprozesses in Verbindung mit der Sicht- und Hörbarmachung der innerpsychischen Prozesse ist diese Einführung gewidmet.
4.1 Selbstwert und Kommunikation
Im Mittelpunkt ihres auf dem Gedankengut der Humanistischen Psychologie beruhenden Konzepts steht das Konstrukt Selbstwert. Virginia Satir betrachtete den Selbstwert als ein elementares menschliches Bedürfnis; sie verstand darunter die Fähigkeit einer Person, das eigene Selbst und dessen Anteile wertzuschätzen und in stets freundlicher und liebevoller Beziehung mit sich zu bleiben. Wie eine Person diese Fähigkeit nutzt, beeinflusst die Eigenart, wie diese Person mit sich und anderen kommuniziert. Verbale und nicht verbale beobachtete und übernommene Kommunikationsprozesse in der Ursprungsfamilie und mit anderen bedeutsamen Menschen während des Heranwachsens haben starken Einfluss auf die Wahrnehmung des eigenen Selbst und die eigenen inneren Dialoge. Wenn sich eine Person irritiert, gestresst oder bedroht fühlt, greift sie sozusagen zu den für diese Gefühlslage während ihres Heranwachsens gelernten Regeln, um sich und ihr Selbst zu schützen; so sorgt sie dafür, in diesem Augenblick des erlebten Stresses psychisch zu überleben. Einleuchtend ist, dass in diesen Momenten der gefühlten Bedrohung der Selbstwert niedrig ist und die Person unwillkürlich inkongruent kommuniziert (anklagend, es anderen recht machen wollend, intellektualisierend, irrelevant). Ein niedriger Selbstwert kann zu Befürchtungen des Versagens führen, was Ängste und Entmutigung auslösen kann. Hierauf schließt sich oft tatsächliches Versagen an; dieses Erleben führt zu Selbstvorwürfen und zu noch niedrigerem Selbstwert usw. Virginia Satir: »Ich versuche zu zeigen, dass es für die Qualität unseres gesamten Verhaltens entscheidend ist, wie gut wir uns selbst wertschätzen.« (Yapko 1988, S. 13)
Anlässlich eines 10-tägigen Seminars im Münchner FamilienKolleg stellte Virginia die Komponenten des Selbstwerts vor: »Echtheit bedeutet Selbstannahme, das heißt, ein Gefühl dafür zu haben, wer wir als Person sind – ohne dass wir Verurteilung, Kritik, Selbstanklagen und herabsetzende Vergleiche als Wahrheiten in uns speichern. Gelingt die Annahme von uns selbst in diesem Sinne, wird in uns Integrität gefördert. Echtheit und Integrität erzeugen Mut. Mut ist die Fähigkeit, Risiken einzugehen, neue Dinge zu tun, verletzliche Gefühle offenzulegen, neue Wege mit unbekannten Seiten unseres Selbst auszuprobieren, aus diesen Erfahrungen zu lernen und persönlich zu wachsen. Dazu bedarf es der Spontaneität: reagieren, ohne sich Gedanken zu machen, was der andere darüber denken könnte: Für das, was ich sage und tue, bin ich selbst verantwortlich. Ich kann erkennen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, und mein Bedauern darüber ausdrücken, ohne mich herabzusetzen oder andere zu beschimpfen. Ich kann zugeben, dass manchmal das Kind in mir in Erscheinung tritt. Ich bin nicht böse, dumm, krank oder verrückt, wenn ich Verhalten und Gefühle zeige, die ich selbst nicht mag und nicht gutheiße. Und schließlich Verbindlichkeit: Dies ist die Bereitschaft, sich selbst festzulegen und eigene Grenzen zuzugeben. Wenn ich eine Verbindlichkeit eingegangen bin, jedoch feststelle, dass ich sie nicht einhalten kann, muss ich meine Grenzen erkennen und die am Kontrakt Beteiligten davon in Kenntnis setzen. Außerdem: Es ist nicht möglich, eine andere Person in einer herabwürdigenden Weise zu behandeln, ohne dabei unser eigenes Selbstwertgefühl zu beschädigen.« (Eigene Mitschrift, Satir 1983)
4.2 Ressourcen
Eine zweite Komponente in Satirs Menschenbild sind Ressourcen; Virginia sieht den Menschen als Fähigkeitswesen. Durch ihre Arbeit zieht sich fortwährend die positive Annahme, dass jede Person Ressourcen und Stärken besitzt. Daher soll die Aufmerksamkeit im Beratungsprozess darauf gerichtet werden, Ressourcen und Stärken zu nutzen, momentan verdeckte zu entdecken und alsdann wertzuschätzen. Auch wenn nicht jeder Mensch zu jeder Zeit in jeder Krisensituation Zugang zu seinen Ressourcen haben kann und es deshalb im Rahmen der Therapie zuallererst der Würdigung des Problems und des Leidens bedarf, sollte die beraterische Haltung im Hintergrund durchgängig vom Vertrauen in das Vorhandensein von Ressourcen gespeist sein. Diese Haltung bewahrt die BeraterIn meist davor, aufgrund der Schilderung der Beschwerden und Leiden in eine Problemtrance mit der KlientIn zu driften, um letztlich nur noch den Fokus der Aufmerksamkeit auf Defizite und Nichtgelingendes zu richten. Die Aussage »jeder Mensch hat Ressourcen« soll daher nicht als absolute Bedingtheit (miss-)verstanden und möglicherweise abgetan, sondern eher als entwicklungsorientierte Einstellung verstanden werden, um hilfreiche Veränderungen im Sinne der KlientIn vorzubereiten und zu erreichen. Aufgabe der TherapeutIn ist es demzufolge unter anderem, immer wieder einzuladen, innere Ressourcen und Stärken als für sich förderlich anzunehmen, um dann im Verlauf des weiteren Prozesses diese zu entdecken, zu entfalten und in Besitz zu nehmen, sodass sie in zukünftigen Krisensituationen für die KlientIn auch verfügbar sind. Selbstverständlich ist es hierbei angebracht, die vorgegebenen Rahmenbedingungen zu explorieren und diese im Sinne der Nutzung der Ressourcen und im Einklang mit den Beratungszielen aufeinander abzustimmen. Diese »empathische Ressourcenorientierung« gestaltet die Suche nach Ressourcen für den Klienten menschlich, wirklichkeitsnah, akzeptabel und realisierbar.
Ohne sich auf Virginia Satir zu beziehen, haben Steve de Shazer und Insoo Kim Berg Ende der 1980er-Jahre diese positive Sicht auf den Menschen in ihrem lösungsorientierten Ansatz in den Mittelpunkt gestellt.
4.3 Wachstumsmodell
»Jeder Mensch trachtet danach zu überleben, zu wachsen und nahe bei anderen zu sein. Alles Verhalten drückt diese Ziele aus . . .« (Satir 1987