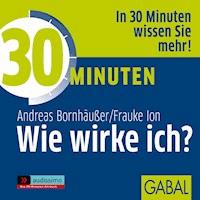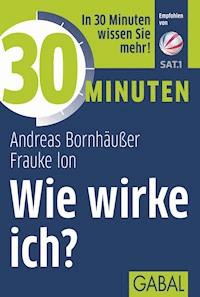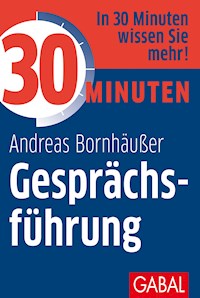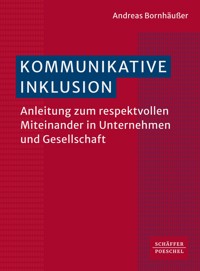
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In einer Welt, die sich stetig verändert, ist erfolgreiche Kommunikation ein entscheidender Schlüssel zum Gelingen von Zusammenarbeit und gemeinschaftlichen Prozessen. Das Buch zeigt, wie bedeutend es ist, in Unternehmen und der Gesellschaft einen respektvollen und wertschätzenden Umgang zu fördern. Der Autor eröffnet einen umfassenden Einblick in die Dynamik von Sprache als wichtiges Instrument der Inklusion und führt konkrete Ansätze zur Förderung einer offenen Dialogkultur vor. Das Buch beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Vermeidung diskriminierender Sprache und dem bewussten Einsatz inklusiver Kommunikation ergeben. Anhand praxisnaher Beispiele wird aufgezeigt, wie kommunikative Barrieren überwunden und Vielfalt konstruktiv genutzt werden können. Ob es um die Anpassung von Führungsstilen in Zeiten disruptiver Veränderungen, die Implementierung von New-Work-Konzepten oder die Rolle persönlicher und kultureller Hintergründe in der Kommunikation geht – dieses Buch bietet praxisorientierte Lösungswege für eine Zukunft, in der alle eine Stimme haben. Ein unverzichtbares Werk für alle, die einen Wandel hin zu echtem Miteinander gestalten wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort1 Einleitung2 Ausgangslage2.1 Diskriminierende Sprache – misslingende Kommunikation2.1.1 Formen der sprachlichen Diskriminierung2.1.2 Gründe für Diskriminierung2.1.3 Beispiele für diskriminierende Äußerungen im Alltag2.1.4 Internationalisierung der Wirtschaft und Social Media2.1.5 Diskussion um Gendersternchen und Co.2.2 Umgang mit Disruption im 21. Jahrhundert2.2.1 Panikmache oder Akzeptanz der Veränderung2.2.2 Bewusste Transformation unserer Sprache2.3 Führungskulturen und Mitarbeitermotivation2.3.1 Klassische Führungsstile2.3.2 Die Mitarbeitenden für den Wandel gewinnen2.3.3 Individuell-situative Führung3 Orientierungshilfe3.1 Entstehung des New-Work-Ansatzes3.2 Sinnstiftung und Schaffung neuer Perspektiven3.3 Übertragung des New-Work-Ansatzes auf Kommunikation4 Kommunikative Inklusion4.1 Persönlichkeitsinventare und ihr praktischer Nutzen4.1.1 Reiss Motivation Profile4.1.2 DISG-Persönlichkeitsmodell4.1.3 SCIL Profile4.1.4 Kompatibilitätszentrierte Haltung4.1.5 Selbstreflexion und Akzeptanz von Andersartigkeit4.2 Fragen versus Vorurteile4.2.1 Fragearten4.2.2 Gesprächsbeispiele4.2.3 Wirksame Gesprächsführung4.2.4 GRID-Verhaltensgitter4.2.5 Die zielführend lenkende öffnende Frage4.3 Kommunikative Inklusion wollen, dürfen und können4.3.1 Leistungsdimensionen und Zuständigkeiten4.3.2 Was bedeutet kommunikative Inklusion?4.3.3 Chancen der kommunikativen Inklusion4.3.4 Risiken von kommunikativer Inklusion4.3.5 Abteilung für interne Kommunikation und kommunikative Inklusion4.3.6 Kommunikative Inklusion in der Früherziehung, Bildung und Weiterbildung4.3.7 Kommunikative Inklusion im Arbeitsumfeld4.3.8 Auswirkungen kultureller Unterschiede auf kommunikative Inklusion4.3.9 Ansätze zur Förderung kommunikativer Inklusion5 Zukunft der kommunikativen InklusionZum guten SchlussNachwortDanksagungBibliografieZum AutorBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6566-3
Bestell-Nr. 12165-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6567-0
Bestell-Nr. 12165-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6568-7
Bestell-Nr. 12165-0150
Andreas Bornhäußer
Kommunikative Inklusion
1. Auflage, Mai 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Corina Alt, Publicate, Birkenwerder
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Alte Männer lästern über Gendersternchen und Doppelpunkte und verabscheuen die Vorstellung, in ihren Stellenanzeigen wegen der politischen Korrektheit zukünftig jedes Mal neben männlich und weiblich auch divers schreiben zu müssen. Junge Frauen ereifern sich über die alten sexistischen Starrköpfe und Lästermäuler. Immer mehr Junge geben den in die Jahre gekommenen Babyboomern die Schuld an den Missständen des 21. Jahrhunderts und kleben sich an Straßen fest. Die Alten haben sich in ihren Seilschaften angekettet und kultivieren ihre Vorurteile und Widerstände gegen alles Fremd- und Neuartige.
Alte weiße Männer weisen die Ideen der Jungen zurück mit den Worten »Du musst dir erst mal die Hörner abstoßen«. Junge dunkelhäutige Männer sagen herablassend »Geh weg, alter weißer Mann«, wenn der ältere deutsche Herr in den öffentlichen Verkehrsmitteln glaubt, aufgrund von Nationalität und Alter dem ihm zustehenden Sitzplatz einfordern zu können. Sie raunen sich untereinander zu, dass man die Alten echt zu nichts mehr gebrauchen kann. Und wechselseitig werfen sich alle zunehmend mit immer lauter werdenden Stimmen ihre Haltungen und ihr Verhalten vor. Sie reden übereinander. Aber sie reden nicht miteinander.
In dem festen Glauben, dass Kommunikation zwischen allen Altersgruppen, Nationalitäten und Geschlechtern gelingen kann, will dieses Buch und der darin besprochene Ansatz der kommunikativen Inklusion einen Betrag zu eben dieser gelingenden Kommunikation leisten.
Und kurz noch ein Hinweis zum Gendern: »Kommunikative Inklusion« ist eine Aufforderung und Anleitung zum Respekt und zur kommunikativen Teilhabe aller Menschen gleich welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe und welcher sexuellen Orientierung. Trotzdem verwende ich im Folgenden im Interesse der Lesbarkeit stets nur die Anreden der binären Geschlechterordnung und relativ wenige Genderzeichen. Ich hoffe, dass sich trotzdem alle angesprochen fühlen. Ich meine Sie alle. Von Herzen.
Andreas Bornhäußer, Berlin, im Januar 2025
1 Einleitung
»Die Sprache ist das Haus unseres Seins«. Diesen Satz hat uns der deutsche Philosoph Martin Heidegger (1889–1976) hinterlassen. Und wie friedvoll versammeln sich Menschen unter dem Dach dieses Hauses? Wie oft nutzen wir die 26 Zeichen unseres Alphabets wirklich als das Alles- und Alle-Verbindende?
Oder wie häufig grenzen wir das Andersartige, Unbekannte und Fremde durch die Wahl unserer Worte aus? Nach meinen Beobachtungen gelingt es uns eher nur leidlich, die Sprache zur Kommunikation zu nutzen. Das lateinische Wort »communicare« bedeutet »eine Sache gemeinsam machen« oder »etwas zur gemeinsamen Sache machen«. Würde uns dies gelingen, gäbe es die beiden stets zusammen verwendeten Widerspruchsworte »Ja, aber« seltener in Dialogen. Faktisch kommt jedoch kaum ein Gespräch ohne dieses Wortpaar aus. Vortrefflich hingegen gelingt uns die Abgrenzung und Ausgrenzung mittels unserer Sprache und in der Folge dann auch durch unsere Handlungen (siehe Abbildung 1).
Abb. 1:
Pointing: »Die da …«
Einer der gefährlichsten Gesellen in diesem Zusammenhang ist das kleine Wörtchen »die«. Wird es doch besonders gerne und besonders oft zur Beschwerdeführung genutzt:
die da oben
die da drüben
die Ausländer
die Schwulen
die Lesben
die Nachbarn
die Politiker
die Chefs
die Mitarbeitenden
… und so weiter. Schiebt sich dann zwischen das »die« und die Zielgruppe noch ein Eigenschaftswort, nehmen die Wertung und die Diskriminierung ihren Lauf:
die arroganten Chefs
die faulen Mitarbeiter
die korrupten Politiker
die alten weißen Männer
die respektlosen Jugendlichen
Diese Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Für den weiteren Verlauf der jeweiligen Gespräche lassen diese Formulierungen allerdings nichts Gutes und schon gar nichts Friedvolles vermuten. Was aber ist die Alternative?
Denk- und machbare Antworten auf solche Formulierungen sowie die praktische Umsetzung im Alltag von Teams, Organisationen und Unternehmen – darum geht es auf den folgenden Seiten. Schon der Titel dieses Buches zeigt, wohin die Reise geht. Inklusion bedeutet ursprünglich, dass Menschen mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen aktiv in alle Aspekte des Lebens einbezogen werden, einschließlich Bildung, Arbeit und gesellschaftliche Aktivitäten.
Das Konzept der kommunikativen Inklusion verfolgt das Ziel, Lust auf ein vorurteilsfreies und wertschätzendes Miteinander zu machen und es zugleich zu ermöglichen. Die in Unternehmen und in der Gesellschaft insgesamt so vielfach gepriesene und geforderte Diversität wird nur gelingen, wenn Menschen aller Nationalitäten, Geschlechter, Hautfarben, sexueller Neigungen, beruflicher Positionen, gesellschaftlicher Status sowie Altersgruppen in den Diskurs und Dialog einbezogen werden und daran teilnehmen können.
Damit ist keineswegs ein ausschließlich auf Konsens ausgerichtetes Miteinander gemeint. Die Sprache als Mittel der Kommunikation dient der Verständigung, dem Vermeiden von Missverständnissen und dem Herstellen von Verständnis. Verständnis beinhaltet aber eben auch das Verständnis für eine andere Sicht des Gegenübers. Es kann nicht immer Einverständnis erzielt werden. Oft gilt es auch einfach nur, den Standpunkt des anderen anzuerkennen und zu respektieren. Das Wort Diskurs leitet sich vom lateinischen Wort »discurrere« ab und das heißt übersetzt »auseinanderlaufen«.
So, wie wir es zum Beispiel bei der Diskussion um die Genderzeichen beobachten können (siehe Abbildung 2). Während sich die einen für eine gesetzlich verordnete strikte Nutzung des Gendersterns stark machen, plädieren andere für die freiwillige Nutzung des Doppelpunkts und wieder andere sehen in diesen Zeichen eine Verunglimpfung der deutschen Sprache und fürchten deren Untergang.
Ich persönlich danke all denjenigen, die mit der gesamten Thematik eine meiner Meinung nach wertvolle Diskussion ausgelöst haben. Denn hinter dieser Diskussion steht das Bemühen um kommunikative Inklusion. Genau deshalb wünsche ich den Vertretern der verschiedenen Standpunkte einen möglichst undogmatischen Umgang mit dem Thema. Und genauso soll auch dieser Text verstanden werden: Er ist ein Angebot, eine Einladung und eine Anleitung; frei von jedem Dogma oder gar dem Anspruch, es handle sich hier um der Weisheit letzten Schluss.
Abb. 2:
Genderstern und Co.
Den Hauptteil dieses Buches habe ich in drei Kapitel und mit jeweils drei Unterkapiteln gegliedert.
Kapitel 2 dient der Sensibilisierung und Problembewusstmachung. Kapitel 2.1 befasst sich mit einigen begrifflichen Klärungen und schildert verschiedene Situationen sprachlicher Diskriminierung. In Kapitel 2.2 spannen wir den Bogen etwas weiter und untersuchen die Wechselwirkungen zwischen wirtschaftlichen Entwicklungen und der Sprache. Und in Kapitel 2.3 machen wir einen Ausflug in die Geschichte der Führungspsychologie und betrachten die Sprache von ihrer Seite als Kulturgut im Allgemeinen und als Ausdrucksform von Führungskultur im Besonderen.
Kapitel 3 ist dem in den 1970er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom Sozialphilosophen Frithjof Bergmann entwickelten New-Work-Ansatz gewidmet. Ein Konzept oder Modell, das zu Beginn des 21. Jahrhunderts reüssierte und mit Einsetzen der Pandemie noch einmal zusätzlich an Fahrt aufgenommen hat. Im Rahmen der Beschäftigung mit diesem Modell betrachten wir den Wert von Sinnsuche und Sinnstiftung für unsere Sprache und bauen eine Brücke zur kommunikativen Inklusion.
Kommunikative Inklusion ist dann schließlich in Kapitel 4 Hauptgegenstand der Ausführungen. Während wir in Kapitel 4.1 drei verschiedene Persönlichkeitsinventare vorstellen und deren Nutzen für das kommunikative Miteinander beleuchten, befassen wir uns in Kapitel 4.2 mit der Qualität von Fragen für vorurteilsfreie Kommunikation. In Kapitel 4.3 zeige ich schließlich anhand konkreter Beispiele auf, wie kommunikative Inklusion in Unternehmen und Gesellschaft praktisch angewendet werden kann.
Ihnen, verehrte Leserin, verehrter Leser, wünsche ich einige anregende und aufregende Momente beim Lesen dieses Buches. Wenn Sie meinen Überlegungen zustimmen, freue ich mich. Und wenn nicht? Dann wünsche ich Ihnen und mir, dass Sie meine vielleicht sehr von Ihrer Sicht abweichenden Standpunkte respektieren können.