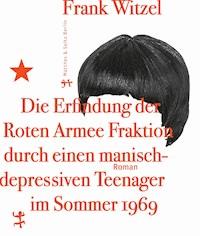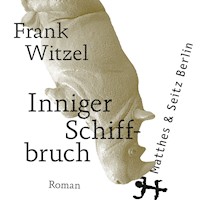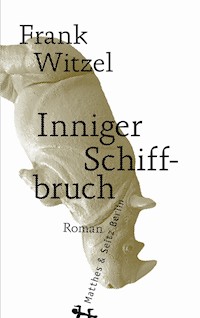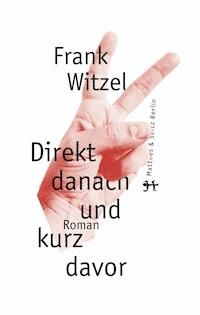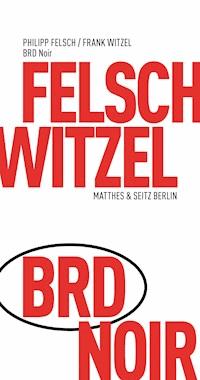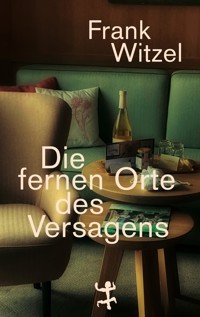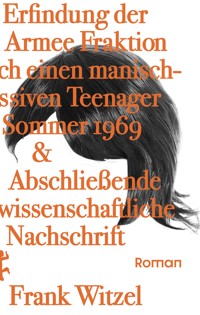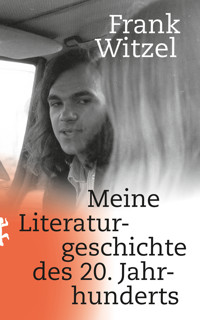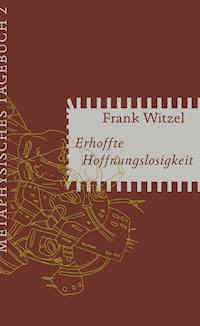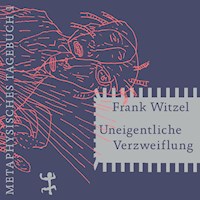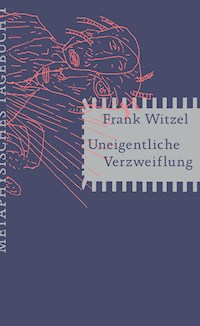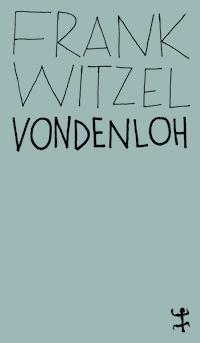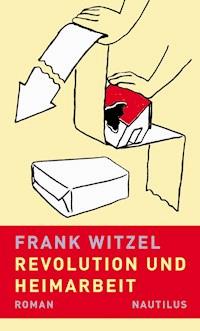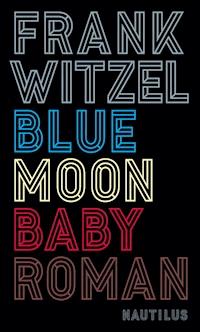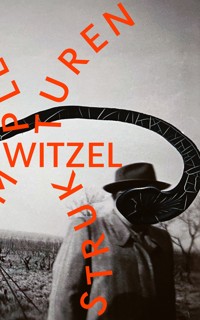
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das, was nach außen hin als schlichte Erzählung, kurze Anekdote, nebensächliche Beschreibung erscheinen mag, weist bei genauer Betrachtung oft eine Anzahl weitverzweigter Verbindungsstränge auf, die in historische, philosophische, psychoanalytische Tiefen führen. Solchen »komplexen Strukturen« ist Frank Witzel in seinem neuen Buch mit dem gleichnamigen Titel auf der Spur. In achtzig Texten untersucht der Autor auf eine gleichzeitig erzählende wie selbstreflektierende Weise Strukturen, die von der Harmlosigkeit bis zur Demütigung, von der Parabel bis zur Schulpause, von der Verpuppung bis zur Willenskraft reichen. So entsteht das eigenwillige Panorama einer Enzyklopädie des Zufalls, die jedoch gerade dadurch, dass sie sich weder auf einen Stil noch auf ein Thema beschränkt, eine pulsierende, beständiger Veränderung unterworfene Systematik offenlegt. In abgründig virtuosen Texten voll abenteuerlicher Fabulierlust, die sich mal als Erzählung, mal als Anekdote entpuppen, rüttelt Frank Witzel an den Grundfesten einer Welt, die sich selbst recht unzureichend zu kennen scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Komplexe Strukturen
FRANK WITZEL
KOMPLEXE STRUKTUREN
INHALT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES ANFANGS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES AUSWEICHENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER HARMLOSIGKEIT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER DEMÜTIGUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR GESELLSCHAFTLICHER VERPFLICHTUNGEN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER KLEINFAMILIE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER UNIVERSALGESCHICHTE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES BEGEHRENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES TELESHOPPINGS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES SYMBOLISCHEN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES DICHTERS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES ZITATS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SPIELREGEL
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER DIAGNOSTIK
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES BASTELBOGENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES EINBROCKENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER PARABEL
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES TRAUMS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER AHNENREIHE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES REISENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES GENIES
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SCHULPAUSE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES UMBAUTEN RAUMS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES WETTERS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER USA
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER KRIMINALISTIK
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER WANDLUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER LEERE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER ANTIKE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER EIFERSUCHT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SCHULD
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER NOVELLE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES VERLUSTS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SELBSTVERGESSENHEIT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER GENESUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES SONNTAGNACHMITTAGS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES FASCHISMUS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER BEZÜGLICHKEIT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES SCIENCE-FICTION-ROMANS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER VERPUPPUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER STIGMATA
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES MONOLOGS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES TODESTRIEBS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SEMANTIK
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER VERWEIGERUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER RELIGION
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SYMPTOMVERSCHIEBUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER WILLENSKRAFT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER MELANCHOLIE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES FERNSEHKRIMIS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER NACHKRIEGSZEIT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES POSTMODERNEN ROMANS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER LITERARISCHEN FORM ALLGEMEIN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER GEISTERERSCHEINUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER TODESARTEN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SEELE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER MUSIK
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER ANATOMIE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER FORSCHUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER HINGABE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER VORSICHT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER LITERATURKRITIK
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES AUFWACHSENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES ANEKDOTISCHEN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER SITTEN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES KAFKAESKEN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER VATERBEZIEHUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER GEISTESABWESENHEIT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER STRASSENNAMEN
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER PSYCHOANALYTISCHEN TOPOLOGIE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER ORDNUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES SELBST
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER EINSAMKEIT
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES SCHATTENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER GERICHTSVERHANDLUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER PSYCHIATRIE
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER VÖLKERVERBINDUNG
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES STERBENS
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER KOMPLEXEN STRUKTUR
Mein Leben ist völlig ohne Sinn. Wenn ich seine verschiedenen Epochen betrachte, so geht es mit meinem Leben wie im Lexikon mit dem Worte »Schnur«, welches fürs erste ein Seil bedeutet, zum anderen eine Schwiegertochter. Es fehlte nur noch, daß das Wort »Schnur« drittens ein Kamel bedeute, viertens einen Staubbesen.
Søren Kierkegaard
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES ANFANGS
»Am Anfang fehlte das Wort, und dieses Fehlen des Wortes war beim Menschen.«
Ich fand diesen Eintrag in einer alten Kladde, als ich mein Zimmer aufräumte, konnte aber nicht mehr sagen, ob es sich um eine Notiz handelte, die ich während einer Vorlesung von Professor Ahrend angefertigt hatte, oder ob der Gedanke von mir selbst stammte. Darunter die Frage: »Fehlt dem Menschen nicht generell der Anfang, weil alles immer schon da ist, auch er selbst, sobald er ein Bewusstsein erlangt?« Ich versuchte mich an meine Studienzeit zu erinnern, doch das Einzige, was mir zu Professor Ahrend einfiel, war seine angeblich fragwürdige Vergangenheit, von der immer wieder die Rede gewesen war. Hatten wir deshalb von ihm gelernt, ausnahmslos alles infrage zu stellen?
Um viele Fragen nicht nur beantworten, sondern überhaupt stellen zu können, fehlte mir damals der Überblick. »Bewusstsein« etwa stellte ich mir als Keksdose vor, die jemand außerhalb meiner natürlichen Reichweite auf einem Schrank platziert hatte. Stand dieser Schrank im Wohnzimmer oder in der Küche? Ich war unfähig, das zu sagen, wusste nur, dass das Bewusstsein insofern einer Keksdose glich, als man es erlangen musste. Aber half es, sich dazu auf einen Stuhl zu stellen? Und womit wäre dieser Stuhl zu vergleichen? Mit dem, was Professor Ahrend als »Grundlagen der Theoriebildung« bezeichnete und in einem Seminar zu erläutern versprach, das ich allerdings nicht besuchte?
War es Zufall, dass ich nicht mehr wusste, wer die in meiner Handschrift notierten Sätze formuliert hatte? Denken ist ein Adaptionsprozess. Leben ebenso. »Der Theoretiker«, so Professor Ahrend, »steht außerhalb der Lebensprozesse. Er hat den archimedischen Punkt gefunden. Der Hebel, den er anlegt, wird zur Wippe zwischen Erkenntnis und Einflusslosigkeit.« Ich übersetzte dieses Aussagen in ein konkretes Bild und sah mich auf einem wackligen Stuhl stehen, nach der Keksdose schielen und der Frage nachgehen, ob es eine akzidentelle oder essenzielle Eigenschaft von Keksdosen war, sich auf Schränken zu befinden.
Die Welt schien meinem Zugriff entzogen. War ich aber deshalb schon Theoretiker? Die Formulierung »außerhalb aller Prozesse«, die Professor Ahrend benutzte, erschien mir im Nachhinein beinahe prophetisch, da er schon kurze Zeit später im Verlauf eines juristischen Prozesses mit der Tatsache konfrontiert wurde, wie fragwürdig und fragil diese Position tatsächlich war. Selbst der Begriff »dauerhaft« bekam schon bald einen bitteren Beigeschmack für ihn. Es war Herbst, die Zeit, in der sich die Keksdosen langsam zu füllen beginnen. In einer Illustrierten erschien ein Foto von Professor Ahrend, unter dem stand: »Auch Professoren müssen lernen, dass vor Gericht andere Regeln gelten als in der Welt der Wissenschaft.« Sein Blick wirkte unsicher auf diesem Foto. Fast so, als hätte er bereits während der Aufnahme den Satz geahnt, mit dem die Abbildung kommentiert werden würde. Die Richter schienen froh, Professor Ahrend mit ihren Gesetzen konfrontieren zu können. Die Journalisten schienen froh, Professor Ahrend daran erinnern zu können, dass die Regularien der akademischen Welt für sie keine Gültigkeit besaßen. Professoren neigen dazu, das zu vergessen. Sie neigen dazu, die von ihnen entwickelten Verfahrensregeln zu überschätzen.
Dass wir aufgerufen wurden, als Zeugen auszusagen, hätte sich Professor Ahrend denken können. Nicht allerdings, dass wir in Uniform vor Gericht erscheinen würden. Manchmal ändern sich Dinge über Nacht. Manchmal steht eine Keksdose auf einem Schrank, ohne dass sich Kekse darin befinden. Ich fragte mich, ob sich der Punkt bestimmen lässt, an dem eine Keksdose nicht mehr als Keksdose bezeichnet werden kann, zum Beispiel wenn Patronen in ihr aufbewahrt werden oder Mikrofilme. Dann überlegte ich, wie Professor Ahrend diese Frage beantwortet hätte. Wie würde er die Nachricht aufnehmen, dass ich mein Studienfach inzwischen gewechselt hatte und nicht länger Philosophie, sondern Jura studierte? Der Jurist sieht die Keksdose auf dem Schrank mit völlig anderen Augen als der Philosoph. Für ihn mag es zum Beispiel eine Rolle spielen, ob sich diese Keksdose außerhalb der Reichweite von noch nicht strafmündigen Kindern befindet. Zudem hat er die zweckentfremdende Benutzung eines Stuhls in Erwägung zu ziehen. Darüber hinaus die Bedeutung des Schranks. Ebenso die Bedeutung des Zimmers, in dem sich dieser Schrank befindet. Ebenso die Bedeutung der Personen, die sich zu diesem Zimmer Zugang verschaffen. Ebenso die Bedeutung der Uniformen, die diese Personen tragen. Der Philosoph kann diese Eigenschaften allesamt vernachlässigen. Er muss sie sogar vernachlässigen. Allerdings spricht er in diesem Zusammenhang nicht von »Vernachlässigung«, da der Begriff Vernachlässigung in der Philosophie eine grundlegend andere, nämlich positive Bedeutung hat. Professor Ahrend sprach in seinen Einführungsveranstaltungen immer wieder über die »notwendige Vernachlässigung des instinktiven Realitätssinns« als Voraussetzung für das Philosophieren.
»Teil einer Gemeinschaft sein«, etwas Vergleichbares hörten wir von Professor Ahrend, soweit ich mich erinnern kann, nie. Er sprach von der Form, aber nie von der Uniform, obwohl ihm diese doch als die gesellschaftliche Verwirklichung der Form hätte erscheinen können. Wir lernten Generalisieren, ohne je einen Gedanken an den General zu verlieren. Wir sprachen über Aufklärung, ohne diese mit der Tätigkeit des Soldaten in Verbindung zu bringen. Und doch ist es vor allem der Soldat, der die Aufklärung aktiv betreibt. Was nützt mir ein archimedischer Punkt, wenn ich nichts über strategische Punkte weiß? Bietet nicht auch der Begriff »Nachschublinie« Stoff für tiefgründige Reflexionen?
Ja, den Menschen fehlt der Anfang, und sie tragen dieses Fehlen als ewigen Makel mit sich. Doch sind sie diesem Fehlen deshalb noch lange nicht hilflos ausgeliefert. Der Mensch hat die Möglichkeit eines Neuanfangs. Das unterscheidet ihn vom Tier, das zwar mit sich identisch zu sein vermag, aber Veränderung nur bemerkt, wenn der Mensch sich seiner annimmt. Ich muss nur die Augen schließen, um Professor Ahrend bestimmte Begriffe erläutern zu hören, selbst wenn wir diese Begriffe in seinen Seminaren niemals behandelt haben. Diese Eigenschaft befähigt mich, in den Zeugenstand zu treten. Ich weiß, dass Professor Ahrend jeder Neuanfang suspekt war. Hätte er erkennen können, dass im Wort suspekt das Emporschauen (suspicere) enthalten ist, etwa zum Olymp (ad Olympum) oder zum Himmel (in caelum), wäre ihm deutlich geworden, dass wir gerade im Denken einer anderen Kraft unterstehen, wir uns folglich immer »unterstehen« zu denken. Um es zusammenzufassen: Wir müssen wieder lernen, uns dem Suspekten zu unterstellen. Und erneut die Kraft des Einfältigen entdecken.
Ich stelle mir das Einfältige als Tuch vor, das nur einmal gefaltet wird. Es besteht aus Damast oder Brokat und wird nur an hohen Feiertagen aufgelegt. Würdig, einen Altar zu bekleiden, liegt es über den Küchentisch gebreitet, und andächtig stehen wir vor ihm, den Schrank mit der Keksdose im Rücken, und blicken auf die mit Suppe gefüllte Terrine. Die Schöpfkelle, das Tafelsilber, alles Begriffe, die neu gedacht und historisch eingeordnet werden müssen.
Ist der Mittagstisch abgeräumt, drängt es die Familie nach draußen, um einen verschlungenen Feldweg zwischen Äckern entlangzugehen. Durch die vogelleere Luft über ihr treibt eine einzige Wolke, die keine besondere Form hat. Dort die Haushaltsschule, dort der Wald, dort der Weg, dort der Seitenarm des Flusses. In seiner Zelle beschreibt Professor Ahrend die Rückseite des Bogens, auf dem ihm der Erhalt seiner wenigen Habseligkeiten zur Aufbewahrung quittiert wurde. Unter anderem ist dort zu lesen: »Die Worte und Sätze wurden in ihrer mythologischen Leere sichtbar. Man hatte sich einzugestehen, dass Reden nichts weiter als eine Form des rituellen Austauschs war und weder etwas aussagte noch bewirkte. Sprechen ist Ritus ohne Mythos. Geschichte, nicht retrospektiv betrachtet, sondern als das Zu-Erstrebende, verfällt der Vorstellung einer ungestalteten Zeit, der wir hinterherhetzen.«
Es vergingen Monate, bis ich wieder etwas von Professor Ahrend hörte. Fast hätte ich ihn vergessen, als mich eines Morgens ein Brief mit behördlichem Siegel und der knappen Nachricht erreichte, es sei Professor Ahrends Wunsch gewesen, dass ich seine letzten handschriftlichen Aufzeichnungen erhalte. Ich setzte mich an den tischtuchlosen Küchentisch und las: »Für einige Tage wurde es sehr ruhig. Kein Geräusch war auf den Gängen zu hören, niemand kam zu mir herein. Draußen fielen Blüten. Vielleicht war es aber auch Schnee, der den Hof langsam füllte. Die verschluckten Eisennägel lagen in meinem Magen und schliefen. Und ich schlief auch. Meine Gedanken schliefen, und mein Körper bewegte sich nur versehentlich. Alles sah auf mich herab: die Decke der Zelle, die Wände der Zelle, das Fenster der Zelle. Dann spürte ich eine Katzenpfote auf meiner Stirn und dann den vorsichtig pickenden Schnabel einer Krähe. Dann war ich wieder vernehmungsfähig und musste aufstehen und einem Mann in Uniform den Gang entlang folgen, durch eine doppelte Tür und noch eine, in eine Art Schleuse, in der ich diesem Mann für einen Moment sehr nah kam, weil wir warten mussten, dass sich die zweite Tür öffnete. In diesem Moment hätte ich ihn erwürgen können, wäre ich nicht so kraftlos gewesen. Ich hätte ihm das Genick brechen können und beide Türen wären verschlossen geblieben und erst aufgegangen, wenn genügend bewaffnetes Wachpersonal auf beiden Seiten versammelt gewesen wäre. Aber das war nur ein Gedanke, ein Gedanke, der mir allerdings jeden Tag aufs Neue in dieser knappen Minute in der Schleuse kam. Ich wusste, dass dieser Gedanke nicht von mir stammte, weshalb er mich nicht weiter beunruhigte. Er war einfach sehr oft hier an dieser Stelle gedacht worden, und deshalb dachte ich ihn auch. Wer ihn als Erster gedacht hatte, ließ sich nicht mehr feststellen. Womöglich hatte ihn die Schleuse sogar selbst generiert. Dann saß ich drei Männern gegenüber und sagte nichts. Ich schwieg nicht einmal aus Trotz, sondern weil ich nicht wusste, was man von mir hätte hören wollen. Es ist wichtig, anderen das zu sagen, was sie verstehen können, anstatt das zu sagen, was man selbst zu verstehen meint. Nur selten überschneidet sich das, was jemand meint, mit dem, was andere zu hören erwarten. In solchen Momenten kann eine Religion entstehen. Während ich mich nach dem ergebnislosen Verhör in meiner Zelle auf die Pritsche lege, stelle ich mir vor, was für eine Religion ich stiften würde oder, da ich von denen abhängig wäre, die das glauben, was ich meine, überhaupt stiften würde können. Es ist ein reines Gedankenspiel, denn ich tauge nicht zum Religionsstifter, da ich nichts weiter zu verkünden habe. Mit diesen Gedanken schlafe ich ein. Es sind meine offiziell letzten Gedanken, das, was ich in einem Zustand gedacht habe, den ich selbst noch für bewusst halte. Anschließend kommt mir allerdings noch Folgendes in den Sinn: ›1. Sollte ich noch einmal erwachen, werde ich das alles vergessen haben. 2. Trotz dieses Vergessens werde ich nicht meinen, mein Bewusstsein verloren zu haben, sondern überzeugt sein, ein Bewusstsein zu besitzen. 3. In diesem Zusammenhang stellt sich folgende wichtige Frage: Hatte ich diese Gedanken bereits das letzte Mal vor dem Einschlafen oder sogar schon das vorletzte Mal? Denke ich vielleicht immer wieder dasselbe beim Einschlafen und kann mich lediglich beim Aufwachen nicht mehr daran erinnern?‹ Wenn schon eine Religion, dann eine mit einer langen Bußperiode, gefolgt von einer aufwändigen Vergebungszeremonie. Vierzehn Monate erscheinen mir für eine solche Bußperiode durchaus angemessen. Vierzehn Monate, in denen Streitende getrennt und Liebende zusammengeführt werden. Oder wäre es umgekehrt sinnvoller? Ich höre eine Stimme, die sagt: ›Du träumst‹. Und weil sie recht hat, höre ich mit dem Denken auf und schlafe nun wirklich ein.«
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DES AUSWEICHENS
Unmittelbar nach dem Aufwachen werde ich gefragt, ob der Fernseher eingeschaltet werden soll. Als die Frau im gepunkteten Kleid am Fenster vorbeigeht und einen Luftzug erzeugt, ist die Sonne für einen Moment zwischen den Lamellen der Jalousie zu sehen. Es ist eine unbewegliche Sonne über einem Kartoffelfeld.
Eine Sprache verstehen, ohne zu wissen, ob man sie selbst sprechen kann. Eine Mimik interpretieren, ohne zu wissen, ob man sie selbst zuwege brächte. Zu wissen, was ist, ohne zu wissen, ob man es benennen könnte. Das alles heißt so viel wie nichts wissen.
Es gibt eine Theorie, die besagt, dass die Narkose den Schmerz nicht ausschaltet, sondern lediglich die Fähigkeit einschränkt, ihn wahrzunehmen. Der Schmerz existiert als objektive Gegebenheit im Körper des Narkotisierten, da jedoch die Wahrnehmung des Narkotisierten eingeschränkt ist, kann er ihn weder als Gefühl definieren noch sich später an ihn erinnern. Deshalb sind die Träume, die ein Narkotisierter in den ersten drei Nächten nach seiner Narkose hat, vom Versuch geprägt, diesen Erfahrungsverlust auszugleichen. Immer wieder sehen Frischoperierte im Schlaf Menschen vor sie hintreten, die ihnen Operationsbesteck auf einem Tablett präsentieren und sie auffordern, sich damit zu verletzen.
Wie jeden Morgen bekomme ich ein flaches Tablett mit einer Schachtel auf mein Bett gestellt. Mit geschlossenen Augen nehme ich einen Gegenstand aus dieser Schachtel, halte ihn eine Weile in der Hand und lege ihn schließlich neben die Schachtel auf das Tablett. Bevor ich die Augen öffne, versuche ich, diesem Gegenstand eine Bedeutung zu geben, ihm eine Farbe, eine Vorder- und Rückseite, vor allem einen Grund für seine spezifische Form zuzuordnen. Das Öffnen der Augen, um den Gegenstand zu betrachten, ist regelmäßig mit einer Enttäuschung verbunden. Ich bin von der Realität enttäuscht und frage mich gleichzeitig, wie man von der Realität enttäuscht sein kann.
Real sein bedeutet nicht formbar sein. Das Reale kennt keine Möglichkeiten.
Ich schließe die Augen und ertaste den nächsten Gegenstand in der Schachtel. Um meine Enttäuschung einzuschränken, vertraue ich nicht länger auf die Kraft meiner Vorstellung, sondern versuche, mich bereits in der Interpretation des Ertasteten einer vermeintlichen Realität anzupassen. Noch habe ich keine Bezeichnungen für die Gegenstände. Dafür meine ich, einen Geruch wahrzunehmen, der aus einer Ecke des Raumes kommt. Ich lege die Gegenstände, jetzt mit offenen Augen, zurück in die Schachtel, nehme die Schachtel und stelle sie auf meinen Nachttisch, nehme das Tablett und lege es auf die Schachtel. Wieder schließe ich die Augen.
Bevor man Äther kannte, ging es bei einer Operation vor allem um Geschwindigkeit. Der Chirurg Napoleons rühmte sich, er könne in der Zeit, die es brauche, eine Prise Schnupftabak zu nehmen, eine Schulter amputieren. Geschwindigkeit scheint heute nicht mehr nötig. Die Ärzte können sich Zeit lassen. Wenn die Theorie stimmt, nach der ein Anästhesierter den Schmerz spürt, jedoch im Moment des Spürens bereits wieder vergisst, wären Wahrnehmung und Vergessen nicht voneinander unterschieden. Unser Gedächtnis würde demnach nicht mit Wahrnehmungen gefüllt, sondern im Gegenteil durch das Wahrgenommene entleert. Operierte sehen folglich nicht deshalb die Welt »wie neu«, weil sie wieder ohne Schmerzen leben können, dem Tod entkommen sind und was es als Erklärungsversuche für diesen post-operativen Gemütszustand noch geben mag, sondern weil sie der Welt wahrnehmungslos entgegentreten. Während der Operation werden nicht allein Hautschichten durchschnitten und Gefäße getrennt, es finden weitere, noch unerforschte Prozesse statt.
Zudem wird der Mensch durch den operativen Eingriff zur Schachtel. Er empfindet seinen Körper als Gefäß, das geöffnet wird, um Teile seines Inhalts zu entnehmen. Es ist nicht richtig, von einer »sterblichen Hülle« zu sprechen. Die Hülle bleibt bis zuletzt stabil und folgt lediglich dem innerlichen Verfallsprozess. Das Innere stirbt immer zuerst. Die Sterblichkeit des Menschen entstammt seiner Innerlichkeit. Daher schätzen wir die Oberfläche zu Unrecht gering, da sie selbst dann noch besteht, wenn der innere Kern, auf den sich unsere Aufmerksamkeit fälschlicherweise konzentrierte, bereits zerfallen ist.
Wir sind Schachteln unter Schachteln und wissen nicht um unsere innere Leere.
Nachts sehe ich Teile einer Leuchtschrift durch die Lamellen der Jalousie. Ich gehe davon aus, dass es sich um Buchstaben handelt, die den Namen des Gebäudekomplexes bilden, in dem ich mich befinde. Daneben meine ich eine Spritze zu erkennen. Eine Spritze, die aus einer Schachtel genommen, aufgezogen und appliziert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wo an meinem Körper sich eine Einstichstelle befinden könnte. Womöglich im Hals. Vielleicht unter der Zunge.
Immer dann, wenn etwas fraglos erscheint, droht eine Gefahr, da es den Zustand der Fraglosigkeit nicht gibt. Bereits im nächsten Moment klopft es an der Tür. Alle Fragen, die in diesem Moment und in entsprechender Panik hervorgeholt werden, kommen zu spät. Sie sind konstruiert und darum unnütz.
Die Frage »Liebst du mich?« ist ähnlich sinnlos wie die Frage, ob man nach dem Erwachen den Fernseher anhaben will. Es gibt auf diese Fragen keine Antwort. Es gibt nur Möglichkeiten, diesen Fragen auszuweichen.
Eine der beiden Frauen erzählt mir, sie habe einmal ein Erdbeben verschlafen, da sie vor dem Zubettgehen ein starkes Schlafmittel genommen habe und deshalb erst spät am nächsten Vormittag dadurch geweckt worden sei, dass Feuerwehrmänner mit Äxten die Tür zu ihrer Wohnung einschlugen. Dem Wohnhaus habe ein Teil der Vorderfront gefehlt. Das Dach war herabgestürzt, sämtliche Fenster zu Bruch gegangen. Allein ihr Schlafzimmer, das nur ein kleines Fenster nach hinten zum Hof hatte, war verschont geblieben.
Ich stelle mir folgendes Gemälde vor: besagte Frau als kleines Mädchen auf einem grünen Samtkissen kniend vor ihrer Mutter, die in einem Abendkleid in einem Sessel sitzt und eine Zigarette raucht. Die Malerei, später die Fotografie sind deshalb so beliebte Ausdrucksformen, weil sie nichts verraten. Sie zeigen, ohne mitzuteilen. Man kann ihre Bedeutung übersehen.
Je realistischer, desto stummer, desto interpretierbarer, desto fehlbarer.
Es gibt Kulturen, die der Auffassung sind, es müssten erst genügend Menschen einen bestimmten Vorgang träumen, damit er in Wirklichkeit geschehen, also real werden kann. In der Narkose, ähnlich wie im Traum, kann der Mensch nichts verlieren. Er kann nichts verlieren, weil er nichts besitzt. Dafür kann er alles sein.
Natürlich habe ich mir diese Kulturen ausgedacht. Ich habe sie mir ausgedacht, um dem, was ich denke, einen Raum zu geben. Eine Heimat. Einen Zufluchtsort. Selbst, wenn dieser Vorgang legitim sein sollte, habe allein ich die Verantwortung dafür zu tragen.
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER HARMLOSIGKEIT
Werbeplakate für Zigaretten waren seiner Meinung nach zu Recht verboten, da die darauf abgebildeten Frauen mit teilweise obszönen Haltungen ihrer Finger bestimmte Richtungsanweisungen gaben, denen er sich nicht immer hatte widersetzen können, weshalb er an manchen Tagen für mehrere Stunden und bis zur Erschöpfung gewisse Wegstrecken abgelaufen war. Nun, da an den Litfaßsäulen lediglich für Milchmixgetränke und Pausensnacks geworben wurde, konnte er seine Spaziergänge vergleichsweise frei gestalten.
Die Stadt war leer. Sie war vom »Bodensatz« befreit, wie er meinte, einen Arbeiter sagen zu hören, der am Rand einer Baugrube stand und von dort, übrigens völlig ungesichert, ein stahlummanteltes Seil herunterließ. »Was tut sich da unten?«, fragte er, um eine harmlose Konversation zu beginnen, doch der Arbeiter schüttelte lediglich den Kopf, was so viel bedeuten mochte wie: »Das wollen Sie nicht wissen« oder: »Selbst, wenn ich Ihnen darauf eine Antwort geben, würden Sie es nicht verstehen«.
Die öffentlichen Anlagen waren immer noch öffentlich. Zumindest schienen sie für andere öffentlich, da diese sich in ihnen aufhielten, während er sich scheute, durch das Tor zu gehen, weil darin eine Willensbekundung läge, die nicht nur falsch aufgefasst, sondern auch jederzeit kontrolliert und zurückgewiesen werden könnte. Für eine entsprechende Kontrolle aber hatte er nichts vorzuweisen.
Die meisten Menschen taten harmlos, ohne es selbst zu wissen. Ihr Leben wurde eingerahmt von Politikern auf Kunstrasen vor sündhaft teuren Villen und von schlecht bezahlten Schauspielern auf kleinen wackligen Bühnen in Fußgängerzonen. Was sich dazwischen abspielte, nannten sie herablassend »Alltag«.
Einmal hatte er gemeint, Maria zu erkennen. Nachdem sie ihre Einkünfte als Fotomodell für Zigarettenwerbung verloren hatte, stand sie nun zwischen einem Obststand und einem Mann, der Fleckenmittel verkaufte, vor einem aufgespannten weißen Tuch und sagte zu einem männlichen Schauspieler in grauem Anzug: »Guten Tag, wo geht es bitte zur Wahlurne? Ich möchte nämlich wählen, müssen Sie wissen. Wählen, damit alles sich zum Guten wendet.« »Da tun Sie gut dran«, antwortet der Mann, »gehen Sie einfach nach hinten durch, dort liegt schon das Nötige für Sie bereit.« Maria verschwand darauf hinter der Plane. Als sie kurze Zeit später auf der anderen Seite erschien, trug sie einen mit wunderbarem Blumenschmuck verzierten Hut, so dass die Kinder juchzten, die Frauen sich mit kaum wahrnehmbaren Kopfbewegungen gegenseitig darauf aufmerksam machten und die Männer anerkennend nickten.
In einer Bar, genauer: vor dieser Bar, da die Bar geschlossen war und lediglich durch eine schmale Luke Getränke nach draußen auf die unzureichend beleuchtete Straße gereicht wurden, wollte eine Frau von ihm wissen, wer er sei. Wörtlich sagte sie: »Was bist du denn für einer?« Ihr Interesse an seiner Existenz freute ihn einerseits, verunsicherte ihn aber gleichzeitig, weil er befürchtete, durch eine Antwort gewisse Verpflichtungen auf sich zu laden, etwa mit ihr ins Gebirge zu fahren und dort auf Felsen herumzuklettern, wozu ihm das passende Schuhwerk fehlte.
Es gab Straßenecken, hinter denen er befürchtete, »neues Terrain« zu betreten und damit zum ersten Mal erfahren zu müssen, dass dieser im Allgemeinen metaphorisch gebrauchte Ausdruck eine Grundlage in der Realität besaß. Statt nun weiterzugehen, wandte er sich um und legte sich Ausreden für seine Umkehr zurecht.
Eine Krähe ging im Licht der Mittagssonne den Dachfirst entlang und warf einen langen Schatten über die Ziegel. Es war ein Bild von Anmut und Erhabenheit. Beides, so dachte er, findet sich allein im Tierreich. Er kam an einer Kapelle vorbei, als die Sonne hinter einer Wolke verschwand. Weil er die Krähe bereits vermisste, stellte er sich vor, wie es wäre, wenn die Tiere die Welt beherrschten und sich Menschen hielten, um ihren Ernährungsbedarf zu stillen. Ihm fiel auf, dass er weniger Angst vor einem Tier hätte, wenn es käme, ihn aus dem Stall zur Schlachtbank zu führen, als vor einem Menschen, der mit seiner Hinrichtung ohnehin jemand anderen beauftragen würde. Der Letzte in dieser Reihe delegierte die Verantwortung schließlich an ein Werkzeug: Henkerbeil, Bolzenschusspistole oder Strick. Die Menschen gaben vor, ihre Werkzeuge von den Göttern erhalten zu haben, demnach handelte es sich bei dem, was sie taten, in ihren Augen letztlich um die Vollstreckung eines Gottesurteils. Auch wenn vereinzelt beobachtet wurde, dass Krähen sich ein angebrochenes Bein mithilfe eines Zweigs und einiger Grashalme selbst schienten, lehnten die Tiere die Nutzung von Werkzeugen allgemein ab und waren stattdessen bereit, die Verantwortung für den Tod, den sie anderen zufügten, selbst zu übernehmen.
Vor einem frisch entkernten, aber noch nicht völlig umgestalteten Wohnblock sprach ihn ein Mann mit einer Gipsmaske an und bot ihm die Möglichkeit, in einem gläsernen Aufzug in das oberste Stockwerk zu fahren und dort zeitgenössische Kunst anzuschauen. Zeitgenössische Kunst interessierte ihn nicht im Geringsten, aber weil er nicht nur vor dem Mann, sondern auch vor sich selbst keinen Grund für diese Abneigung angeben konnte, ließ er sich zusammen mit einem Paar zu dem Aufzug führen. Auf der Fahrt nach oben hörte er, wie der Mann zu seiner Begleiterin sagte, dass die Kunst heutzutage jeglichen Willen zur Innovation verloren und sich als verlängerter Arm der Politik in einer wohlfeilen und pseudokritischen Haltung eingerichtet habe. Nun hatte er eine Einschätzung dessen, was ihn erwartete, und hätte, ohne den Aufzug zu verlassen, unmittelbar wieder nach unten fahren können, aber weil ihn interessierte, was der Mann zu den einzelnen Exponaten sagen würde, ging er in angemessenem Abstand hinter dem Paar her und erfuhr auf diese Weise Genaueres über die Epigonalität der zeitgenössischen Kunst. Der Begriff Kunst schien allerdings nicht mehr gebräuchlich. Stattdessen sprach der Mann von »Eingriffen im Raum« oder auch von »Behauptungen« und bezog sich dabei auf Installationen, die er auf den ersten Blick nicht als solche erkannt hätte, weil sie sich teilweise nur schwer von den an den Rand geräumten Leitern und Farbeimern der sonst hier tätigen Arbeiter unterschieden, was aber, wie er erfuhr, »bewusst gewollt, allerdings ein alter Hut« sei. Tatsächlich konnte er sich nicht mit ganzer Aufmerksamkeit dem Gezeigten widmen, weil ihm der Mann mit der Gipsmaske nicht aus dem Sinn ging. Dessen Maske hatte den Kopf komplett umschlossen, und da er in der Höhe von Mund oder Nase keine Atemschlitze hatte ausmachen können, kam ihm der Gedanke, dass dort vielleicht jemand, getarnt als Werber, aufs Ganze ging und sich in aller Öffentlichkeit und vor aller Augen, ohne aber dass dies von irgendwem bemerkt wurde, aus dem Leben verabschiedete. Vielleicht handelte es sich bei diesem Mann um den Besitzer des leerstehenden Häuserblocks, der sich mit dem Kauf verkalkuliert hatte. Er beschloss, beim Hinausgehen ein paar Worte mit diesem Mann zu wechseln, um vielleicht etwas mehr über dessen Gemütszustand zu erfahren, doch als er den Wohnblock verließ, war der Mann mit der Maske nicht mehr da. Stattdessen stand dort ein Bärtiger in einem Tutu mit einem kleinen Blecheimer, aus dem er eine Handvoll Konfetti nahm und vor ihm in die Luft warf.
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER DEMÜTIGUNG
Ist es nicht eine Demütigung, auch noch nachts im Traum von wildfremden Menschen nach dem Weg zu einem Erlebnisbad gefragt zu werden und die Hälfte des Tiefschlafs damit verbringen zu müssen, die Lage dieses Erlebnisbads, von dem man zwar schon einmal gehört hat, allerdings nur ungefähr weiß, dass es sich am anderen Ende der Stadt befindet, auf Google Maps herauszusuchen, wobei sich die Maßstäbe der Karte beständig verschieben und man plötzlich Alaska als Ausgangspunkt vor sich hat und der Hinweis auf einen Fußweg von mehreren Tausend Stunden zusammen mit der Angabe erscheint, man habe siebzehn Landesgrenzen zu überqueren? Die Glieder sind bleischwer, erwacht man aus einem solchen Traum. Eigentlich war die Frau ganz nett, die nach dem Weg zum Erlebnisbad fragte, und gern hätte man ihr geholfen und noch ein paar weitere Sätze mit ihr gewechselt, anstatt krampfhaft und vergeblich zu versuchen, das Handydisplay auf eine günstigere Größeneinstellung zu bekommen. Und natürlich kam das Beharren auf Alaska, genauer auf dessen Hauptstadt Juneau, was so ähnlich klingt wie »You know«, aus dem Unbewussten, nur worauf genau wollte einen dieses Unbewusste hinweisen?
Die im Traum begonnene Demütigung setzt sich im Aufwachen unmittelbar fort, denn allein, dass man erneut in die dort auf dem Stuhl liegende Hose zu steigen hat, kann einem die Aussicht auf den ganzen Tag verderben, wovon auch die Möglichkeit nicht befreit, doch eine andere Hose aus dem Schrank zu nehmen, denn das würde das Problem lediglich einen Tag hinausschieben. Jeden Tag komplett neue Kleider, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber spätestens nachts kämen doch nur wieder die alten Erlebnisbad-Träume und Hinweise, die gar nicht aus dem Unbewussten stammten oder nur insofern aus ihm stammten, als sämtliche über den Tag gehörten Phrasen von ihm noch einmal mit dem hauchdünnen Schleier einer Trivialsymbolik überzogen und entsprechend verrätselt dargestellt werden.
»Ja«, möchte man schreien, »ja, ich weiß, ich weiß Bescheid. Die Kälte Alaskas ist in unsere Herzen eingekehrt, und nun liegen wir nachts vereinzelt und träumen eine Zusammenstellung von Werbeeinblendungen und steigen morgens gedemütigt in die Hosen vom Vortag und laufen wie am Schnürchen die uns vorausbestimmte Route des Alltags ab!« Stattdessen jedoch – denn wen sollte schon interessieren, was man zu sagen hat, oder gar, was man zu schreien hätte? – bleibt man liegen und geht langsam in Gedanken die Einkaufsliste für den Vormittag durch. Leider gibt es kein Fürst-Pückler-Eis mehr, weil bekannt wurde, dass Fürst Pückler im Jahr 1837 auf einem Sklavenmarkt in Kairo das zwölfjährige äthiopische Mädchen Machbuba, was so viel wie »Geliebte« heißt, kaufte und mit nach Bad Muskau in die Oberlausitz nahm, wo es drei Jahre später verstarb.
DIE KOMPLEXE STRUKTUR GESELLSCHAFTLICHER VERPFLICHTUNGEN
Da sich am Vorabend ein Unfall ereignet haben sollte, warteten die wenigen Besucher zunächst unschlüssig auf der Treppe. Die Diener trugen mit weißen Laken umhüllte Gegenstände durch den Hintereingang hinaus. Jeder versuchte möglichst unauffällig Name und vor allem Funktion seiner Tischnachbarn in Erfahrung zu bringen, schließlich konnte eine unachtsam dahingesagte Bemerkung, ging man von falschen Voraussetzungen aus, für Verwirrung sorgen. Pralinenschachteln und andere Mitbringsel wurden im Flur auf der Kommode abgelegt.
Zwei Männer mit Eimern in den Händen stolperten im Garten durch den Schnee zur brennenden Hütte. Der Schreibtisch des schmalen Büros mit den gestreiften Tapeten schien frisch aufgeräumt. Jemand kam die Wendeltreppe hinauf und ging durch die Seitentür. Die Bilder waren umgehängt oder ersetzt worden, wie man an den nicht nachgedunkelten Rändern erkennen konnte. Ich hatte, meine ich mich zu erinnern, leichtes Fieber.
Rauchwaren wurden angeboten. Es war diese Art von leichtem Fieber, bei der man nicht weiß, ob die Hitze von außen kommt oder aus einem selbst und ob dieses pausenlos wiederholte »Ein Männlein steht im Walde« tatsächlich irgendwo gesungen wird oder nur im eigenen Kopf erklingt. Steht wirklich einer der Gäste vom Essen auf, um einen Vortrag über unterschiedliche Formen von Ohrmuscheln und deren Beziehung zur Konstitution ihrer Träger zu halten oder greift er lediglich nach der Sauciere?
Jemand stieg nachts zur verabredeten Stunde über den Zaun. Der Zug fuhr in Richtung Hauptstadt. Drei Frauen in langen Mänteln gingen in der Abenddämmerung hinter einem Mann die Straße entlang.
Man sparte die Dessertlöffel ein, trug eigenes Haar statt Perücken, baute lustige Einfälle in die Spielhandlung ein, war nicht länger konsterniert, sondern erschüttert, nicht länger affiziert, sondern angetan.
Dr. Fahler, der früher gern Diagnostisches zum Besten gegeben hatte, hielt sich zurück, als habe es ihm aus irgendeinem Grund die Sprache verschlagen. Nur war ein Grund nicht ersichtlich. Schließlich sprach er mit ausdruckslosem Gesicht einige Sätze und lächelte auf eine Art, für die sich noch kein Adjektiv gefunden hat und die man vielleicht mangels eines passenden Begriffs süffisant nennen würde, obwohl sie das nicht war. Gerade das nicht. Hatte man ihn mit dem Satz »Damit könnten Sie Ehre einlegen, mein Bester« ermuntert? Vermutlich.
Kaum einer der Anwesenden konnte seinen Ausführungen folgen, da alle überlegten, ob er sich nur versprochen hatte oder es tatsächlich nicht besser wusste. Davon ausgehend spekulierte man über seine Karriere in der Verwaltung. Unmerklich veränderte sich innerhalb weniger Minuten das Bild, das man bislang allgemein von ihm gehabt hatte.
Bis zuletzt soll er unbeirrt gewesen sein, hieß es später. Seine Frau, vielleicht aber auch seine Geliebte, da war man sich uneinig, hatte zuvor etwas über seine sexuellen Neigungen durchblicken lassen. Die Straßenbahnen fielen wegen eines Schadens aus. Ein ramponierter Drachen hatte sich in der Oberleitung verfangen.
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER KLEINFAMILIE
Olga und ich hatten uns im letzten Herbst einige zur Miete angebotene Einfamilienhäuser an der Peripherie angesehen. Bedauerlicherweise hatte jedes der vier Angebote einen Mangel. Das eine Häuschen befand sich an einer sehr lauten Straßenkreuzung, das andere lag eingezwängt zwischen einer Autowerkstatt und einem weiteren Betrieb, bei dem man nicht erkennen konnte, was genau dort vorging. Beim dritten Objekt wurde neben einer wirklich unverschämt hohen Miete zusätzlich verlangt, dass wir die defekte Heizung auf eigene Kosten zu reparieren hätten, und beim vierten, bei dem Miete und Lage stimmten, war Olga sich sicher, dass es sich um das Haus handelte, in dem sich vor zwei Jahren »diese Familientragödie abgespielt« habe, die damals »durch alle Medien gegangen« sei. Sie meinte in dem Mann, der uns durch die Zimmer führte, sogar denjenigen wiederzuerkennen, der seinen Geschäftspartner im Partykeller erschlagen und die Leiche unter dem Estrich einbetoniert hatte, weshalb Olga sich weigerte, den Keller anzuschauen und mir entsprechende Zeichen machte, die ich jedoch nicht zu deuten verstand, weshalb ich nichts ahnend mit ihm hinabstieg. Tatsächlich gab es dort einen neuen Estrich, auf den mich der Mann sogar eigens hinwies. Als Grund gab er jedoch den undichten Tank der alten Ölheizung an, die mittlerweile durch eine moderne Gasheizung ersetzt worden war.
»Ich denke, es war eine Familientragödie«, sagte ich zu Olga, als wir wieder im Auto saßen.
»War es doch auch«, sagte sie.
»Aber er hat doch nur seinen Geschäftspartner erschlagen, hast du gerade gesagt.« Es klang natürlich komisch, im Zusammenhang mit der Ermordung eines Menschen »nur« zu sagen, aber ich wollte die Sache etwas herunterspielen, denn mir gefiel das Haus.
»Er hat dann noch die Frau seines Geschäftspartners umgebracht, als sie kam und nach ihrem Mann fragte.«
»Ja, das ist furchtbar, aber dennoch nicht das, was man unter einem Familiendrama versteht.«
»Anschließend hat er dann noch seine eigene Frau umgebracht, als sie ihm auf die Schliche kam.«
»Ah ja. Verstehe. Dennoch. Irgendwie hat für mich ein Familiendrama immer auch mit Kindern zu tun.«
»Die beiden Kinder hat er versucht mit Gas zu vergiften, das ist ihm aber zum Glück nicht mehr gelungen.«
»Verstehe.« Ich musste mich geschlagen geben und hatte, ehrlich gesagt, auch keine große Lust mehr, in dieses Haus einzuziehen.
Während der Heimfahrt überlegte ich, ob der Mann für jede Leiche den alten Estrich aufgeschlagen und anschließend einen neuen Estrich gegossen hatte oder ob sich das mit dem Estrich nur auf die erste Leiche bezog. Anschließend überlegte ich, ob die mir als neu vorgeführte Gasheizung etwas mit der versuchten Ermordung der Kinder zu tun haben könnte, entschied mich aber dagegen, da es bei den geltenden Sicherheitsverordnungen für Gasheizungen kaum möglich sein dürfte, einfach Gas ausströmen zu lassen. Außerdem benutzt man für entsprechende Vergiftungsversuche eher einen Backofen.
Ich bemühte mich, die mittlerweile auch in mir aufsteigenden Zweifel mithilfe einer gewissen Logik zu entkräften, indem ich mir sagte, dass gerade in einem Haus, in dem sich eine solche Familientragödie abgespielt hatte, unter Garantie alles komplett neu gemacht worden war und sich mit Sicherheit keine Leichen mehr irgendwo befanden, was man von anderen Häusern nicht so ohne Weiteres sagen konnte. Was Leichen oder Familientragödien angeht, reichen allerdings bereits entsprechende Vorstellungen aus, um einem das Leben dort zu vergällen.
Im Nachhinein, und auch weil das Verhältnis zwischen Olga und mir sich nicht verbesserte, entwickelte ich ein etwas sentimentales Gefühl diesen vier Häusern gegenüber, die wir uns gemeinsam und damals noch mit dem festen Vorsatz, eine Familie zu gründen, angesehen hatten. Hätten wir nicht vielleicht auch an der belebten Kreuzung glücklich werden können? Oder zwischen den beiden Werkstätten? Wovon überhaupt war Glück abhängig?
Ich muss gestehen, dass ich noch einige Male, meist freitags gegen Abend, zur Peripherie hinausgefahren bin, mein Auto in einer Seitenstraße abgestellt habe, um in Richtung eines der Häuser zu gehen, so als käme ich gerade von der Arbeit zurück. Einfach, um die verpassten Möglichkeiten zu erspüren oder vielmehr zu erspüren, ob es überhaupt entsprechende Möglichkeiten für uns hätte geben können. Aus dem zwischen den Werkstätten eingeklemmten Häuschen meinte ich ein Kinderlachen zu hören, aber es war dann doch nur das Geräusch einer Schleifmaschine, mit der wahrscheinlich nach Feierabend ein Kotflügel in Form gebracht wurde.
An einem dieser Abende hörte ich auf der Rückfahrt im Radio einen Beitrag über Kafka, in dem es hieß, dass er seine »unglückliche Beziehung zu Felice« in der Erzählung Das Urteil bearbeitet habe, was mich erstaunte, da ich in diesem mir einigermaßen vertrauten Text zwar verschiedene Ebenen hatte ausmachen können, nicht aber die der gescheiterten Beziehung.
Unwillkürlich dachte ich, dass ich meine unglückliche Beziehung zu Olga auch gern in einer Erzählung bearbeiten würde, die augenscheinlich erst einmal gar nichts mit Olga und mir zu tun hätte, dann aber erinnerte ich mich, dass ich ein anderes Vorhaben hatte, das ich nicht aus den Augen verlieren durfte, nämlich den gesellschaftlichen Stillstand zu beobachten.
Man kann sich nicht immer aussuchen, womit man sich beschäftigt, selbst dann nicht, wenn man durch seine Erwerbstätigkeit relativ unabhängig ist und sich seine Betätigungen nach Feierabend eigentlich aussuchen können müsste. Ich sage das, weil ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war lange Jahre Ingenieuranwärter und hatte eine recht schöne Laufbahn in einer unkündbaren Stellung in Aussicht, als ich mich in letzter Minute doch gegen die Karriere entschied und mich mit einer untergeordneten Position begnügte. Auf die genaueren Gründe werde ich, wenn es sich ergibt, später noch zu sprechen kommen.
Während meine Arbeiten, zugegeben die eines Freizeit-Autors, sie nie wirklich hatten begeistern können, war Olga eine große Verehrerin des Schriftstellers Yurivenko. Dafür gab es mehrere Gründe, die allesamt verständlich sind. Nicht zuletzt den, dass sie in meinen Texten an manchen Stellen, die sie für unpassend hielt, erwähnt, mehr noch, dass sie an anderen Stellen, die sie für passend gehalten hätte, nicht erwähnt wurde. Das ist, wie gesagt, nachzuvollziehen, denn ich würde auch nicht gern irgendwo etwas über mich lesen. Noch nicht einmal, wenn ich es selbst geschrieben hätte. Dann sogar am allerwenigsten.
Zu einer Zeit, als wir kaum noch miteinander sprachen und ich der Meinung war, wir seien nun endgültig getrennt, rief Olga mich manchmal an, um mir vom neusten Werk Yurivenkos vorzuschwärmen, in dem sie gerade jeden Abend vor dem Zubettgehen lese. Ich tat weiterhin so, als hätte ich noch nie eine Zeile von Yurivenko gelesen. Tatsächlich kenne ich jedes Wort von ihm, nicht zuletzt, weil ich herausfinden hatte wollen, was Olga so sehr an ihm faszinierte, und natürlich auch, um zu sehen, ob ich nicht auf ähnliche Weise schreiben würde können, damit Olga für meine Texte eine entsprechende Begeisterung entwickeln und sich im Weiteren vielleicht an die Begeisterung erinnern würde, die sie einmal, zumindest ansatzweise für mich gehabt hatte.
Nicht nur der Stil Yurivenkos war bewundernswert, auch thematisch griff er regelmäßig aktuelle politische Themen auf, die er auf unnachahmliche Weise behandelte. Im Gegensatz zu meinen Texten gab es bei ihm außerdem viele Schilderungen sexueller Handlungen.
Es lag aber nicht allein an Olga, dass ich das Vertrauen in meine Arbeit verloren hatte. Schon immer wurde ich in regelmäßigen Abständen von einer Unruhe heimgesucht, die eine Reihe ganz grundsätzlicher Zweifel mit sich brachte, durch die mir mein Tun und auch mein Leben in seiner Willkür und Zufälligkeit absurd und unerträglich erschienen. Diese Zweifel hatten sich in letzter Zeit noch einmal verstärkt.
Hörte ich das Klappern und Schlagen der Mülltonnen im Hof, fielen mir unmittelbar alle Unwägbarkeiten des Lebens ein, und ich wurde so unruhig, dass ich einen ersten Schnaps trinken musste, und das, obwohl es erst sieben Uhr früh war, denn ich habe die Angewohnheit, nicht nur abends, sondern auch nach dem Aufstehen und vor der Arbeit zu schreiben.
Manchmal nehme ich statt Alkohol auch eine Tablette. Manchmal nehme ich eine Tablette und spüle sie mit einem Schnaps hinunter, obwohl genau davor gewarnt wird. Eigenartigerweise habe ich vor den Auswirkungen einer unsachgemäßen Einnahme keine Angst. Überhaupt scheint nichts von dem mir Angst zu machen, was andere Menschen ängstigt, während mich vieles ängstigt, was andere kalt lässt.
Ich kenne natürlich nicht einmal einen Bruchteil von diesen »anderen Menschen«, die ich mir lediglich vorstelle, weshalb ich mich bestimmt irre und es bestimmt Menschen gibt, die ähnliche Ängste und ähnliche Gleichgültigkeiten aufweisen. Und wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Menge anderer Menschen, die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, von denen ich nicht das Geringste weiß.
Der Schriftsteller Yurivenko etwa wird als »unnachahmlicher Chronist zeitgenössischer Ängste« bezeichnet. Und auch Olga meinte erst letztens am Telefon, dass Yurivenko Szenen mit einer solchen Eindringlichkeit zu schildern verstehe, dass ihr manchmal buchstäblich der Atem stocke. Obwohl es natürlich nicht ganz fair ist, musste ich unwillkürlich daran denken, wie sie reagiert hatte, als mir einmal während einer gemeinsamen Zugfahrt, quasi aus heiterem Himmel und ohne dass ich eine Ursache dafür hätte erkennen können, tatsächlich der Atem für einen Moment gestockt war.
Wenn ich ehrlich bin, kann ich ihr, was das angeht, eigentlich keinen Vorwurf machen, da sie sich unmittelbar zu mir wandte und ihre Hand auf meine Brust legte. Einen anderen hätte diese Geste bestimmt beruhigt. Auch mich hätte diese Geste normalerweise beruhigt, wäre durch sie nicht eine Art zweiter Krise in mir ausgelöst worden. Es war eine Form von Vertrauenskrise, deren Grund ich versuchen will, etwas näher zu beleuchten.
Mein Vater hatte vier Geschwister und meine Mutter sogar fünf. Eigentlich sogar sechs, wenn man die frühverstorbene Sascha mitzählte. Weil das Aufwachsen in einer großen Familie eine, wie ich annehme, angenehme Erfahrung war, beschlossen meine Eltern, es ihren Eltern gleichzutun und wie diese »einen ganzen Stall von Kindern« zu bekommen. Ich komme auf diesen Ausdruck, weil er auf mehreren Hochzeitskarten zu finden ist, auf denen nahe Freunde meinen Eltern genau das wünschten.
Für mich hat der Ausdruck »Stall« etwas unangenehm Bedrohliches. Eingesperrt und mit anderen Leidensgenossen zusammengepfercht, ohne große Bewegungsfreiheit, wird man aufgezogen. Wie soll man in einem Stall eine Zukunftsvision entwickeln, außer derjenigen, dasselbe zu wiederholen und ebenfalls »einen ganzen Stall von Kindern« in die Welt zu setzen?
Tatsächlich kann ich nur vermuten, wie es ist, gemeinsam mit mehreren Kindern aufzuwachsen, denn meinen Eltern gelang es lediglich, mich auf die Welt zu setzen. Nicht, dass sie nicht mit aller Kraft versucht hätten, eine Großfamilie zu gründen. Meine Mutter hatte, wie ich später erfuhr, sage und schreibe sieben Fehlgeburten, fünf vor mir und zwei weitere nach mir, obwohl sie da schon weit in den Vierzigern war.
Die meisten dieser Fehlgeburten starben schon in den ersten Monaten, zwei allerdings, genauer gesagt drei, denn bei der einen Schwangerschaft handelte es sich um ein Zwillingspaar, waren beinahe völlig ausgebildet, bevor dann doch noch eine lebenswichtige Funktion ausfiel oder sich das Kind im Bauch meiner Mutter falsch drehte oder gar nicht drehte, was genauso schlecht ist.
Ich meine mich zu erinnern, dass dieser Vorgang des Drehens zwischen meinen Tanten und meiner Mutter des Öfteren zu vorgerückter Stunde bei Familienfesten besprochen wurde und ich mir, selbst ja noch ein Kind, die Kinder im Bauch wie Planeten vorstellte, die sich in ständiger Bewegung befinden. Dieses Bild fiel mir ein, weil ich damals gerade anfing, mich für Astronomie und Raumfahrt zu interessieren.
Ich wuchs also allein in einem viel zu groß angelegten Stall auf. Obwohl ich regelmäßig an dieses Wort »Stall« denken musste, kam mir mein Lebensumfeld groß, leer und weitläufig vor, ähnlich wie ich mir das All vorstellte.
Man könnte nun meinen, dass meine Eltern ein besonderes Augenmerk auf mich gerichtet und mich mit Nachsicht behandelt, wenn nicht sogar verzärtelt hätten, aber genau das Gegenteil war der Fall. Ohne zu wissen, weshalb, hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass meine Eltern im Umgang mit mir immer etwas über mich hinweg oder an mir vorbei sahen und sprachen, und im Nachhinein meine ich mich sogar an Situationen erinnern zu können, in denen meine Mutter mit von Rührung umflortem Blick in meine Richtung schaute, nur um ihre Pupillen in dem Moment erstarren zu lassen, in dem ich genauer in ihr Blickfeld rückte, so als trüge ich als einziger Überlebender ihres »Stalls« eine besondere Schuld. Wahrscheinlich konnte ich mit meiner konkreten Anwesenheit nicht die Ansprüche erfüllen, die meine Eltern in meinen acht unsichtbaren Geschwistern täglich aufs Neue als erfüllt entdeckten.
Zuwendung ist demnach für mich eine Form des besonderen Vertrauensvorschusses, dessen ich mich jedoch unmöglich würdig erweisen würde können, weshalb mich eine Beachtung, so wie Olgas Hand auf meiner Brust, verunsichert, auch wenn ich sie gleichzeitig herbeisehne. Dafür aber andere, insbesondere Olga, verantwortlich zu machen, wäre ungerecht.
Selbst wenn ich mittlerweile kein Auto mehr habe, könnte ich mit dem Zug und dem Bus an die Peripherie zu dem vierten Haus fahren und mich im Abenddämmer vor das Garagentor stellen und eine Zigarette rauchen. Wann hatte ich zum letzten Mal eine Zigarette geraucht? Wie hieß das Ehepaar, das das Haus seinerzeit zum Verkauf angeboten hatte? Natürlich wohnte längst eine Familie darin, eine Familie mit kleinen Kindern. Der Familienvater würde herauskommen, um zu sehen, was der fremde Mann vor dem Garagentor auf der Auffahrt macht, und dieser fremde Mann würde ihm daraufhin erklären, dass er einmal hier gewohnt habe, mit seiner Frau und seinen Kindern, und es die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen sei. Und wenn der fremde Mann das sagte, vielleicht weil es keine eigenen Sätze waren, die er sagte, nicht einmal Klischees, sondern lediglich gesellschaftliche Vereinbarungen wie die Formeln, die man früher auf Ansichtskarten geschrieben hatte, könnten beide das, was er sagte, in diesem Moment glauben. Kinder, würde der fremde Mann denken, nachdem er sich von dem Hausbesitzer verabschiedet hatte und langsam die schwach beleuchtete Siedlungsstraße hinunterging, Kinder sind ohnehin immer etwas Imaginäres. Und dann würde er seine rechte Hand unauffällig ein Stück zur Seite strecken und sich vorstellen, daran ein Kind zu führen, einen vierjährigen Jungen mit einem etwas zu großen Halfter um die Hüfte, in dem eine giftgrüne Laserpistole steckte, mit der er alle Gefahren abwehren und alle Feinde besiegen konnte, ein Junge, der Olgas graublaue Augen hatte und seine schwarzen Haare, von denen ihm gerade ein paar Strähnen auf der verschwitzten Stirn klebten.
DIE KOMPLEXE STRUKTUR DER UNIVERSALGESCHICHTE
Jeder Universalgeschichte muss ein natürlicher Widerspruch zugrunde liegen. Dieser Widerspruch symbolisiert sich zum Beispiel in einem Heiligen, der vom Teufel heimgesucht und verführt wird. Zwei gegensätzliche Kräfte kämpfen miteinander, und aus diesem Kampf entsteht, auf diesem Widerstreit fußt die Universalgeschichte.
Dabei sind wir unmittelbar mit dem Problem der Heimsuchung und Verführung konfrontiert, denn soll besagte Verführung auch nur ansatzweise glücken, so braucht der Heilige ein Bewusstsein des Bösen, der Teufel wiederum ein Bewusstsein des Heiligen.
Was aber ist das Heilige? Was das Böse ist, meinen wir zu wissen, denn wir erkennen die Vertreter des Bösen an der Verschlagenheit, mit der sie vorgeben, etwas anderes zu sein, als sie sind. Die Vertreter des Heiligen aber werden nicht selten mit Narren verwechselt. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Narren, auch wenn sie sich äußerlich und in ihrem Verhalten zu ähneln scheinen: Der Heilige lebt in einer Welt der Jenseitigkeit, weshalb er sich im Diesseits nicht mehr richtig zurechtfindet. Der Narr hingegen findet sich im Diesseits nicht richtig zurecht, weshalb er sich in eine Form der Jenseitigkeit flüchtet.
Um eine Universalgeschichte zu entwerfen, dürfen folgende vier Grundprinzipien nie außer Acht gelassen werden: Es gibt zum einen das, was schöpft, ohne selbst geschaffen zu sein, zum anderen das, was geschaffen ist, ohne zu schöpfen. Drittens gibt es das, was sowohl geschaffen ist als auch schafft, und schließlich und letztlich das, was weder geschaffen ist noch selbst schafft.
So weit die abstrakten Voraussetzungen. Würden wir bei ihnen verharren, um sie genauer zu untersuchen und zu betrachten, begingen wir einen nicht wiedergutzumachenden Fehler, einen Fehler, den schon andere vor uns begangen haben, die diese erste Klippe nicht nahmen, sondern, verfangen in metaphysischen Spekulationen, verstummten. Sie übersahen, dass das Abstrakte für uns nur zu erkennen ist, nachdem wir das Konkrete von ihm abgezogen haben. Nur so können wir es wenigstens ansatzweise begreifen, wenn auch nicht annehmen. Folglich haben wir uns zunächst dem Konkreten zuzuwenden.
Das Konkrete besteht aus Streit und Zank, die ursprünglich aus dem Nachfolgestreit der Adelsgeschlechter entstanden. Dieser ewige Kreislauf wurde so lange verschwiegen, bis er nicht mehr zu beschreiben war. An die Stelle einer Beschreibung trat in der Theorie die Genealogie, in der Praxis hingegen das Schmieden von Ränken. Beide leiteten ihre Legitimation von dem ab, was schöpft, ohne selbst geschaffen zu sein, ohne dafür einen Nachweis erbringen zu können. Man merkte ihren Aufzählungen jedoch an, dass sie mühselig zusammengeflickt waren, und auch ihr Ränkespiel war oft ungelenk.
Aus diesem Grund beginnen wir mit folgender paradoxaler Setzung, deren Sinn sich jedoch unmittelbar erschließen wird: »Der erste Herrscher war Basileus, der nach dem Tod seines Onkels den Thron bestieg.« Wir nehmen die Paradoxie bewusst in Kauf und nennen Basileus den ersten Herrscher, obwohl er keineswegs am Anfang einer Genealogie steht, vielmehr die Herrschaft von seinem Onkel übernommen hat. Ging dieser Übernahme eine Gewalttat voraus? Dankte der Onkel vorzeitig ab, regelte davor aber noch die eigene Nachfolge oder starb er, ohne entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben? Das sind Fragen, die sich zwangsläufig einstellen, jedoch an dieser Stelle nicht beantwortet werden können, da ansonsten der von uns angewandte paradoxale Kniff ins Leere laufen würde und damit völlig umsonst angewandt und verschwendet worden wäre.
Wir behalten folglich die vier abstrakten Möglichkeiten des Schöpfenden und Geschaffenen im Hinterkopf und wiederholen: »Der erste Herrscher – und damit ist nicht irgendein Herrscher von irgendeinem Land gemeint, sondern der Erste, der überhaupt auf die Idee kam zu herrschen – war Basileus, der nach dem Tod seines Onkels den Thron bestieg.«
Geschichtskenntnisse und weitere Spitzfindigkeiten führen an dieser Stelle nicht weiter, denn wir sind bei unserer Unternehmung, eine Universalgeschichte zu verfassen, ganz allein auf uns gestellt. Es ist ein Dilemma, das wir konfrontieren müssen, und dieses Dilemma wird nicht dadurch aus der Welt geschafft, dass wir es auf einen überschaubaren Zwist verlagern, etwa indem wir dem Basileus einen Zwillingsbruder, genannt Tyrannos, an die Seite geben. »Lasst uns«, wiederholen wir, »beim gesalbten Haupt des Basileus verharren.«
»Euer Verharren ist ein Beharren«, wird uns vorgeworfen. »Das mag sein«, räumen wir ein. »Alles, solange es nur kein Ausharren ist.«
Eine Frage sei allerdings erlaubt und hier kurz adressiert: »Kann es sein, dass es sich mit besagter Schöpfung ganz anders verhält als bislang angenommen und es gar nicht darum geht, was oder wer wen oder was schöpfte oder von wem oder was geschöpft wurde, vielmehr von Bedeutung ist, wie besagter Schöpfungsakt vor sich ging?« Anlass für diese Frage ist die allgemein übliche Unterteilung in Gut und Böse.
Gehen wir davon aus, dass das Urprinzip, das also, was schöpft, ohne selbst geschaffen zu sein, das Gute erschaffen will, so muss ihm nahezu zwangsläufig das Böse unterlaufen. Das Böse wird nicht bewusst geschaffen, sondern entsteht durch die Unaufmerksamkeit des Schöpfers, der seine Kraft überschätzt und die Schwerkraft unterschätzt. Denn das Böse fällt nach unten, während das Gute nach oben steigt, da es keiner Kraft bedarf, etwas fallen zu lassen, hingegen ein großer Aufwand, die sogenannte Schöpfungsenergie, vonnöten ist, etwas emporzuheben. Und da dieser fallende Schöpfungsakt nicht beabsichtig ist, vielmehr unterläuft, gibt es eine besondere Verbindung des Bösen zum Zufall.
Der Zufall ist derart mächtig, dass er sogar das Gute konfrontieren und zwingen kann, ihm etwas entgegenzusetzen. Das, was das Gute dem Zufall mit Mühe entgegensetzt, ist die Vorsehung, die jedoch bei Weitem nicht so zwingend ist wie der Zufall, denn die Vorsehung kann beliebig für alles Mögliche und damit auch gegen die eigene und ursprüngliche Absicht verwendet werden, während der Zufall gemeinsam mit dem Bösen lediglich der Schwerkraft folgend nach unten sinkt und dieses Unten deshalb nicht selten, allein weil es der Schwerkraft Einhalt zu gebieten scheint, als Ziel- und Endpunkt angesehen wird. Fälschlicherweise.
Der Himmel als Symbol des Guten entstand als Gegenentwurf zu dem Ort, an dem sich das Böse zwangsläufig einfindet, indem es sich der Schwerkraft und dem Zufall überlässt, und es half nichts, nach Schaffung des Guten als Gegenentwurf zum Bösen das Böse unter den tatsächlichen Ort des Bösen zu verlagern, da sich in dieser Verlagerung lediglich die Unsicherheit dem eigenen Entwurf gegenüber manifestiert, der durch die tatsächliche überirdische Anwesenheit des Bösen beständig infrage gestellt wird.
Stattdessen hätten wir daran arbeiten müssen, dem Guten eine Möglichkeit zu verschaffen, sich, ähnlich dem Bösen, ebenfalls einer physikalischen Wirkkraft hingeben zu können, sich quasi im Gutsein zu entspannen, anstatt mit aller Kraft und nicht selten auch mit aller Gewalt dem Guten einen künstlichen Ort zu errichten, der dem Bösen zwangsläufig hinterherhinkt, da das dem Guten mit Mühen Errichtete sich von dem wie selbstverständlich und ohne Anstrengung erreichten Ort des Bösen ableitet.
Natürlich gab man sich Mühe und versuchte, auch für das Gute physikalische Gesetze in Dienst zu nehmen, indem man die Vorstellung der Seele als Ballon entwickelte, der, einmal von dem der Schwerkraft unterworfenen Körper befreit, unmittelbar nach oben steigt. Doch lieferte dieses Bild keinen wirklich überzeugenden Gegenentwurf, da sich ein Ballon leicht in Baumkronen verfängt und von einem Windstoß so lange quer über den Erdball getrieben werden kann, bis er zappelnd am Eisentor eines Waisenhauses verendet, damit zwar Gutes tut, weil sich die armen Kinder seiner für kurze Zeit erfreuen dürfen, jedoch spätestens dann jeden Rest von Zwangsläufigkeit eingebüßt hat.
Allerdings ist es immer problematisch, eine neue Variable in eine bereits bestehende Formel einzuführen, in diesem Fall die Formel: Das Böse ist deshalb so mächtig, weil es unterstützt vom Zufall der Schwerkraft folgt.
Da wir nun wissen, wie das Böse in die Welt kam und warum sich das Gute dem Bösen gegenüber in einer unterlegenen Position befindet, obwohl das Böse doch ihm entstammt, müssen wir noch einmal zurück auf die politische Bühne. Hier zeigt sich die Synthese aus Narrheit und Verschlagenheit, die es unmittelbar zu überwinden gilt.
Dem Begreifen aber geht das Greifen voraus, und greifen können wir allein, was Gestalt und Form hat, weshalb manche auch sagen, dass nicht das Abstrakte und auch nicht der erste Herrscher in Person des Basileus als Thronfolger am Anfang stand, sondern die Fähigkeit der Wesen, ihre Gestalt zu verändern, die, ähnlich der Erschaffung des Bösen, dem Zufall zu verdanken ist, wenn auch einer anderen Form des Zufalls, ähnlich dem, der eine Welle entstehen lässt, sobald sich ein hinreichend großer Fisch im Meer zur Seite neigt.
Am Anfang der Schöpfung, um es zusammenzufassen, stehen folglich nicht Mord und Totschlag, sondern Schwerkraft und Verdrängung, denn der Fisch, der sich zur Seite neigt, verdrängt absichtslos das Wasser, das sich in Wellen fortbewegt und in dieser Fortbewegung seine Gestalt ändert. Es ist die Fähigkeit zur Bewegung, die den Gestaltwechsel ermöglicht, und es ist der Impuls, sich zu bewegen, der ihn bedingt. Somit lässt sich die Thronbesteigung des Basileius als Wechsel der Gestalt verstehen.
Ehe man unterstellt, wir würden uns lediglich in Andeutungen ergehen, ohne Konkretes zu benennen, sei kurz auf die pornographischen Bilder hingewiesen, die sich bei der Rede über Gestaltwechsel und Fortbewegung unwillkürlich vor unserem inneren Auge einstellen.
Unruhe drängt stärker zur Ruhe als Ruhe zur Unruhe. Wie aber kommt die Unruhe in die Welt? Und ist sie es, die mit dem Bösen gleichzusetzen ist? Genau dies zu zeigen, ist Aufgabe einer Universalgeschichte.