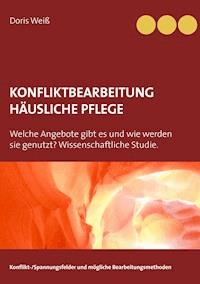
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Viele Pflege- oder Betreuungsbedürftige wünschen sich, in ihrem gewohnten Umfeld bleiben zu können. Durch die physischen und psychischen Belastungen von allen an einem solchen Pflegeprozess Beteiligten, kommt es dabei häufig zu Konflikten, die nicht immer leicht zu lösen und zu regeln sind. Um Betroffenen zu helfen, beleuchtet dieses Buch die häufigsten Konflikt- und Spannungsfelder und stellt die effektivsten Konfliktbearbeitungsmethoden vor, - als Prävention, für den Akutfall und/oder im Nachhinein. Untermauert werden die Erkenntnisse durch einen empirischen Teil. Dieser enthält Informationen aus erster Hand in Form von Interviews mit erfahrenen Konfliktbearbeitungsexperten und eine Befragung von Mitarbeitern der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste. Die Auswertung dieser gewährt Einblicke in die Konfliktpotenziale und zeigt deutlich den bestehenden, großen Bedarf an externer Konfliktbearbeitung. Das Buch darf als Ratgeber für Hilfesuchende verstanden werden. Mag. Doris Weiß Mediatorin, Systemischer Coach Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin Kontakt: www.win3loesungen.at
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin:
Mag. Doris Weiß
ist Mediatorin, Systemischer Coach, Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und hat langjährige Erfahrungen im Human Resources Management (HRM)
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Coaching | Mediation | Prävention unter anderem bei:
Stress/Burnout
Loslassen, Verlust und Trauer
Konfliktbearbeitung im Privatbereich und in Unternehmen
Neubeginn- oder Umgestaltungsphasen
Persönlichkeitsentwicklung
Changemanagement oder Umstrukturierungsmaßnahmen
Die Selbsterfahrung der unterschiedlichen Herausforderungen und Belastungen während der häuslichen Pflege ihres geliebten krebskranken Vaters bis zu seinem Tod im Jahr 2010 motivierte sie, sich diesem wichtigen Thema der Konfliktbearbeitung in der häuslichen Pflege als Diplomarbeit zu widmen.
Kontakt: www.win3loesungen.at
INHALT
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1. Problemstellung
1.2. Ziel und Zweck der Arbeit
1.3. Hypothese
1.4. Aufbau der Arbeit
2. BEGRIFFLICHKEITEN
1.1 Pflege/häusliche Pflege
2.1. Konflikt/Spannungsfeld/Überforderung/Prob-lem
2.2. Konfliktbearbeitung/Konfliktlösung/Konflikt-regelung
2.3. Bedarf/Bedürfnis
3. ZUR SITUATION DER HÄUSLICHEN PFLEGE IN ÖSTERREICH
3.1. Allgemeines zu Pflege:
3.1.1. Pflegebedürftigkeit
3.1.2. Pflegegeld und Pflegestufen
3.2. Betreuung/Versorgung von Pflegebedürftigen in Österreich
3.2.1. Stationäre Betreuung und Pflege
3.2.2. Teilstationäre Betreuung und Pflege
3.2.3. Extramurale Betreuung und Pflege
3.3. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige
3.3.1. Zeitliche Unterstützung – arbeitsrechtliche Möglichkeiten
3.3.2. Finanzielle Unterstützung
4. KONFLIKTE UND SPANNUNGSFELDER IM PFLEGEBEREICH
4.1. Intrapersonaler Bereich
4.1.1. Pflegebedürftige/Pflegende
4.1.2. Loslassen/Abschied nehmen
4.1.3. Überforderung/fehlende Selbstachtung
4.1.4. Pflichtgefühl/Schuldgefühl
4.2. Innerhalb der Familie/des sozialen Umfelds
4.2.1. Pflichten/Aufgabenverteilung der Familienangehörigen
4.2.2. Soziale Verantwortung – Pflege als Frauensache
4.2.3. Rollenkonflikt
4.2.4. Fremd-/Heimunterbringung
4.2.5. Anspruch auf Erbe/finanzielle Belastung
4.2.6. Latente Konflikte aus der Vergangenheit
4.2.7. Persönlichkeitsveränderung
4.2.8. Täter/Opfer – Konflikt als Misshandlung, Aggression oder Gewalt
4.2.9. Ausgleich von Geben und Nehmen
4.3. Interdisziplinäre Zusammenarbeit
4.3.1. Pflegende/Pflegebedürftige – Medizinbereich
4.3.2. Mobile Pflege/24-Stunden-Betreuung
4.3.3. Zusammenarbeit der Professionisten
4.3.4. Unterschiedliche Ansichten über die Befähigung und Tätigkeit von 24-Stunden-Betreuern:
5. METHODEN ZUR KONFLIKTBEARBEITUNG
5.1. Präventive Maßnahmen
5.1.1. Schulungen/Kompetenzaneignung
5.1.1.1. Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation
5.1.1.2. Gewaltfreie Kommunikation – GFK
5.1.1.3. Türöffner und Killerphrasen
5.1.2. Sozialer Hilfsdienst/MiA-Begleiter:
5.1.3. Das Angehörigengespräch
5.1.4. Entlassungsmanagement/Übergangspflege/ Case-Manager
5.1.5. Anlaufstellen/Informationsplattformen
5.2. Im Akutfall
5.2.1. Mediation
5.2.1.1. Mediationsprozess
5.2.1.2. Aufgaben des Mediators
5.2.1.3. Vorteile/Nutzen und Auswirkungen
5.2.2. Systemisches Coaching/Aufstellungsarbeit
5.2.2.1. Ablauf/Prozess der Aufstellungsarbeit
5.2.2.2. Aufgabe Systemischer Begleiter/Therapeut/Berater
5.2.2.3. Vorteile/Nutzen und Auswirkungen
5.2.3. Weitere Angebote zur Konfliktbearbeitung
5.3. Im Nachgang
6. EMPIRIE
6.1. Rechtfertigung der Forschungsmethode
6.2. Fragebogen
6.2.1. Zielgruppe und Beschreibung der Stichprobe
6.2.2. Durchführung der Befragung
6.2.3. Auswertung
6.2.3.1. Frage 1:
6.2.3.2. Frage 2:
6.2.3.3. Frage 3:
6.2.3.4. Frage 4:
6.2.3.5. Frage 5:
6.2.3.6. Frage 6:
6.2.3.7. Frage 7:
6.2.3.8. Frage 8:
6.2.3.9. Frage 9:
6.2.4. Zusammenfassung der Ergebnisse
6.3. Experteninterviews
6.3.1. Zielgruppe
6.3.2. Durchführung
6.3.3. Auswertung
6.3.3.1. Tabellarische Darstellung der Ergebnisse
6.3.3.2. Detailanalyse der Interviewfragen
6.3.3.2.1. Frage 1
6.3.3.2.2. Frage 2
6.3.3.2.3. Frage 3
6.3.3.2.4. Frage 4
6.3.3.2.5. Frage 5
6.3.3.2.6. Frage 5a:
6.3.3.2.1. Frage 6
6.3.3.2.2. Frage 7
6.3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse
7. FAZIT
7.1. Zusammenfassung/Schlussfolgerungen
7.2. Maßnahmen/Empfehlungen
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS:
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
Die in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommenden Herausforderungen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege finden bereits seit geraumer Zeit Platz in den Medien und öffentlichen Diskussionen. Der medizinischtechnische Fortschritt und die daraus resultierende bessere Versorgung während und nach einem Krankheitsfall ermöglicht es der Bevölkerung, – zumindest in den westlichen Ländern – immer älter zu werden, in anderen Worten: Die Allgemeinheit erfreut sich einer steigenden Lebenserwartung. Diese liegt aktuell laut Österreichischer Gesundheitsbefragung 2006/2007, durchgeführt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, für Frauen bei 82,7 Jahren und für Männer bei 77,1 Jahren. Als Begleiterscheinung ergibt sich daraus bei älteren Personen eine vermehrte Hilfs- und Pflegebedürftigkeit. In Österreich haben über 80% der Pflegegeldbezieher bereits das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten.1
Aufgrund des verbesserten Angebots im Pflege- und Krankheitsfall wachsen auch die Erwartungen bezüglich der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Jeder Einzelne möchte im Bedarfsfall in den Genuss der bestmöglichen Versorgung und Behandlung kommen und die Möglichkeit haben, diese kostengünstig bzw. gratis zu nützen. Der Sozialstaat sichert zwar die Grundversorgung und Hilfestellung unter anderem bei Krankheit, Unfall und Alter zu, im Falle einer Pflegebedürftigkeit reichen diese Zuwendungen – sei es in finanzieller Form oder als Sachleistung – jedoch selten aus, um die möglichen Behandlungs- und Versorgungsdienstleistungen zu finanzieren bzw. abzudecken. Diese Bedingungen stellen häufig den Anlass für Streitigkeiten und Konflikte innerhalb des sozialen Umfeldes dar.
Der demografische Wandel, also die veränderte Altersstruktur der Gesellschaft, lässt ein Anschwellen der Zahl an Pflegebedürftigen erwarten. Durch den zusätzlichen Pflegebedarf, den es personell und kostentechnisch zu decken gilt, könnte es künftig zu einem Mangel an Fachkräften im Pflege- und Betreuungsbereich kommen. Begründet wird dieser durch den Geburtenrückgang und das Ausscheiden der Babyboom-Generation als Erwerbstätige.2 Gerade im Alter werden vermehrte Unterstützungsleistungen, seien sie personell oder finanziell, nötig. Die erforderlichen Hilfestellungen werden nicht nur von externen Dienstleistungsanbietern erbracht, sondern sehr oft von pflegenden Angehörigen übernommen. Die steigende Anzahl der Pflegefälle erzeugt nicht nur auf sozialpolitischer Seite, sondern auch im privaten Umfeld Spannungen. Innerhalb der Familie und des sozialen Umfelds können Konflikte entstehen zum Beispiel bei der Klärung des finanziellen Aspekts – wer zahlt was –, aber auch bei der nötigen Pflege- und Betreuungstätigkeit selbst – wer übernimmt diese und wer ist dafür zuständig etc.
Im Endbericht ‚Situation pflegender Angehöriger‘ des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz wird erwähnt, dass mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen in Österreich zu Hause gepflegt werden. Die anfallenden Pflege- und Betreuungstätigkeiten werden zu einem großen Teil vollständig von pflegenden Angehörigen – vorwiegend von Frauen – übernommen.3
Eine Pflegesituation stellt für Angehörige und auch für die Pflegebedürftigen selbst eine große Herausforderung dar. Aus dieser neuen und oftmals plötzlich eintretenden Situation können sich Belastungen, Spannungsfelder und Überforderungen ergeben, die sich in weiterer Folge – sofern nicht bearbeitet – zu Konflikten entwickeln. Auch längst vergessene oder noch ungeklärte Konflikte aus der Vergangenheit sind plötzlich wieder sehr präsent, denn abgesehen von den organisatorischen Belangen und „[…] der pflegerischen Belastungen bilden alte ungeklärte Familien- und Ehe«geschichten« den eigentlichen Zündstoff für Konflikte […]“4. Die Kommunikation mit der Ärzteschaft z.B. betreffend Diagnose, weiterer Vorgehensweise, welche (Unterstützungs-) Möglichkeiten es für eine häusliche Pflege gibt usw. stellt ein weiteres Feld für Konfliktpotential dar. Eine wenig einfühlsame Mitteilung der Diagnose sowie die Verwendung der lateinischen Wörter, ohne zu beschreiben was sie wirklich bedeuten, lassen bei Patient und Angehörigen Fragen offen und können zu einem Gefühl von Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Überforderung führen. Ein respekt- und würdevoller Umgang in dieser schwierigen Notsituation ist für die Betroffenen von Seiten der im Medizinbereich Tätigen eher selten zu spüren.
Für die Bewältigung solcher belastenden und konfliktreichen Situationen gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Das bestehende Konfliktbearbeitungsangebot erstreckt sich von Beratungen und Unterstützungsmaßnahmen durch freiwillige, ehrenamtliche Sozialdienste über Seelsorge bis hin zu professionellem Konfliktmanagement wie z.B. Mediation. Eine professionelle Konfliktbearbeitung oder ein entlastendes Gespräch kann im Einzelsetting sowie mit mehreren oder allen Beteiligten gemeinsam durchgeführt werden. Ist der Konflikt bereits sehr einschneidend und Gespräche zwischen den beteiligten Parteien schwer bis kaum möglich, sind Mediation und/oder Coaching die richtige Wahl. Geht es eher darum, sich den Schmerz und die Last von der Seele zu reden und/oder eventuell eine andere Perspektive zu dieser Situation zu bekommen, sind Beratungen z.B. bei Lebens- und Sozialberater/innen, Coaches oder Sozialen Diensten vorzuziehen. Für fachliche Pflegeberatung stehen entsprechende öffentliche Beratungsstellen zur Verfügung.
1.1. Problemstellung
Konflikte oder Konfliktpotenzial sind jederzeit in den verschiedensten Situationen vorhanden. Im pflegerischen, häuslichen Umfeld treten Konflikte unter anderem aufgrund von unterschiedlichen Erwartungshaltungen, Werten und Bedürfnissen auf. Die Hilflosigkeit des/der Pflegebedürftigen kann sich zum Beispiel in Wut, Aggression oder auch Lethargie zeigen, was wiederum Auswirkungen auf das soziale Umfeld, die Familie und Pflegeleistende hat. Wird vom Pflegebedürftigen die Pflegeübernahme durch einen Angehörigen als Pflicht – im Sinne von ‚du bist es mir schuldig‘ – eingefordert, erzeugt dies Druck. Diese Anspannung kann zu Überforderung oder dazu führen, dass sich der/die Angehörige aus dieser ‚bedrückenden‘ Situation befreit, in dem er/sie sich zurückzieht und Pflege- und Betreuungstätigkeit in den Hintergrund rückt oder gar nicht mehr tätigt. Die Folge können Verwahrlosung, das emotionale Ausschließen und die Vereinsamung des/der Pflegebedürftigen sein. Gewissensbisse oder Schuldgefühle können sich bei den pflegenden Angehörigen auch dann bemerkbar machen, wenn sie, um ein Beispiel zu nennen, der selbst auferlegten Pflicht – im Sinne von ‚ich fühle mich verpflichtet‘ – nicht entsprechend nachkommen können.
Erinnerungen an frühere Zeiten können sich positiv wie negativ auf die Pflegebeziehung auswirken. Einerseits können Erinnerung an Verletzungen oder auch Gemeinheiten durch die pflegebedürftige Person die Bereitschaft zur liebevollen Pflege hemmen oder aber – im schlimmsten Fall – auch zu Aggressionen oder Gewalt gegenüber der ausgelieferten, pflegebedürftigen Person führen. Andererseits können positive Erinnerungen und eine gute Beziehung dazu führen, dass sich die pflegenden Angehörigen zu viel zumuten, sich überfordern und somit auf sich selbst vergessen.
Die Auswirkungen von ungelösten Konflikten, das Nichtansprechen von Überforderung und Diskrepanzen in pflegerischen Beziehungen sind breit gefächert. Dadurch wird das Zusammenleben und Erbringen von Pflege- und Betreuungstätigkeit erschwert und es kann unter anderem Aggression und Gewalt entstehen, denn latente wie offensichtliche Konflikte verringern das gegenseitige Verständnis. Sie behindern sozusagen die Sicht auf das eigentliche Problem, weil das Wahrnehmen und das Anerkennen der jeweiligen Standpunkte und damit auch der dahinterliegenden Bedürfnisse erschwert wird. Insgesamt leidet die Beziehungsqualität. „Das Verhältnis der Betroffenen zueinander“5 kann „negative Auswirkungen auf die ganze Familie haben, besonders dann, wenn Konflikte aus früheren Jahren noch nicht aufgearbeitet sind.“6 Vereinsamung, Verwahrlosung des/der Pflegebedürftigen aber auch völlig zerrüttete Familiensysteme können die Folge sein.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem die emotionale Belastung aller Beteiligten, die ständig steigt. Aufgrund der emotionalen Überforderung kann ein größeres Risiko zur Suchtgefährdung bestehen, denn Alkohol, Tabletten oder sonstige Suchtmittel werden als Beruhigungs- oder als Verdrängungsmittel verwendet, um mit der Situation besser fertig zu werden. Als Pflegender/Pflegende auf sich selbst nicht vergessen und gesund zu bleiben, ist eine weitere große Herausforderung und kann zu intrapersonalen Konflikten und/oder Spannungsfeldern mit der eigenen Familie führen.
Neben den psychischen und physischen Beanspruchungen sind die finanzielle Belastungen und die (frei-)zeitlichen Einschränkungen nicht zu vergessen. Weitere Herausforderungen ergeben sich durch den Kontakt mit Ansprechpartner/innen wie etwa Ämtern, Ärzt/innen, mobilen Diensten etc., die durchaus Konfliktpotential beinhalten können. Einen weiteren Nährboden für Unstimmigkeiten stellt die Organisation und Administration dar, die sich durch die Übernahme der Pflege für die Angehörigen ergibt: Hier sind beispielhaft die Wohnungsadaptierung, die Organisation von Pflege-/Betreuungsdiensten, Amtswege etc. zu erwähnen.
Alle angeführten Spannungsfelder schwächen die Beziehungsqualität zwischen den betroffenen Personen. Eine logische Folge davon ist, dass die notwendigen Hilfestellungen und die entsprechende seelische Unterstützung erschwert zu erbringen aber auch zu empfangen sind. Eine offene und wertschätzende Begegnungsqualität lässt sich in einer Zeit der Spannungen, Konflikte und Probleme nur schwer erhalten. In den schlimmsten Fällen enden diese Situationen in völlig zerrütteten Familiensystemen, in Erbschaftsstreitigkeiten, oder in anderen schweren Auseinandersetzungen, die nicht selten auch vor Gericht ausgetragen werden, denn das Ansprechen und Regeln von Konflikten durch die Beteiligten selbst ist in solch extremen Stresssituationen schwierig umzusetzen. Ein konstruktiver Umgang mit Überforderung, Spannungsfeldern und Konflikten ist ohne einen unabhängigen Dritten, z.B. einem/einer Mediator/in oder einer anderen externen Hilfestellung für Konfliktbearbeitung, meist nicht gegeben.
1.2. Ziel und Zweck der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Ist-Situation in Bezug auf das Konfliktpotential im Bereich der häuslichen Pflege zu erheben. Zu diesem Zweck wurde einerseits eine Befragung von Personen, die in mobilen Pflege- und Betreuungsdiensten arbeiten durchgeführt, und andererseits wurden Interviews mit Konfliktbearbeitungsexperten geführt.
Die erste Gruppe – aus dem mobilen Pflege- und Betreuungsdienst – hat eine Außensicht auf die Konfliktsituationen im Bereich der häuslichen Pflege und wurde zu den von ihnen betreuten Haushalten befragt. Dabei wurde unter anderem erhoben, ob und inwieweit ihrer Meinung nach Bedarf an Konfliktbearbeitung besteht, ob von pflegenden Angehörigen entsprechende Angebote zur Konfliktbearbeitung in Anspruch genommen werden und aus welchen Gründen dies ihrer Einschätzung nach unter Umständen unterbleibt.
Zusätzlich wurden Experteninterviews mit der zweiten Gruppe bestehend aus Mediatoren/innen, Mitarbeitern von Sozialen Diensten, Lebens- und Sozialberater/innen, Coaches etc. geführt, die sich auf die Konfliktbearbeitung im Pflegebereich spezialisiert haben. Das Ziel dieser Interviews war es, anhand der Erfahrungen dieser Experten den Bedarf an Konfliktbearbeitung in der häuslichen Pflege zu erheben und zu erfahren bei welchen Spannungs- und Konfliktfeldern eine externe Hilfestellung zur Konfliktbearbeitung nötig sei. Schließlich sollte noch in Erfahrung gebracht werden in welcher Art und Weise das Angebot zur Konfliktbearbeitung für pflegende Angehörige bekannter und niederschwelliger zugänglich gemacht werden könnte.
Anhand der Ergebnisse beider Gruppen sollen eventuelle Maßnahmen abgeleitet werden können um die Situation der pflegenden Angehörigen, Pflegebedürftigen sowie Pflegedienstleistenden zu verbessern. Ebenfalls sollen anhand der Ergebnisse mögliche Hilfestellungen angeboten werden, um Konflikte im pflegerischen und familiären Umfeld zu regeln. Es soll veranschaulicht werden, dass durch die frühzeitige Inanspruchnahme einer Mediation, eines Coachings oder einer Konfliktberatung als Präventivmaßnahme die entstehenden Spannungsfelder und Probleme abgefedert werden können, sodass ein verhärteter Konflikt oder eine Eskalation vermieden werden können. Der Grund dafür ist, dass bei Inanspruchnahme einer Konfliktbearbeitung Diskrepanzen und Schwierigkeiten an- und ausgesprochen werden können. Wichtig ist, dass hierbei die Konfliktparteien gemeinsam eine gangbare Regelung suchen. Zusätzlich können durch mediative Vorgehensweisen oder externe Konfliktbearbeitung soziale und psychische Belastungen der Beteiligten zur Sprache gebracht werden und somit künftig verhindert, verringert, oder auch behoben werden.
Es wäre wünschenswert für alle am Pflegebereich Beteiligten, das Bewusstsein dafür zu schaffen, welche möglichen Herausforderungen und Konflikte auftreten können und vor allem in welcher Art und Weise mit diesen Situationen konstruktiv umgegangen werden kann. Wichtig ist für alle Betroffenen die Erkenntnis, dass in pflegerisch/betreuerischen Situationen Spannungen und Konflikte menschlich und zu erwarten sind. Da viele Themen, die im Zuge einer häuslichen Pflege- und Betreuungssituation auftauchen, in unserer Gesellschaft tabuisiert sind, ist es gesellschaftlich dringend notwendig, diese Tabus zu brechen. Das ehrliche Gespräch über Konflikte und damit das offene Aussprechen von allen wichtigen Facetten dieses Themas, auch wenn sie vielleicht mit Angst und/oder Scham besetzt sind oder aus anderen Gründen zurückgehalten werden, scheinen den Schlüssel zur Verbesserung der derzeitigen Situation darzustellen. Die vorliegende Arbeit soll hierzu einen Beitrag leisten.
1.3. Hypothese
Eine konfliktfreie Zeit während einer pflegerischen Betreuung ist der Wunsch vieler Betroffener, sei es für die pflegebedürftigen Personen selbst, die Familienangehörigen und auch jene, die mit der Pflege betraut sind. Offene wie auch latente Konflikte sind in der Realität zwischenmenschlicher Beziehungen allerdings ständige Begleiter. Insbesondere in Ausnahmezuständen und Notsituationen, z.B. wenn ein/e Angehörige/r plötzlich zum Pflegefall wird, stellen Konflikte eine zusätzliche Herausforderung für alle Beteiligten dar.
Die verschiedenen Methoden zur Konfliktbearbeitung – sei es im Einzelsetting oder in Gruppen – können hierbei unterstützend, lösend und regelnd wirken. Mit Hilfe von externer Unterstützung ist es möglich, den Sorgen, Belastungen und Befürchtungen Raum zu geben. Das An- und Aussprechen der bestehenden Spannungen und Konflikte wirkt befreiend. Aktives Zuhören, mediative Interventionsmethoden und prozessbegleitende Betreuung sind die Basis von Konfliktbearbeitung und ermöglichen den Betroffenen, neue Wege und Handlungsmöglichkeiten zu erkennen.
Das Angebot an externen Hilfestellungen und/oder auch eine Beratung in Spannungs- und Konfliktsituationen wird von den pflegenden Angehörigen, Pflegebedürftigen und allfällig weiteren Konfliktbeteiligten zum Teil aus Scham, Unkenntnis oder auch aufgrund des finanziellen Aspektes nicht in entsprechendem Maße angenommen.
Daraus wird folgende Hypothese abgeleitet:
Obwohl gerade im Bereich der häuslichen Pflege/Betreuung Bedarf an externer Konfliktbearbeitung besteht, werden entsprechende Angebote derzeit noch kaum in Anspruch genommen.
Diese Hypothese soll im Folgenden anhand von Literaturrecherche und empirischen Erhebungen untersucht und bewiesen werden.
1.4. Aufbau der Arbeit
Der Fokus dieser Arbeit liegt einerseits bei der Erhebung der Ist-Situation des Bedarfs an Konfliktbearbeitung in der häuslichen Pflege, andererseits auf dem Herausarbeiten der Vorteile und des Nutzens durch den Einsatz von externer Konfliktbearbeitung im pflegerischen häuslichen Umfeld.
Mit Kapitel 1 wird einleitend zum Thema Konfliktbearbeitung in der häuslichen Pflege/Betreuung hingeführt. Im nächsten Schritt werden die Problemstellung, das Ziel und der Zweck der Arbeit sowie die daraus abgeleitete Hypothese dargelegt. Die grundlegenden Begrifflichkeiten werden im Kapitel 2 definiert und näher beschrieben. Daran anschließend wird im Kapitel 3 die Situation der häuslichen Pflege in Österreich erläutert. Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit Konflikten/Spannungsfeldern im Pflegebereich bzw. in der Pflegesituation. Welche Methoden für eine Konfliktbearbeitung bestehen, werden im Kapitel 5 näher beschrieben. Kapitel 6 widmet sich der empirischen Erhebung. Diese erfolgt einerseits in Form von einer Befragung von Mitarbeiter/innen mobiler Dienste aus dem Bereich der Hauskrankenpflege mittels Fragebögen sowie andererseits durch Interviews mit Konfliktbearbeitungsexperten/innen. Zum Schluss werden im Kapitel 7 die Ergebnisse zusammen gefasst und entsprechende Schlussfolgerungen abgeleitet.
1 Vgl. Statistik Austria: Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Hauptergebnisse und methodische Dokumentation; Wien: 2007, S. 14 ff.
2 Vgl. Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz: 15 Jahre Pflegevorsorge. Bilanz und Ausblick; Wien: 2008, S. 28 ff.
3 Vgl. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz: Situation pflegender Angehöriger. Endbericht; Wien: 2005, S. I
4 Döbele, M.: Angehörige pflegen. Ein Ratgeber für die Hauskrankenpflege; Heidelberg: 2008, S. 58
5 Döbele, M.: Angehörige pflegen. Ein Ratgeber für die Hauskrankenpflege; Heidelberg: 2008, S. 9
6 Döbele, M.: Angehörige pflegen. Ein Ratgeber für die Hauskrankenpflege; Heidelberg: 2008, S. 9
2. BEGRIFFLICHKEITEN
In diesem Abschnitt werden die im Verlauf der wissenschaftlichen Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten näher definiert, erklärt und im Kontext des Themas dieser Arbeit eingegrenzt.
1.1 Pflege/häusliche Pflege
Das Nomen Pflege bedeutet im Allgemeinen „[…] sorgende Obhut, eine liebevolle, aufopfernde Pflege […] Behandlung mit den erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung eines guten Zustandes[..] die Pflege der Gesundheit [...]“7.
Die Pflege „[..] Fürsorge, sorgende Behandlung [..] Aufsicht u. Sorge für den Lebensunterhalt […] Sauberkeit u. Gesunderhaltung […]“8 von Pflegebedürftigen übernehmen externe Institutionen, Vereine oder gesundheitliche Organisationen sowie Familienangehörige.
Der Weltbund des Pflegefachpersonals mit Sitz in der Schweiz, ICN International Council of Nurses, erklärt Pflege im Originaltext auf Englisch wie folgt: “Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups and communities, sick or well and in all settings. Nursing includes the promotion of health, prevention of illness, and the care of ill, disabled and dying people. Advocacy, promotion of a safe environment, research, participation in shaping health policy and in patient and health systems management, and education are also key nursing roles.”9
Die Übersetzung für oben gennannte Definition durch DBfK, Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe lautet: „Pflegeumfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder in Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemeinschaften, sowie von Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituationen (Settings). Pflege schließt die Förderung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und sterbender Menschen ein. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind Wahrnehmung der Interessen und Bedürfnisse (Advocacy), Förderung einer sicheren Umgebung, Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie im Management des Gesundheitswesens und in der Bildung.“10
Für den Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband beinhaltet Pflege laut Kompetenzmodell für Pflegeberufe in Österreich unter anderem die Unterstützung von Personen bei der Bewerkstelligung von Gesundheitsproblemen, die Zurverfügungstellung von Interventionsmaßnahmen zur Förderung und Erhaltung von Gesundheit und Lebensqualität. Vorbeugemaßnahmen zur Vermeidung von Leid und Krankheit, sowie das umsorgende Betreuen der Kranken unterstreichen den pflegerischen Rahmen und berücksichtigen die Würde und Bedürfnisse des/der Pflegebedürftigen.11
Das englische Nomen care wird im Deutschen mit Pflege, Betreuung, Sorge, Zuwendung, Sorgfaltspflicht, Fürsorge, Behandlung etc. übersetzt. Im Englischen wird nursing als Substantiv für Pflege, Krankenpflege oder auch Wartung; das Verb nurse für hegen, pflegen, kurieren, behandeln usw. verwendet. Die Pflege wird im Gesundheitsbereich gesehen als „[..] menschliche Fähigkeit und Aktivitäten, Bedingungen für das Überleben oder Wohlbefinden von Menschen zu sichern oder herzustellen; […]“12.
Pflegeaktivitäten werden entweder von der Person selbstständig erbracht oder durch Pfleger/innen für Pflegebedürftige vorgenommen. Die Tätigkeiten des Pflegens sind als obsorgende, umsorgende Hilfeleistung zur Bewältigung des Alltags zu sehen. Die Pflege wird einerseits als Behandlung von Schmerz und Leid mit dem Versuch, diese zu mindern und abzuschwächen verstanden, andererseits wird durch die Pflege eine Supportfunktion gewährleistet, um das Umfeld des/der Pflegebedürftigen so zu gestalten, dass eine Genesung und Schmerzlinderung möglich wird.13
In der Anthroposophie orientiert sich die Pflege an dem Welt- und Menschenbild von Rudolf Steiner und bezieht die leiblichen, seelischen, geistigen und sozialen Umstände des/der Pflegebedürftigen mit ein.14
Das Adjektiv pflegerisch findet Verwendung als „[…] die Pflege betreffend […] pflegerische Berufe […] pflegerische und heilende Kosmetik […]“.15
Unter Beziehungspflege wird „[…] das pflegerische Bearbeiten von psychischen, emotionalen, interpersonalen und interdependenten Inhalten einer Beziehung zwischen Patienten und Pflegenden; […]“16 verstanden.
Unter pflegerisch werden alle Komponenten, Tätigkeiten und Themenbereiche verstanden, die im Bereich Pflege im Sinne von Betreuung, Behandlung, Fürsorge, Obhut oder Obsorge, Schutz und Erhaltung vorkommen. Pflegerisch tätig zu sein meint, sich um etwas kümmern, sich um etwas sorgen oder auch sich etwas widmen. Die Familie, gesehen als pflegerische Beziehung, sorgt sich um das Wohlbefinden der Familienangehörigen.
Unter dem Adjektiv häuslich versteht man „die Familie, das Zuhause betreffend, […] zu Hause befindlich, stattfindend, […] durch häusliche Pflege wurde er rasch gesund […]“17. Im deutschen Gesundheitsbereich wird häusliche Pflege definiert als „(engl.) home care, [..] ambulante Pflege, [..] Gemeindekranken- und Altenpflege, extramurale Pflege […]“18. Die Dienstleistung der häuslichen Pflege wird außerhalb eines voll- oder teilstationären Versorgungsangebots erbracht und findet im eigenen Heim, im Wohn- und Lebensumfeld des/der Pflegebedürftigen statt. Es ist dabei unerheblich von wem die Pflegeoder Betreuungsleistung erbracht wird, ob von Laien wie z.B. pflegenden Angehörigen oder von Professionisten aus dem Bereich der Gesundheits- und Pflegebranche. Nicht zu unterschätzen ist die Komplexität der häuslichen Pflege aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren. Zu nennen sind hier beispielhaft die Einwirkungen der finanziellen Situation sowie die permanente Wechselwirkung mit der Familie und dem sozialen Umfeld oder auch die fehlende Infrastruktur im häuslichen Bereich.19 Herausforderungen stellen die Bedürfnisse des/der Pflegebedürftigen, der Familie auf emotionaler oder persönlicher Ebene sowie die gesetzlichen Vorgaben und – zum Teil eingeschränkten – Unterstützungsleistungen dar.
Die häusliche Pflege erbracht durch vergütete professionelle Dienstleistungsanbieter oder pflegende Angehörige dient dazu, beim Pflegeempfänger „[…] die Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten und die Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu verhindern […]“20.
Die von pflegenden Angehörigen, Freunden oder Bekannten geleistete Pflege und Betreuung wird im Fachjargon als informelle Pflege





























