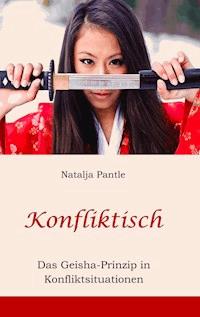
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mögen Sie Konfliktgespräche? Für die meisten von uns, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Position oder Erfahrung sind sie der reine Horror. Ein unvorsichtiges Wort versetzt uns oder unseren Gesprächspartner in die höchste Alarmbereitschaft. Die größte Herausforderung dabei bleibt eine große Anzahl von situationsabhängigen Variablen. Dies ist der Grund, warum viele die Meinung vertreten, dass die Kunst einer erfolgreichen Kommunikation unter diesen schwierigen Umständen keine erlernbare Fähigkeit, sondern eine göttliche Gabe sei. Die Autorin ist der Meinung, dass Konfliktisch eine eigene internationale Sprache ist und jeder von uns darin unglaublich talentiert ist. Einfach über Kompliziertes, mit Humor über Ernstes, spannend über Trockenes präsentiert Natalja Pantle die Grammatik von Konfliktisch mit einer Reihe von praktischen Übungen und Beispielen aus den beruflichen und privaten Bereichen. Am Ende dieses Buches werden Sie jedes Konfliktgespräch einfach willkommen heißen, denn so können Sie endlich üben und Spaß samt Genugtuung dabei verspüren, so die Autorin. Probieren Sie es und überzeugen Sie sich selber davon! Viel Erfolg Ihnen dabei!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu dem Buch:
Konfliktsituationen meiden wir wie die Pest. Dies betrifft die meisten von uns, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Position oder Erfahrung. Der Gedanke allein an ein vergangenes oder bevorstehendes Konfliktgespräch versetzt uns in Alarmbereitschaft und lässt unser Herz schneller schlagen. Da vieles dabei situationsabhängig ist und schwierig vorhersehbar, macht man einen großen Bogen um solche Auseinandersetzungen oder geht das Thema auf gut Glück an, oft kämpferisch (oder amateurhaft). Die Autorin ist der Meinung, dass die Kommunikation in Konfliktsituationen wie Deutsch, Englisch oder Russisch eine eigene Sprache darstellt mit ihren Regeln und Strukturen. Auf eine einfache und humorvolle Art präsentiert Natalja Pantle die Grammatik dieser internationalen Sprache mit ausführlichen praktischen Beispielen aus dem beruflichen und privaten Alltag. Jeder von uns ist in Konfliktisch von Natur aus talentiert. Ein paar Regeln und ein wenig Feinschliff aus diesem Buch – und unser gefürchteter Feind wird zum Freund und Partner.
Zu der Autorin:
Natalja Pantle ist Linguistin von Beruf und aus Berufung und eine unverbesserliche Optimistin. Sie wohnt im Süden Deutschlands und hält als freie Dozentin Seminare zum Thema Kommunikation.
Inhalt
Die Idee. Wie alles begann
Konfliktisch-Glossar
Vier Elemente/Vier Reaktionen
Die Physiologie unserer Entscheidungen
Mars und Venus
Konflikte im Slow-Modus
Zehn Techniken zur Selbstbeherrschung, zu einer positiven inneren Einstellung und zur Kreativität
Das tiefe Ein- und Ausatmen
Die mentale Vor-Einstellung
Das sichere Auftreten
Das hohe Selbstwertgefühl
Der Female King
Das Kanon-Sprechen
Das Sprüche-Repertoire.
Backstage-Kenntnisse
Die emotionale Intelligenz
Die Konfliktisch-Praxis
Konfliktisch/Die Gesamtübersicht
Das Maiko (Kleines Mädchen)-Prinzip
1. Die Fisch-Methode
2. Die Airbag-Methode
Das Taikomochi (Clown)-Prinzip
3. Die Genau-so-Methode
4. Die Witz-Methode
5. Die Spruch-Methode
6. Die Clown-Methode
Was ist eine Geisha überhaupt?
Das Geisha (Geschäftsmann)-Prinzip
7. Die Arzt-Methode.
8. Die Politiker-Methode
9. Die Wie-bitte-Methode
10. Die Geisha-Methode
Das Judoka (Boxer)-Prinzip
11. Die Ihr-Problem-Methode
12. Die So-nicht-Methode
Konflikte bei öffentlichen Auftritten
Die Macht der Komplimente
Keine Angst vor Vorstellungsgesprächen!
Das Beste zum Schluss
Die Zusammenfassung
Das Schlusswort
Wie geht es weiter?
Anmerkungen
Literaturempfehlungen
Die Idee. Wie alles begann
Wie die Jungfrau zu Konfliktisch …
In diesem Kapitel finden Sie Antworten und Erläuterungen zu folgenden Fragen und Punkten:
Eine Seminarteilnehmerin hat einmal gesagt: „Sie haben es gut, Sie haben ein Talent, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Schlagfertigkeit, die Kunst, passende Antworten zu unterschiedlichen Situationen zu geben, ist nicht erlernbar. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Da helfen keine Kurse. Dass man es lernen kann, ist eine Utopie!“ Das hat mich unwillkürlich an meine Uni-Zeit erinnert, als ich vieles verstanden habe, jedoch nicht über die Fähigkeit verfügte, mich selbst entsprechend zu artikulieren.
Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich komme ursprünglich aus Russland, wo Deutsch als Fremdsprache für die meisten von uns eher so etwas wie Latein war. (Es war ja vor der Wende, für einige von uns schon vor ganz langer Zeit ;-).) Deutsch war damals eine Sprache, welche wir außerhalb der Schulklassen niemals gebrauchten und auch in der Zukunft nie anwenden würden (so dachten wir zumindest). Jedoch unverhofft kommt oft. Nach dem Abitur entschied ich mich für das Sprachstudium. Fremdsprachen wurden immer populärer. Damals gab es drei Fachrichtungen, die besonders beliebt waren und als prestigeträchtig galten: Medizin, Wirtschaftswissenschaften und Fremdsprachen. Die dritte Fachrichtung fand ich besonders faszinierend: Als Dolmetscherin die ganze Welt bereisen, interessante, wichtige, bedeutende Persönlichkeiten kennenlernen und für die Verständigung zwischen Kulturen sorgen. Wow! Das war meine Mission!
Die Realität der ersten Studienjahre sah jedoch völlig anders und auch ziemlich hart aus. Als Provinzmädchen in der Hauptstadt in einer Gruppe von Kommilitonen (zu 80 % männlich), welche schon ganz passabel Deutsch beherrschten und zu Beginn des Studiums nur wiederholen und an ihrer Aussprache feilen mussten. Für mich war es damals schwer zu verstehen, warum Butter unbedingt DIE Butter hieß (im Russischen ist es DAS Butter; für Schwaben, wie sich später herausstellte, ist es DER Butter ;-)). Das war spannend! Grammatische Regeln und Strukturen, besonders dieses Passiv im Plusquamperfekt mit Modalverben – der war ein reiner Horror! „Wiederholen Sie es bitte, Fräulein Pantle“, lächelte mein Dozent mich an. „Sagen Sie bitte ‚Die Aufgabe muss erledigt werden‘ im Plusquamperfekt Passiv.“ Oh, mein Gott, das mir Vorgesagte auch nur zu wiederholen, war eine richtige Qual für mich! Es handelte sich um eine pure Ansammlung von Verben. Welchen Sinn machte das Ganze? „Eine Aufgabe hatte gemacht werden müssen.“ „Es ist unheimlich wichtig“, instruierte mich der Professor weiter. „Denn ohne Plusquamperfekt Passiv geht gar nichts, das ist das A und O der deutschen Grammatik. Und als Dolmetscherin müssen Sie es im Schlaf beherrschen!“ Oh je, das war eine Herausforderung! Wer A sagt, muss auch B sagen: Wenn es zum Studium gehörte, so musste man nolens volens da durch. Ich kniete mich rein und lernte wie eine Besessene. Wenn die anderen abends und an den Wochenenden Partys und das ausgelassene Studentenleben genossen, sich verliebten, heirateten und die ersten Kinder bekamen, wiederholte ich, wie ein Mönch an seiner Gebetsmühle, neue Wörter und Ausdrücke, grammatikalische Regeln und Strukturen. Und über meinem Bett hingen nicht Poster bekannter Mädchenschwärme (Sänger und Schauspieler), sondern Listen mit der Konjugation von Verben und für mich neuen deutschen Ausdrücken. „Schreiben – schrieb – geschrieben; lesen – las – gelesen; Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid; in Ulm, um Ulm und um Ulm herum“.
Jahre vergingen, und ich hatte nun immer wieder mit Muttersprachlern zu tun (bei Studienreisen, Übersetzungen für deutsche Reisegruppen, beim Dolmetschen bei Konferenzen). Dabei fanden die Teilnehmer, für die ich übersetzte, nicht etwa meine perfekt altmodische Ausdrucksweise so entzückend („Sie reden wie im 18. Jahrhundert“, kommentierte einmal ein Kunde), sondern die ab und zu bei mir durchgeflutschten Slang-Begriffe. Ein Ausdruck wie „Da war richtig tote Hose“ begeisterte meine Gesprächspartner viel mehr als das perfekt angewandte Plusquamperfekt Passiv, mit welchem ich immer wieder zu beeindrucken versuchte. Mit dem Diplom als Dolmetscherin in der Hand bin ich schließlich in Deutschland angekommen.
Im Süden des Landes gelandet, im Schwaben-Ländle (dem Land der Schwaben), erlebte ich erstmals einen „Sprachschock“: Die Menschen hier waren mir gegenüber sehr gastfreundlich, zuvorkommend und gesprächig. Einige staunten über meine gute Ausdrucksfähigkeit und versuchten, langsam „Hochdeutsch“ mit mir zu sprechen, die anderen schnatterten, „wie ihnen der Schnabel gewachsen war“, und wollten wissen, ob ich schon geveschpert (zu Abend gegessen) habe, sie berichteten von ihren G‘schäften (Arbeitsstellen), Häuslen (Häusern) und Stüblen (Zimmern). „Trinksch‘ mit uns ein Weinschorle im Besen?“, wollten sie wissen. (Trinkst du mit uns ein Glas Wein, gemischt mit Wasser in einer Gaststätte?) „Oh, je“, sagte ich die erste Zeit immer wieder zu mir selbst. „Habe ich die RICHTIGE Sprache gelernt? Ich verstehe die Menschen hier nicht!“ Mir blieb nur das freundliche Zurücklächeln und Nicken übrig. Mehr als drei Mal nachzufragen habe ich mich nicht getraut. „Ich bin wie Luft für ihn“, erzählte traurig meine Freundin. „Und was ist daran so schlimm?“, rätselte ich. Im Russischen, wenn man für jemanden „Luft“ ist, bedeutet es so viel wie „du bist so wichtig für mich wie die Luft zum Atmen. Ich kann nicht ohne dich“. Im Deutschen ist es genau das Gegenteil. Faszinierend!
Nach und nach sprach ich selbst schwäbisch und suchte nach weiteren Möglichkeiten, um alle Sprachnuancen zu beherrschen und hiesige Witze und die Mentalität besser zu begreifen, aber auch, um selbst wortgewandter und schlagfertig zu werden. Schlagfertigkeit – das war ein neues, ambitioniertes Ziel.
Ist es überhaupt möglich? Ist Schlagfertigkeit erlernbar? Gibt es spezielle Schemata, Regeln; gibt es eine ausführliche Grammatik für eine schlagfertige Reaktion, welche dir wie beim Sprachenlernen das Aneignen dieser Kunst ermöglicht?
Man sagt, um eine neue Fertigkeit zu lernen, müsse man selber kein neues Rad erfinden. Am besten, man findet jemanden, der diese Fähigkeit schon perfekt beherrscht, und kopiert ihn. Danach kann man es weiter modifizieren und perfektionieren.
Sogar ein Zwerg kann weiter als ein Riese sehen, wenn er auf seinen Schultern steht. Bernhard von Chartres
Ich interviewte mehrere witzige und schlagfertige Persönlichkeiten. Wie machten sie das, wie kamen sie zu ihren linguistischen Ergüssen und situationskonformen, passenden Reaktionen? Sie konnten jedoch nicht verstehen, was ich von ihnen wollte. Es war für sie etwas ganz Natürliches und Ordinäres. Sie redeten einfach so. Warum? Sie waren nicht imstande, dies zu erklären. „Es kommt mir einfach in den Sinn, und ich sage das“, berichteten sie schulterzuckend. Sie waren auch nicht imstande, es jemandem beizubringen, genauso wie mit Muttersprachlern, welche nicht erklären können, warum sie so und nicht anders sprechen. Sie haben einfach dieses Sprachgefühl. Warum das so ist, nach welchen Regeln es erfolgt und ob es da Ausnahmen gäbe, das wissen sie nicht und können es einem Ausländer nicht plausibel erklären. Ich war selbst diese Ausländerin, die nach und nach das Gefühl, das Gespür, die Melodie und die Faszination für die neue Sprache aufgesaugt und es sich zu eigen gemacht hatte.
Die Schlag-Fertigkeit … Mit diesem Begriff war ich lange nicht ganz glücklich, da diese Bereitschaft zu schlagen, zu boxen und den Gegner zu erniedrigen wenig praxistauglich für mich selber war. Dieser Begriff ist sehr verlockend und mit seinem Rache-Charakter auch sehr anziehend; er befindet sich jedoch in der Praxis nur kurz entfernt von einem endgültigen Beziehungsende.
„Eine schlagfertige Frau ist wie ein boxender Hamster. Wer hat schon Angst vor diesen niedlichen Tierchen?“ Das hat man mir einmal gesagt; hart und, wie man es so schön ausdrückt, nicht politisch korrekt. Ich lachte jedoch darüber, denn es war wirklich ein komisches Bild. Es musste eine andere Art der verbalen Durchsetzung, der Bewahrung der Selbstsicherheit und der Selbstverteidigung geben. Besiegen, jedoch nicht „erniedrigen“; sich behaupten und Respekt verschaffen, dies jedoch im Dialog und dabei im Kontakt bleiben. Mir schwebte mehr ein Siegen durch Nachgeben vor, auf eine eher vornehme und sanfte Art, so wie im Judo: Wenn man den Angreifer durch seine eigene (physische) Kraft „auf den Rücken“ zu legen vermag, dann geschickt den Spieß umdreht und mit dem Einsatz der geistigen Macht mit ihm auf der Augenhöhe bleibt.
Eine Kommunikation hat normalerweise zwei Seiten: Redner und Zuhörer, Sender und Empfänger, Yin und Yang, Samurai und Geisha. Letztere gilt als eine perfekte Zuhörerin, Unterhalterin und Menschenkennerin. Sie hat ein feines Gespür für die emotionalen Zustände ihrer Gesprächspartner und ist imstande, durch Tanz, Gesang und geübte Konversation diese in eine positive Verfassung, weg vom Problem und hin zu Lösungen, zu bringen.
„Das Geisha-Prinzip“ ist ein signifikantes Reaktionsmodell für die meisten schwierigen Gespräche in unserem Leben. Wenn Sie dieses beherrschen, können Sie schon 80 % der Gesamtgrammatik von Konfliktisch! In diesem Buch finden Sie noch drei weitere Prinzipien. Alle zusammen bilden sie die Quadratur der Konflikt-Sprache, deren wichtigste Grammatik. Können Sie danach Konfliktisch sprechen?
Haben Sie in der Schule auch Englisch, Französisch, Spanisch oder Russisch gelernt? Warum dann nicht auch diese Sprache, die Sie ohnehin schon Tag für Tag praktizieren? In diesem Buch bekommen Sie Feinschliff sowie elegante Tipps und Tricks, die Sie dabei unterstützen, Ihr Konfliktisch einfach, unterhaltsam und erfolgversprechend zu gestalten.
Das A und O dabei bleiben Ihr Lernwille, Ihr Sinn für Humor und die Praxis. Reden, reden, reden: maximale Wirkung mit einem minimalen Aufwand.
Dabei geht es nicht um „Friede, Freude, Eierkuchen“, sondern um eine Art des Win-win1- Gespräches, bei dem jeder das Gesicht wahren und erfolgreiche berufliche und private Beziehungen führen kann.
PS: In Schriftwerken sind allerlei Emotionszeichen (à la Smileys) unüblich. Diese finde ich jedoch enorm aussagefähig, da sie das Non-Verbale praktisch mit einbeziehen. Verzeihen Sie mir deswegen diesen Klischeebruch, denn ohne Ihre unmittelbaren Reaktionen gelingt es mir nicht, Ihnen die Intention des Buches näherzubringen und dieses Thema leidenschaftlicher zu beleuchten. Es liegt mir sehr viel daran.
Viel Spaß beim Lesen, Üben und Nachmachen!
Konfliktisch-Glossar
Unser ABC
Der nachfolgende Abschnitt präsentiert das Konfliktisch-ABC mit seinen spezifischen Begriffen und Termini.
Jede Sprache hat ihr Vokabular, ihre Grammatik, ihre Phonetik usw. Genauso ist es auch bei Konfliktisch. Im weiteren Verlauf werden wir immer wieder mit spezifischen Begriffen und Bezeichnungen operieren, die Ihnen aus dem Geschichtsunterricht schon gut bekannt sein werden. Wir verwenden sie jedoch für diesen konkreten Kontext und mit eingeschränkter Bedeutung zur besseren Definition und Erklärung von Abläufen und Phänomenen von Konfliktisch. Keine Angst, es wird kein Plusquamperfekt Passiv geben, sondern die für Sie schon gut bekannten Begriffe und Gestalten, welche zur Allgemeinbildung gehören und ihren Ursprung im Land der aufgehenden Sonne, in Japan, haben.
Und hier sind unsere Termini:
Jiu-Jitsu
Eine von japanischen Samurai stammende Kampfkunst der waffenlosen Selbstverteidigung. Ziel des Jiu-Jitsus ist es, den Angreifer möglichst schnell und effizient außer Gefecht zu setzen. Siegen durch Nachgeben. Der Grundgedanke ist, die Kraft des Angreifers gegen ihn selbst einzusetzen.
Judo
S. Jiu-Jitsu, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: ohne dessen gefährliche und schmerzhafte Techniken. Hier geht es um Besiegen, jedoch nicht um „Niedermachen“.
Judoka
Ein Kämpfer, der Judo-Techniken einsetzt. Wir werden ihn auch als „Boxer“ bezeichnen.
Samurai
Ein japanischer Krieger/ Ritter
Maiko
Dies ist ein Geisha-Lehrling. Ein anderer Begriff dafür: „Kleines Mädchen“.
Geisha (Geiko)
Eine japanische Kommunikationskünstlerin, exzellente Menschenkennerin und Gastgeberin. Durch ihren Tanz und Gesang, geschickt eingesetzte Techniken des aktiven Zuhörens und den Ausdruck von Empathie ist sie imstande, Sympathien und positive Stimmungsänderungen bei ihren Gesprächspartnern zu bewirken. Sie unterliegt einem Schweigekodex und darf keine Auskunft über Art und Inhalt der im Teehaus geführten Gespräche preisgeben.
Taikomochi
Eine männliche Geisha, ein Unterhalter, ein „Clown“ (in unserer Terminologie).
Banzai
Der japanische Schlachtruf.
Harakiri
Eine rituelle Selbsthinrichtung nach dem Gesichtsverlust etc.
Bitte beachten Sie, dass es dabei um unsere Spezialbegriffe und nicht um allgemeingültige Definitionen dieser Bezeichnungen geht. Sie wurden, wie oben erläutert, für eine bildliche, emotional angehauchte Darstellung ausgewählt. Jetzt geht es los!
Vier Elemente/ Vier Reaktionen
Feuer/ Luft/Erde/Wasser
Die aktuelle Passage verdeutlicht die Wichtigkeit vom Small Talk und präsentiert vier mögliche Reaktionsvarianten bei verbalen Auseinandersetzungen.
Hallo, wie geht es Ihnen?





























