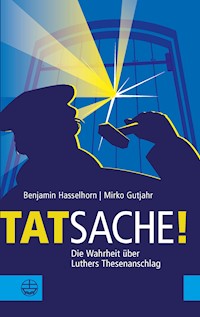Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 9. November 1918 floh Kaiser Wilhelm II. nach Holland ins Exil. Das besiegelte das Ende der Monarchie in Deutschland. Wilhelm II. galt fortan als Feigling und wurde als Hauptschuldiger am Ersten Weltkrieg identifiziert. Wenig bekannt ist heute, dass es auch ganz anders hätte kommen können: Manche im Umfeld des Kaisers planten, ihn im November 1918 an der Front den "Heldentod" sterben zu lassen und damit die Monarchie zu retten. Das unrühmliche Ende hat das Bild vom Kaiserreich nachträglich verdunkelt – zu Unrecht? Winston Churchill meinte, bei einer stabilen parlamentarischen Monarchie hätte Hitler in Deutschland kaum Fuß fassen können. Ländern wie Großbritannien oder Schweden gelang es, im 20. Jahrhundert mit ihrer Monarchie der Demokratie ein Stück Tradition und damit Stabilität zu geben. Unter Berücksichtigung der aktuellen Monarchieforschung wirft dieses Buch einen neuen Blick auf die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. [The Death of the King. 1918 and the End of Monarchy in Germany] On 9 November 1918, Kaiser Wilhelm II fled to the Netherlands into exile. This marked the end of German monarchy. Henceforth, Wilhelm II was regarded a coward and identified as the chief culprit of World War One. What is little known today is that things could have turned out very differently: plans were made to let the Kaiser die a "heroic death" on the frontline and thus save the monarchy. The downfall of German monarchy retrospectively darkened the image of the Wilhelmine era – unjustly? Winston Churchill was convinced that a strong parliamentary monarchy would have prevented Hitler from rising to power. Countries like Great Britain or Sweden who maintained their monarchies were able to give their democracies tradition and stability. With regard to recent research on monarchy this book takes a fresh look at 20th century European history.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benjamin Hasselhorn
Königstod
1918 und das Ende der
Monarchie in Deutschland
Dr. Dr. Benjamin Hasselhorn, geboren 1986 in Göttingen, ist Historiker und Theologe. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Religionsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und kuratierte 2017 die Nationale Sonderausstellung zum Reformationsjubiläum in Wittenberg. Bei der EVA erschien von ihm zuletzt die Streitschrift: »Das Ende des Luthertums?«
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2018 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: Fruehbeetgrafik · Thomas Puschmann, Leipzig
Coverbild: © fotolia by Adobe, Silkstock
Satz: Formenorm · Friederike Arndt, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
ISBN 978-3-374-05732-0
www.eva-leipzig.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
Die letzten Tage des Kaisers
Königstod
Das Jahrhundert der Monarchie
Der Volkskaiser
Kein Siegeszug der Demokratie
Die Wiederverzauberung der Welt
Monarchie im 21. Jahrhundert
Anmerkungen
Einleitung: Was wäre wenn?
Was wäre wenn?
Als in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1918 der Zug abfuhr, der den deutschen Kaiser Wilhelm II. vom belgischen Hauptquartier nach Holland brachte, war das Schicksal der Monarchie in Deutschland besiegelt. Ein Feigling auf dem Thron, ein Deserteur, der in der Stunde der höchsten Not das Vaterland im Stich ließ und ins neutrale Ausland floh, das war zu viel für die Deutschen – die in den Jahren der Regierung Wilhelms II. gelernt hatten, ihren Kaiser als symbolischen Repräsentanten, ja als Personifikation der Nation zu betrachten. Keine Berücksichtigung der Umstände, keine nachträgliche Erklärung der Beweggründe konnte es rechtfertigen, dass Wilhelm II. im Ernstfall versagt hatte. Die Abdankung des Kaisers, vor allem aber die sang- und klanglose Flucht führten zu einem totalen Glaubwürdigkeitsverlust der Monarchie. Der Monarch war am Ende und mit ihm die Monarchie.
Dabei hätte es Alternativen gegeben. Noch wenige Stunden vor der Flucht wollte Wilhelm auf seinem Posten ausharren, selbst wenn er von den Feinden totgeschlagen würde. Er dachte schon darüber nach, an der Spitze seines Heeres zurück nach Berlin zu marschieren und dort die Revolution niederzuwerfen. Seine Generäle erklärten ihm aber, dass die Armee nicht mehr treu zum Kaiser stehe. Einige Berater hatten daher einen anderen Plan, der heute kaum noch bekannt ist: Wilhelm II. sollte mit einem kleinen Trupp Getreuer an die Front gehen und dort den »Heldentod« sterben. Das, so die Hoffnung, würde die Monarchie vielleicht noch retten können. Denn ein Kaiser, der sich zum Wohle des Vaterlandes opferte, würde dadurch sicher die Hochachtung und Solidarität seines Volkes und seiner Armee zurückerlangen. Hinter dem lebenden Kaiser wollten sich die Deutschen nicht mehr versammeln, aber hinter einem toten, als Held gestorbenen Kaiser hätten sie das möglicherweise getan. Mancher hoffte sogar, dass das Heer, von einem solchen symbolisch-heroischen Akt inspiriert, noch einmal alle verbliebenen Kräfte mobilisieren werde und dadurch die Front so lange werde halten können, bis die politische Führung akzeptable Bedingungen für einen Waffenstillstand ausgehandelt habe. Die anschließenden Friedensverhandlungen hätten dann mehr oder weniger auf Augenhöhe stattgefunden.
Dazu kam es aber nicht. Im entscheidenden Augenblick kniff der Kaiser, bestieg den Zug und machte sich aus dem Staub. Dieses Verhalten war mit dafür verantwortlich, dass Wilhelm II. sehr rasch als Hauptschuldiger an der militärischen und politischen Katastrophe des Jahres 1918 identifiziert wurde. War der Kaiser nicht immer schon schwach gewesen? Hatte er nicht im Juli 1914 den Krieg noch verhindern wollen, sich aber gegen die Politiker und Militärs nicht durchsetzen können? Und hatte er umgekehrt nicht das Deutsche Reich überhaupt erst durch seine unkluge, wankelmütige, zwischen Schwäche und Auftrumpfen hin und her schwankende Politik in diesen Krieg hineingeführt? Hatte er nicht 1890, kaum zwei Jahre auf dem Thron, seinen Reichskanzler Bismarck entlassen und damit denjenigen fortgejagt, der für eine stabile, den Frieden sichernde Außenpolitik gesorgt hatte? Und hatte er nicht schon bald danach das Bündnis mit Russland aufgekündigt und mit der Aufrüstung der deutschen Flotte Großbritannien gegen sich aufgebracht? Hatte er nicht zudem sinistere Gestalten als Vertraute um sich versammelt, die einen ungünstigen Einfluss auf ihn ausübten? Hatte er nicht die Sozialdemokratie mit aller Gewalt unterdrückt und versucht, eine autokratische Herrschaft zu errichten, für die er sogar ein in der Reichsverfassung gar nicht vorgesehenes Gottesgnadentum in Anspruch nahm? Und hatte er nicht in seinem Größenwahn tatsächlich von langer Hand einen großen europäischen Krieg vorbereitet? Hatte er nicht zum Beispiel schon in tiefen Friedenszeiten die Messer gewetzt, als er 1900 in Bremerhaven seine martialische »Hunnenrede« hielt? Hatte er dadurch nicht den anderen europäischen Großmächten letztlich keine Wahl gelassen als sich gegen Deutschland und Österreich zu verbünden? Der Fall schien klar und scheint es bis heute: Wilhelm II. war ein Versager auf dem Thron, der Deutschland und Europa ins Unglück stürzte.
Wagen wir aber einmal ein Gedankenspiel: Was wäre gewesen, wenn der Kaiser im November 1918 nicht geflohen wäre? Wenn er die Abdankung verweigert hätte? Wenn er tatsächlich auf diejenigen Berater gehört hätte, die ihm den Königstod an der Front empfahlen? Wenn die Monarchie nicht so sang- und klang- und vor allem nicht kampflos untergegangen wäre? Hätte man sich dann nicht mit großer Wahrscheinlichkeit an einen ganz anderen Wilhelm II. erinnert? An einen Kaiser, der als junger Mann den Thron bestieg und das deutsche Kaiserreich zu einem modernen, aufstrebenden Staat machte? Der die technische Modernisierung vorantrieb und Deutschland im Wettbewerb der Industrienationen an die erste Stelle führte? Der ein Förderer von Kunst und Wissenschaft war, unter dessen Herrschaft ein Universitätswesen entstand, um das die Deutschen von aller Welt beneidet wurden? Der sich um die Integration derjenigen gesellschaftlichen Gruppen besonders bemühte, die im »Heiligen Evangelischen Reich deutscher Nation«1 bislang außen vor geblieben waren, vor allem Arbeiter, Katholiken und Juden? Der freundlich, zugewandt und vielseitig interessiert war – und überdies viel intelligenter als sein Vetter Nikolaus und viel gewinnender als seine Großmutter Victoria, die auf dem russischen beziehungsweise dem britischen Thron saßen? Der sich immer ehrlich um die Wahrung des Friedens in Europa bemüht hatte? Und der schließlich, als im Sommer 1914 der Krieg unausweichlich war, das erlösende, die allgemeine Stimmung treffende Wort sprach: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche«2?
Es wird vielleicht nicht jeder dieses Gedankenspiel mitmachen wollen. Aber ist es so abwegig, das Ende der Monarchie in Deutschland einmal nicht nur zu feiern, sondern auch daran zu erinnern, was dadurch verlorenging? Denn die Zeit, die in Europa nach dem 9. November 1918 anbrach, war alles andere als eine Blütezeit. Die demokratische Republik, die 1919 in Deutschland gegründet wurde, hielt gerade einmal vierzehn Jahre. Zu den Faktoren, die dafür verantwortlich sind, gehört auch, dass ein großer Teil des Volkes die parlamentarische Demokratie als ein von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs aufgezwungenes System ablehnte. Ähnliches gilt für Österreich, dessen monarchische Staatsform ebenfalls infolge der Niederlage im Ersten Weltkrieg abgeschafft wurde. Italien und Spanien wurden zu Beginn der 1920er Jahre Diktaturen, Russland war dies schon während des Krieges geworden. Und auch in der parlamentarischen Monarchie Großbritannien und der Republik Frankreich waren in der Zwischenkriegszeit große Teile der politischen und intellektuellen Eliten von der Schwäche der Demokratie überzeugt und befürworteten stattdessen die neuen, auf das Charisma des »Führers« setzenden Formen der Diktatur. Das, was dem Sturz der Monarchie in Deutschland unmittelbar folgte, bot also keinerlei Grund, übermäßig zufrieden zu sein.
Hat also der Erste Weltkrieg, die »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«3, möglicherweise nicht nur der deutschen Monarchie, sondern auch der Geschichte Europas insgesamt einen entscheidenden Schlag versetzt? War der Erste Weltkrieg vielleicht der »falsche Krieg«, wie der schottische Historiker Niall Ferguson meint? Falsch, weil er alles andere als unvermeidlich war und man ihn in jedem Fall besser vermieden hätte, falsch aber auch, weil Großbritannien sich niemals am Krieg hätte beteiligen dürfen? Und falsch schließlich, weil die falsche Seite ihn gewonnen hat: »Wäre der Erste Weltkrieg nie ausgefochten worden, dann hätte die Konsequenz schlimmstenfalls so etwas wie ein erster kalter Krieg sein können, in dem die fünf Großmächte weiterhin große Streitkräfte unterhielten, ohne jedoch ihr eigenes nachhaltiges ökonomisches Wachstum zu bedrohen. Wenn man andererseits einen Krieg geführt hätte, aber ohne Beteiligung Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, dann hätten die siegreichen Deutschen wohl acht Jahrzehnte vor der Zeit eine Version der Europäischen Union geschaffen.«4
Vor allem deutsche Historiker mögen solche »Was wäre wenn«-Gedankenspiele nicht. Denn sie führen in den heiklen Bereich der kontrafaktischen Geschichte, wo alternative historische Abläufe diskutiert werden. Das passt nicht zum Selbstverständnis des Historikers, ein »rückwärts gekehrter Prophet«5 zu sein, also genau erklären zu können, wieso etwas so gekommen ist, wie es gekommen ist, ja wieso es genau so kommen musste. Lange Zeit war unter Historikern beispielsweise die Auffassung verbreitet, Deutschland habe in der Moderne einen »Sonderweg« eingeschlagen, habe sich vom Rest Europas abgesondert, sei weniger liberal, weniger sozial, weniger demokratisch, eben weniger »modern« gewesen als England oder Frankreich, und dieser Sonderweg sei dafür verantwortlich, dass Deutschland die Welt in zwei katastrophale Weltkriege gestürzt habe. »From Luther to Hitler«6 lautete der Titel eines in den USA um 1945 verbreiteten Buches, und selbst diejenigen, die nicht bereit waren, die Wurzel des deutschen Übels schon in der Reformation zu erblicken, hatten doch nichts einzuwenden gegen die Auffassung, dass das deutsche Kaiserreich eine Unglücksepisode gewesen sei und der Weg dann eben nicht von Luther, sondern von Bismarck oder zumindest von Wilhelm II. zu Hitler führe.
Aber solche Vorstellungen ignorieren, dass Geschichte ein offener Prozess ist. Man tut einer Epoche Unrecht, wenn man sie nur danach beurteilt, was ihr folgte, und wenn man dabei ignoriert, dass es immer auch anders hätte kommen können. Gerade das wäre doch eine wichtige Aufgabe des Historikers: »der Vergangenheit wiedergeben, was sie einmal hatte, was jede Zeit und auch unsere Gegenwart hat, nämlich eine offene Zukunft«.7
Dieses Buch möchte der deutschen Monarchie von 1918 die offene Zukunft zurückgeben. Es fragt nach dem Ende der Monarchie in Deutschland und nach der Bedeutung der Monarchie in der Moderne. Die aktuelle Monarchieforschung ist nämlich geeignet, neues Verständnis für ihren Gegenstand zu wecken. Sie hat längst aufgehört, die Monarchie als überlebte, anachronistische, vormoderne Institution zu verstehen. Sie hat vielmehr gezeigt, wie erstaunlich wandlungs- und anpassungsfähig die Monarchie in Europa im 19. und 20. Jahrhundert gewesen ist. Im 19. Jahrhundert suchten die meisten Monarchen ihre Aufgabe erfolgreich darin, ihre Nation symbolisch zu repräsentieren. Im 20. Jahrhundert konnte die Monarchie in denjenigen Staaten, die sie sich bewahrt hatten, Kontinuität und Tradition sicherstellen. Für das 21. Jahrhundert scheint dasselbe zu gelten, und die Monarchie erfreut sich dort, wo sie noch existiert, eher zunehmender Beliebtheit.
Dies ist Grund genug, einmal die letzte Monarchie in Deutschland und ihr Ende genauer unter die Lupe zu nehmen. Es zeigt sich dann, dass das deutsche Kaiserreich keineswegs der Schurkenstaat gewesen ist, als den ihn so viele Historiker gesehen haben. Es zeigt sich dann außerdem, dass das Ende der Monarchie in Deutschland keineswegs zwangsläufig war. Und dass es sehr voreilig wäre, dieses Ende einfach zu bejubeln. Eher scheint es, als seien Staaten wie Dänemark und Schweden, Norwegen und Großbritannien, Spanien und die Niederlande um ihre intakten Monarchien zu beneiden, die ihnen in der Gegenwart und für die Zukunft mehr Vorteile bieten als erwartet.
Moment! Will hier wirklich ein Historiker im 21. Jahrhundert eine Rückkehr Deutschlands zur Monarchie empfehlen? Nein, das nicht. Aber deutlich werden soll in diesem Buch doch, dass die Monarchie nicht einfach zu den Themen gehört, die heutzutage nur noch in Boulevardmagazinen behandelt werden sollten und jedenfalls nicht ernst genommen werden müssten. Jahrzehntelang hat man hierzulande keinen Sinn gehabt für den Wert von Repräsentation und Tradition. Das war ein Fehler. Ein Fehler, der behoben gehört. Um dies in Angriff zu nehmen, muss man nicht gleich zum Monarchisten werden, zumal die Wiederherstellung einer verlorenen Monarchie nahezu aussichtslos ist, selbst dann, wenn man diese wünschen sollte. Aber trotzdem kann man mit gutem Grund bedauern, dass die deutsche Monarchie 1918 verlorenging, und trotzdem kann man von den noch bestehenden und funktionierenden Monarchien einiges lernen – zum Beispiel, wie in der Demokratie die notwendige Repräsentation, die notwendige traditionale Verankerung und die notwendige hierarchische Ordnung geschaffen und erhalten werden können. Diese Dinge sind im 21. Jahrhundert nicht etwa von vorgestern, sondern sie sind hochaktuell und werden angesichts zunehmender Zersetzungsphänomene der liberalen Demokratien westlicher Prägung sogar immer wichtiger.
Dieses Buch lädt daher dazu ein, einen frischen, unvoreingenommenen Blick auf die letzte deutsche Monarchie zu werfen – und damit auch auf die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Die letzten Tage des Kaisers
Kein Königstod
Als schon alles vorbei war, im Februar 1919, veröffentlichte Wilhelm Groener in der »Kreuzzeitung« einen Artikel über die letzten Tage der Monarchie. Groener war kurz vor Kriegsende als Nachfolger Erich Ludendorffs in die Oberste Heeresleitung eingesetzt worden. In seinem Artikel vertrat er die Auffassung, dass ein freiwilliger Opfertod des Kaisers bei Kriegsende die Monarchie hätte retten können.8 Groener hatte dafür im November 1918 einen konkreten Plan entwickelt: Am 8. November sollte eine kleine Freiwilligentruppe unter Führung des Kaisers einen Angriff starten, bei dem Wilhelm fallen würde.9 Allerdings ist unwahrscheinlich, dass dieser Plan dem Kaiser überhaupt vorgetragen wurde. Groener schien zu zögern, weil er als württembergischer – nicht preußischer – General der Falsche schien, um einen solchen Vorschlag zu unterbreiten. Wilhelms Generaladjutant, Generaloberst von Plessen, bat außerdem darum, den Plan aufzugeben, weil es unverantwortlich sei, den Kaiser in Lebensgefahr zu bringen.
Es gab aber noch eine zweite Initiative zum Königstod, und die dürfte bis an das kaiserliche Ohr gedrungen sein: Der ehemalige Reichskanzler Georg Michaelis hatte zusammen mit einer ganzen Reihe pommerscher Adliger im Oktober 1918 eine Konferenz über die politische Lage abgehalten, bei der auch über die Möglichkeit des Königstodes gesprochen wurde.10 Michaelis erhoffte sich mit einem Tod des Kaisers an der Front nicht nur eine Rettung der Monarchie, sondern auch eine Solidaritätswelle mit dem Kaiser, eine neue Kampfbereitschaft und somit ein innenpolitisches und militärisches Durchhalten bis zur Aushandlung akzeptabler Waffenstillstandsbedingungen. Michaelis sprach am 28. Oktober bei der Kaiserin vor und empfahl eine Abdankung des Kaisers, leitete aber über die Oberhofmeisterin auch die darüber hinausgehende Bitte an die Kaiserin weiter, der Kaiser solle an der Front fallen.11 Beim anschließenden Mittagessen unterrichtete die Oberhofmeisterin den Kaiser anscheinend von dem Plan; jedenfalls brach Wilhelm II. das Gespräch abrupt ab.12
Die Idee des eigenen Opfergangs scheint den Kaiser in den letzten Tagen der Monarchie existentiell beschäftigt zu haben. Als am Abend des 9. November bereits alles für die kaiserliche Flucht nach Holland organisiert und die Abdankung in seinem Namen bereits erfolgt war, wehrte er sich gegen das Bevorstehende noch einmal mit den Worten: »Und wenn mir auch nur einige mit den Herren meiner Umgebung treu bleiben, mit ihnen kämpfe ich dann bis zum Äußersten, und wenn wir auch alle totgeschlagen werden – vor dem Tode habe ich keine Angst! Nein, ich bleibe hier!«13 Im Rückblick hat der Kaiser den Königstod zwar mit dem Hinweis auf dessen Nutzlosigkeit abgelehnt und auf seine christliche Überzeugung verwiesen, die einen Selbstmord ausschließe. Die Vorstellung vom Opfergang aber wirkte bei ihm weiter, da er nun nicht die Königstod-Option, sondern gerade seine Flucht ins holländische Exil als einen solchen deutete.14
Der aus der Jugendbewegung kommende Schriftsteller Hans Blüher, der den Kaiser im Exil besuchte, fügte in seinen eigenen Erinnerungen dieser Erklärung noch hinzu, dass nur das Überleben dem Kaiser die Möglichkeit bot, selbst Rechenschaft über das eigene Tun abzulegen. Feige sei Wilhelm II. sicher nicht gewesen, aber zum Selbstmord unfähig, und zwar aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur sowie seines christlichen Glaubens. Da ein Abrücken von seiner religiösen Überzeugung für Wilhelm II. unmöglich war, so Blüher, musste er zwangsläufig die Erwartung eines Königstodes an der Front enttäuschen: »Man erwartete ein heidnisches Tun, und das wäre der Lage in der Tat mehr gerecht gewesen.«15
Viele Historiker sind dagegen der Meinung, die von Wilhelm II. und seinem Gefolge erwogenen alternativen Handlungsoptionen im November 1918 seien Ausdruck von »Realitätsverlust«16, und das gelte besonders für den Königstod. Aber wieso eigentlich? Schließlich hatte Wilhelm II. in Friedenszeiten nach Kräften eine Erwartungshaltung befördert, die einen solchen Schritt im äußersten Fall tatsächlich nahelegte. Sein vielfach vorgetragener Anspruch, ein »persönliches Regiment« zu führen und die Fäden der Politik in der eigenen Hand zu halten, sein vielbeschworenes »Säbelrasseln« in öffentlichen Reden, sein Beharren auf einem herrscherlichen Gottesgnadentum und einer damit verbundenen besonderen persönlichen Verantwortung waren eben nicht ohne Folgen geblieben. Zu den mit großem Aplomb vorgetragenen Äußerungen des Kaisers gehörten auch solche wie diejenige von 1891 bei der Verleihung neuer Feldzeichen: »Was auch immer kommen möge, wir wollen unsere Fahnen und Traditionen hochhalten, eingedenk der Worte und Taten Albrecht Achilles’, welcher gesagt hat: ›Ich kenne keinen reputierlicheren Ort zu sterben als in der Mitte meiner Feinde.‹ Dies ist auch meine Herzensmeinung.«17
Diejenigen, die nun vom Kaiser den Königstod erwarteten, konnten sich damit außerdem nicht nur auf dessen eigene Äußerungen berufen, sondern auch auf entsprechende monarchische Traditionen, die mindestens im Falle Friedrichs des Großen, der mehrfach bekundet hatte, im Falle einer militärischen Niederlage aus Pflichtgefühl den Tod zu wählen, auch in Preußen vorhanden waren. Die Wirkungen eines solchen fürstlichen Heroismus reichen bis ins 20. Jahrhundert: Als 1940 in Sanssouci 50.000 Menschen dem Enkel Wilhelms II. die letzte Ehre erwiesen, nachdem dieser in Frankreich schwer verwundet worden und im Lazarett gestorben war, verkündete Hitler den sogenannten Prinzenerlass, der es Mitgliedern regierender Fürstenhäuser verbot, an Fronteinsätzen teilzunehmen.
Was im November 1918 allerdings tatsächlich einer Umsetzung der Königstod-Idee im Wege stand, waren die praktischen Unwägbarkeiten. Den erfahrenen Militärs im kaiserlichen Hauptquartier musste klar sein, dass es angesichts der faktischen Beendigung der Kampfhandlungen für einen Tod des Kaisers bei einem Frontangriff eigentlich schon zu spät war. Noch schwerer wog, dass ein hohes Risiko bestand, dass der Plan schiefgehen und der Kaiser nicht fallen, sondern vom Feind gefangengenommen werden würde. Dies aber hätte einen enormen Propagandaerfolg der Gegenseite bedeutet und dem Kaiser wohl das Schicksal beschert, öffentlich zur Schau gestellt, gedemütigt, zum Tode verurteilt und schließlich hingerichtet zu werden. Nur eine sehr sorgsame Vorbereitung und eine ebenso sorgsame Durchführung hätten das Risiko eines Königstod-Unternehmens minimieren können. Dafür aber hätte der Kaiser dem Plan ohne Wenn und Aber zustimmen müssen. Stattdessen schwankte er zwischen mehreren Optionen hin und her, glaubte noch bis zum Abend des 9. November 1918, er könne an der Spitze seiner Armee nach Berlin zurückkehren und die dort ausbrechende Revolution niederschlagen – und trat in der Nacht vom 9. auf den 10. November dann doch die Flucht an.
Ein Traum zerplatzt
Keine sechs Wochen zuvor wähnte sich Wilhelm II. auf seinem Thron ziemlich sicher. Zwar war die deutsche Frühjahrsoffensive 1918 steckengeblieben, zwar hatte man am 8. August, dem »schwarzen Tag des deutschen Heeres«18, einen Fronteinbruch hinnehmen müssen, aber die militärische Lage schien sich danach wieder zu stabilisieren, und die Oberste Heeresleitung sendete eher zuversichtliche Signale. Erst als im September der Verbündete Bulgarien zusammenbrach, änderte sich dies. Am 29. September 1918 sprachen die Generäle Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff bei Wilhelm II. vor. Die beiden Leiter der Obersten Heeresleitung erklärten dem Kaiser zum ersten Mal, dass der Krieg, der im Sommer 1914 begonnen hatte, nicht mehr zu gewinnen sei.
Ausgerechnet der 29. September! Der Tag des Erzengels Michael, des Anführers der himmlischen Heerscharen, des Drachentöters, des Schutzpatrons der Deutschen und Lieblingsheiligen Wilhelms II.! In seiner Regierungszeit hatte Wilhelm alles versucht, um seinen Untertanen Sankt Michael als Nationalheiligen wieder ins Bewusstsein zu führen. Wilhelms Vorbild waren hierbei wie in vielem anderen auch die Engländer, die mit Sankt Georg, dem anderen großen christlichen Drachentöter, bereits einen Nationalheiligen besaßen. Die Sankt-Georgs-Fahne, das rote Kreuz auf weißem Grund, war die Nationalflagge Englands, der Sankt-Georgs-Tag, der 23. April, ein englischer Feiertag, die englischen Truppen kämpften unter dem Schutz Sankt Georgs, und die englischen Boy Scouts eiferten ihm nach, jenem christlichen Heiligen, der der Legende zufolge die Jungfrau gerettet, die Stadt befreit und den Drachen getötet hatte und der zum Vorbild für die christlichen Ritterorden des Mittelalters geworden war. Mit Sankt Michael hatten auch die Deutschen einen Nationalheiligen, sogar auch einen Drachentöter, aber sie schienen das längst wieder vergessen zu haben. Hatten nicht schon die frisch bekehrten germanischen Stämme Sankt Michael wegen seines kriegerischen Charakters in besonderer Weise verehrt? Hatte man nicht an den Orten, wo die dem heidnischen Kriegsgott Wotan geweihten Heiligtümer gestanden hatten, vorzugsweise Michaelskirchen errichtet? War es nicht Karl der Große gewesen, der den Michaelstag, den 29. September, als Feiertag im ganzen Heiligen Römischen Reich festgelegt hatte? War nicht Otto der Große 955 mit einer Michaelsfahne in die berühmte Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn gezogen? Und hatte nicht Heinrich VI. die Michaelsfahne, ein weißes Kreuz auf rotem Grund, als Reichsfahne eingeführt? Vor allem aber: Hatte nicht schon der Großonkel Wilhelms II., der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV., gemeinsam mit Friedrich Schinkel und anderen daran gearbeitet, Sankt Michael den Deutschen wieder bekannt zu machen?
Wann immer Wilhelm II. ein Denkmal zu stiften, ein Kunstwerk zu fördern oder das Bildprogramm einer Kirche auszuwählen hatte, war Sankt Michael sein Lieblingsmotiv. Ob als Mosaik in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ob als Statue für das Hohenzollern-Mausoleum in Charlottenburg, ob als Denkmal für die Gefallenen des 1. Garderegiments zu Fuß in Saint Privat, ob auf Bildern, die der Kaiser massenhaft verbreiten ließ: Überall begegnete man dem Erzengel. Besonders gern wählte Wilhelm II. ein Motiv, das Sankt Michael ohne den Drachen zeigte, nur mit dem Flammenschwert in der Hand, nicht zum Angriff, sondern zur Verteidigung bereit, durch seine Stärke den Frieden sichernd. Ein vom Kaiser entworfenes, unzählige Male reproduziertes und sogar an den russischen Zaren verschicktes Bild zeigte Sankt Michael inmitten von Frauengestalten, welche die europäischen Nationen verkörpern, die sich zur Verteidigung auf einem Hügel versammeln, während sich aus dem Osten eine drohend-dunkle Wolke nähert, in dessen Mitte sich die Umrisse einer Buddha-Figur abzeichnen. Wilhelm wollte damit vor der »gelben Gefahr« warnen, vor der für die Zukunft befürchteten Weltmachtstellung Ostasiens. Wilhelms in der Figur Sankt Michaels versinnbildlichte Antwort darauf war eine wehrhaft christliche europäische Friedensordnung – unter deutscher Führung.
Wenn man sich die Bildmotive deutscher Künstler des Wilhelminismus ansieht, vor allem aber wenn man sich die Bildmotive der deutschen Kriegspropaganda ansieht, dann scheint es, als hätte der Kaiser mit seinem Versuch, den Deutschen ihren Nationalheiligen wieder in Erinnerung zu rufen, Erfolg gehabt. Sankt Michael findet sich um die Jahrhundertwende in den Werken von Fidus, Franz Stassen, Ludwig Thoma, Sascha Schneider, Friedrich Kaulbach und anderen Künstlern. Und kaum ein Motiv war auf Kriegspostkarten so beliebt wie das des Drachentöters. Auf diesen Postkarten war Michael allerdings weniger friedlich als auf den vom Kaiser verbreiteten Darstellungen, hier war er im Kampf mit dem Drachen zu sehen, denn nun war der Frieden, den der Erzengel schützen sollte, vorbei, nun war der Kampf ausgebrochen, aber er richtete sich nicht gegen die Gefahr im Osten, sondern gegen die anderen europäischen Mächte, zur Selbstverteidigung und zur Wahrung eines deutschen Führungsanspruches in Europa. 1917 schrieb der Kaiser dem deutsch-christlichen Schriftsteller Houston Stewart Chamberlain: »Jetzt wird es dem deutschen Michel mit einemmal klar, daß der Kampf für ihn zum Kreuzzug geworden und daß er jetzt St. Michael geworden ist.«19 Sankt Michael wurde während des Krieges für den Kaiser zum Symbol für die existentielle Dimension der Auseinandersetzung. Wilhelm II. und »seine Deutschen« fühlten sich von ihren Gegnern im Grundsätzlichen herausgefordert und kämpften um ihre eigene kulturelle, geistige und religiöse Existenz. Es ging nicht mehr um Gebietserweiterungen oder Kolonien, sondern es ging längst um alles oder nichts. Und ausgerechnet am Michaelstag, dem 29. September 1918, erfuhr der Kaiser, dass alles vorbei sei. Man hatte den Existenzkampf geführt und ihn verloren.
Wilhelm nahm die Nachricht erstaunlich gefasst auf. Und er leitete wie selbstverständlich diejenigen Maßnahmen ein, die nun notwendig waren. Zuerst gab er den Befehl, den Feind um einen Waffenstillstand zu bitten. Genau so wichtig aber war es, das deutsche Volk über die Situation zu informieren. Die Kriegspropaganda hatte bis zuletzt die Hoffnungen auf einen siegreichen Ausgang des Krieges geschürt. Die Nachricht von der bevorstehenden Niederlage würde ein Schock sein, und angesichts der harten Entbehrungen während der letzten Kriegsjahre könnten Unruhen ausbrechen. Besonders wichtig schien es daher, die Verantwortlichkeiten neu zu sortieren. Wilhelm II. verkündete gleich mehrfach öffentlich, dass das deutsche Volk in Zukunft stärker als bisher »an der Gestaltung seiner Geschicke«20 mitwirken solle. Obwohl er nicht konkret sagte, was das bedeutete, dürften die meisten dabei an die Osterbotschaft des Kaisers von 1917 gedacht haben, in der er für die Zeit nach dem Krieg Verfassungs- und Wahlrechtsreformen versprochen hatte, die auf eine Demokratisierung der Monarchie hinausliefen. Außerdem mussten eine neue Regierung gebildet und ein neuer Reichskanzler gefunden werden. Der amtierende Kanzler, Georg von Hertling, konnte angesichts der Lage nicht im Amt verbleiben und erklärte am 30. September seinen Rücktritt. Einen Nachfolger zu finden, der die schwere und undankbare Aufgabe übernehmen würde, die Waffenstillstandsverhandlungen zu führen, war aber nicht einfach. Ludendorff, der beim Kaiser nachfragte, ob ein neuer Kanzler bereits gefunden sei, erhielt von Wilhelm zur Antwort: »Ich kann doch nicht zaubern!«21
Dabei dauerte die Suche nur bis zum 3. Oktober. An diesem Tag wurde der Liberale Prinz Max von Baden neuer Reichskanzler. Er bildete die erste deutsche Regierung, an der auch Sozialdemokraten beteiligt waren. Am 4. Oktober übermittelte die neue Regierung das Gesuch um Waffenstillstand an den US-Präsidenten Woodrow Wilson. Außerdem beschloss man eine Änderung der Reichsverfassung: Der Kanzler sollte ab sofort nicht mehr dem Kaiser, sondern dem Reichstag verantwortlich sein, und anstelle des Kaisers sollten fortan die Minister den Oberbefehl über die Streitkräfte innehaben. Diese Änderungen traten am 28. Oktober 1918 in Kraft. Damit war die konstitutionelle Monarchie in Deutschland beendet, an ihre Stelle war eine parlamentarische Monarchie getreten – die aber ihrerseits nur wenige Tage bestehen sollte.
Die Wirkungen der Kriegspropaganda
Die neue Regierung unter Max von Baden berief sich in ihrem Waffenstillstandsgesuch vom 4. Oktober 1918 auf die vierzehn Punkte, die der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson im Januar 1918 als Richtlinien für eine künftige Friedensordnung veröffentlicht hatte. Die vierzehn Punkte umfassten unter anderem ein Ende der Geheimdiplomatie, Freiheit der Meere und des Handels, eine allgemeine Abrüstung, eine Neuordnung Europas, die neben der staatlichen Integrität vor allem das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker achten sollte, sowie die Gründung eines Völkerbundes. Als Wilson die vierzehn Punkte im Januar vorgetragen hatte, hatte die Oberste Heeresleitung sie abgelehnt, weil sie die Friedensverhandlungen störten, die Deutschland zu diesem Zeitpunkt mit Russland führte. Nun aber erschienen die vierzehn Punkte als Alternative zur bedingungslosen Kapitulation, als eine letzte Aussicht auf einen Verständigungsfrieden, und deshalb berief man sich nun auf sie.