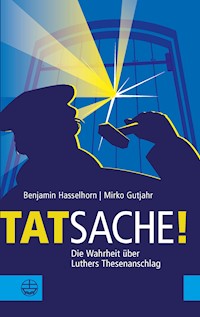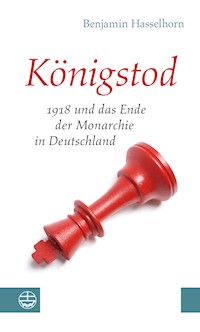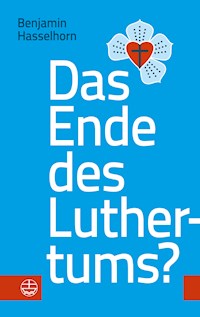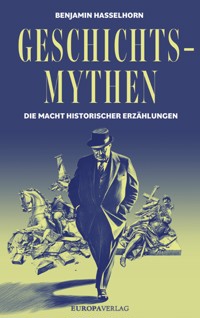
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erzählungen über die Vergangenheit bestimmen unser kulturelles Gedächtnis und prägen unsere Gegenwart. Ob Churchill als »Retter der freien Welt«, Jeanne d'Arc als Beschützerin Frankreichs oder die Resistenza als antifaschistische Gründung Italiens: Geschichtsmythen sind auch in unserer vermeintlich aufgeklärten Welt allgegenwärtig. In seinem bahnbrechenden Werk Geschichtsmythen fragt Benjamin Hasselhorn: Wie entstehen diese Mythen? Welche Mechanismen sichern ihren Erfolg? Welche Rolle spielen sie im kollektiven Gedächtnis und wie formen sie unsere gesellschaftliche Identität? Und vor allem: Können Mythen entkräftet oder gar beseitigt werden? In einer Zeit, in der Mythen unsere Identität prägen und in hitzigen Debatten weiterleben, liefert Geschichtsmythen einen scharfsinnigen Blick auf die Erzählungen, die uns immer wieder neu definieren, und zeigt auf, warum sie bis heute politische und gesellschaftliche Macht ausüben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BENJAMIN HASSELHORN
GESCHICHTS-MYTHEN
DIE MACHT HISTORISCHER ERZÄHLUNGEN
1. eBook-Ausgabe 2025
1. Auflage
© 2025 Europa Verlag in der Europa Verlage GmbH, München Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Layout & Satz: Margarita Maiseyeva
Redaktion: Franz Leipold
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN:978-3-95890-649-5
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für Produktsicherheit
Europa Verlage GmbH
Monika Roleff
Johannisplatz 15
81667 München
Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0
E-Mail: [email protected]
www.europa-verlag.com
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1 GRUNDLEGUNG EINER GESCHICHTS-MYTHENFORSCHUNG
DIE NÄHE DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT ZUM MYTHOS
Auch Historiker erzählen
Warum der Konstruktivismus keine Lösung ist
Was die Geschichtswissenschaft vom Mythos unterscheidet
MYTHEN VERSTEHEN – EIN BLICK AUF DIE FORSCHUNG
Die Unverzichtbarkeit von Mythen
Forschungsansätze in der Geschichtswissenschaft
GESCHICHTSMYTHEN ERFORSCHEN – EIN NEUER ANSATZ
Was macht einen Geschichtsmythos aus?
Wie erforscht man Geschichtsmythen?
Welche Arten von Geschichtsmythen gibt es?
Kapitel 2 WIE ENTSTEHT EIN GESCHICHTSMYTHOS?
GEMACHTE MYTHEN: »WILHELM DER GROSSE«
SPONTANE MYTHEN: DER BISMARCK-MYTHOS
ERGEBNIS: DAS SINNBEDÜRFNIS IST ENTSCHEIDEND
Kapitel 3 WIE WANDELBAR SIND GESCHICHTS-MYTHEN?
WANDEL INNERHALB EINER GESELLSCHAFT: DER LUTHER-MYTHOS
WANDEL DURCH TRÄGERWECHSEL: DER JEANNE D’ARC-MYTHOS
ERGEBNIS: DER KAUM WANDELBARE KERN
Kapitel 4 MYTHENKÄMPFE
UMKÄMPFTE MYTHEN: DIE BEFREIUNGSKRIEGE
BEKÄMPFTE MYTHEN: DIE RESISTENZA
ERGEBNIS: EIN VITALER MYTHOS IST UMKÄMPFT
Kapitel 5 HEISSE UND KALTE
MYTHENWANDEL DURCH WISSENSCHAFT? LUTHERS THESENANSCHLAG
WISSENSCHAFT IM MYTHENKAMPF: DIE RESISTENZA
WIRKUNGSLOSE MYTHENKRITIK: DIE BEFREIUNGSKRIEGE
CHURCHILL UND DIE UNZERSTÖRBARKEIT LEBENDIGER MYTHEN
ERGEBNIS: MYTHEN VERSCHWINDEN NICHT DURCH WISSENSCHAFT
Kapitel 6 FAZIT
Dank
Quellen- und Literaturverzeichnis
ARCHIVALISCHE QUELLEN
PUBLIZIERTE QUELLEN
Zeitungen
Filme und TV-Sendungen
Weitere publizierte Quellen
LITERATUR
ANMERKUNGEN
PERSONENREGISTER
Einleitung
»Nichts ist zarter als die Vergangenheit;
Rühre sie an wie ein glühend Eisen:
Denn sie wird dir sogleich beweisen,
Du lebest auch in heißer Zeit.«1
Wir sind von Geschichtsmythen umzingelt. Von Putins glorifizierender Geschichtspolitik des »Großen Russlands« bis zur Suche der Europäischen Union nach einer verbindenden Europa-Erzählung, von der Identifikation Wolodymyr Selenskyjs mit dem »Retter der freien Welt« Winston Churchill bis zur umstrittenen Reinszenierung der französischen Geschichte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris 2024, von der neuen Auseinandersetzung um die Werte des Westens zwischen der US-Regierung und den EU-Staaten bis zu den regelmäßigen Parallelen, die zwischen der gegenwärtigen politischen Lage in Deutschland und dem Niedergang der Weimarer Republik gezogen werden: Bestimmte Vorstellungen über die Vergangenheit prägen unsere Sicht auf die Gegenwart, bieten uns Orientierung und manchmal sogar ein konkretes Handlungsziel.
Dabei ist der Rückgriff auf die Vergangenheit keineswegs harmlos. Im Januar 2020 griffen Vermummte auf dem Campus der Jawaharlal-Nehru-Universität (JNU) in Indien Studenten und Dozenten an. Romila Thapar, Althistorikerin und emeritierte Professorin der JNU, machte die hindunationalistische Ideologie der indischen Regierungspartei, die in der JNU einen Hort des Kommunismus erblicke, für die Angriffe verantwortlich. Diese seien Teil eines seit Längerem zu beobachtenden Versuchs der Regierung, die Geschichte Indiens durch hindunationalistische »Mythen«2 zu ersetzen. Thapar forscht selbst über Geschichte als Mittel zur Identitätsstiftung.3 Sie lehnt diese Funktion von Geschichte nicht prinzipiell ab, plädiert aber dafür, Geschichte exakt und wissenschaftlich sauber zu rekonstruieren, bevor man aktualisierende Schlussfolgerungen ziehe. Wer das nicht tue und – wie beispielsweise die indische Regierungspartei – sogar Geschichtsbücher ideologisch umschreibe, verbreite Mythen.
Von einem ähnlichen Gegensatzverhältnis zwischen Mythos und Geschichte geht der Historiker Andreas Wirsching aus, wenn er von der zeitgeschichtlichen Forschung fordert, in die politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart vor allem ihre Wissenschaftlichkeit einzubringen:
»Gerade in ihrer zweckfreien Zuwendung zur Vergangenheit demonstriert Zeitgeschichte die Komplexität der Gegenwart und weist auf die Offenheit einer im Kern unverfügbaren Zukunft hin. Sie dekonstruiert Erfolgsgeschichten ebenso wie Niedergangsnarrative, dechiffriert Mythen und Legenden.«4
Die Auffassung Thapars und Wirschings über das Gegensatzverhältnis von Mythos und historischer Wirklichkeit dürfte typisch für die Verwendung des Mythosbegriffs in einem großen Teil der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft sein. Ein entsprechender Begriffsgebrauch ist schon bei Herodot nachweisbar, der die Herakles-Geschichte als »Mythos« bezeichnete und damit meinte, sie habe keine faktischen Grundlagen.5 In der Moderne beförderten zwei Entmythologisierungsschübe im Namen aufgeklärter Wissenschaftlichkeit diese Sichtweise. Der erste Schub setzte mit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein und führte zur Ausbildung einer auch in der Geschichtswissenschaft empirisch orientierten wissenschaftlichen Methodologie, der es in erster Linie um die Ermittlung historischer Realität und höchstens in zweiter Linie um normative Sinnentwürfe ging. Im Hintergrund dieser Entwicklung stand ein letztlich teleologisches Konzept eines Erkenntnisfortschritts »vom Mythos zum Logos«6. Mythen wurden in diesem Sinne als Überbleibsel veralteter beziehungsweise unwissenschaftlicher Wissens- und Glaubensbestände betrachtet.
Der zweite Entmythologisierungsschub setzte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Es handelte sich dabei vornehmlich um eine Reaktion auf die offensive Nutzung von Mythen durch die politischen Totalitarismen, insbesondere auf die Versuche von Faschismus und Nationalsozialismus, eine »mythische Moderne«7 zu schaffen. Nicht nur im Marxismus galten Mythen als Teile eines aufgrund seiner fatalen politischen Folgen abzulehnenden »Irrationalismus«8. Dem Missbrauch und der Übersteigerung traditioneller und nationaler Mythen durch die totalitären und diktatorischen Regime setzte die Geschichtswissenschaft eine betont mythenkritische, nüchterndistanzierte Forschung entgegen. Mythen galten in erster Linie als Gegenstand der Entlarvung und wurden der durch wissenschaftliche Forschung ermittelten historischen Realität scharf gegenübergestellt.
Auch die unter dem Stichwort »Konstruktivismus« zusammengefassten postmodernen Theorien haben trotz ihrer Stoßrichtung gegen empirisch-rationalistische Ansätze auf eine Weise Eingang in die Geschichtswissenschaft gefunden, die den Trend zur Entmythologisierung zunächst verstärkte, nämlich im Sinne einer enthüllenden Dekonstruktion traditioneller politischer wie historischer »Mythen«. Ausdrücklich wird heute der Geschichtswissenschaft der Zweck zugeschrieben, dabei zu helfen, »Mythen zu entlarven und so der Instrumentalisierung von Geschichte entgegenzuwirken«.9 Die Auffassung, dass Mythen wesentlich dadurch gekennzeichnet seien, dass »ein eindeutig feststellbarer Widerspruch zwischen einem historisch als real definierbaren Vorgang und seiner ganz anderen Verarbeitung in der späteren kollektiven Erinnerung feststellbar ist«10, ist nach wie vor verbreitet. Noch plakativer drückt es ein im Sommer 2024 von der Universität Jena gestartetes Projekt gegen Geschichtsrevisionismus aus: »Geschichte statt Mythen«.11
Trotz der Wucht der Entmythologisierungsschübe hat es allerdings immer auch Gegentendenzen gegeben, die zum Teil erhebliche Resonanz fanden. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang nicht nur auf die Romantik und ihre Einwirkung auf die Historiografie des 19. Jahrhunderts, sondern auch auf Einflüsse aus der Philosophie und Religionswissenschaft. Hinzukommt jene Selbstkritik der Aufklärung, die besonders prominent von Theodor Adorno und Max Horkheimer formuliert wurde. Adorno und Horkheimer gingen von einer »Dialektik von Mythos und Aufklärung«12 aus:
»Wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. Allen Stoff empfängt sie von den Mythen, um sie zu zerstören, und als Richtende gerät sie in den mythischen Bann.«13
Wenn diese Analyse stimmt, dann ist jeder Versuch, sich durch Dekonstruktion von Mythen zu lösen oder sie ihrer Wirksamkeit zu berauben, aussichtslos.
Insofern ist es nicht überraschend, dass es neben Historikern mit ausgesprochen mythenfeindlicher auch solche mit mythenfreundlicher Haltung gegeben hat und auch weiterhin gibt. Ein neuerer Ausgangspunkt hierfür sind die in den 1970er-Jahren entwickelten Überlegungen Hayden Whites zum historischen »Emplotment«14, zur unvermeidlichen Narrativität von Geschichtsschreibung und zur »Unmöglichkeit, zwischen den verschiedenen Betrachtungen der Geschichte […] theoretisch angemessen eine Wahl zu treffen«15, weswegen die »alleinigen Kriterien für die Bevorzugung einer vor den anderen moralischer und ästhetischer Natur«16 seien. Jedenfalls wird die Narrativität geschichtswissenschaftlicher Arbeit zum Teil ausdrücklich begrüßt: In einem neueren Entwurf zur deutschen Demokratiegeschichte etwa vertritt Hedwig Richter die Auffassung, dass nicht nur staatliche Geschichtspolitik die eigene »Demokratiewerdung in enger Verbindung mit nationalen Schlüsselereignissen und Mythen« erzähle, sondern »dass auch historische Darstellungen Erzählungen sind, für die wir einen Plot wählen und in denen wir Bösewichte und Heldinnen auftreten lassen«.17 Paula M. Marks verfolgt in ihrer Darstellung der Schießerei am O. K. Corral 1881 zwar ganz im Sinne der mythenskeptischen Position das Ziel, »fact from fiction« zu unterscheiden, will damit aber nicht etwa die Realität ermitteln, sondern möchte ein »reasonable accurate narrative of the Tombstone drama« präsentieren.18 Über die dahinterstehende Auffassung, dass auch die geschichtswissenschaftlich arbeitende Historiografie »Narrative« produziert, dürfte weitgehend Konsens bestehen.19
Eher implizit mythenfreundlich ist die Tendenz, der Geschichtswissenschaft ausdrücklich normative Urteilskompetenz zuzuschreiben. Hierfür liegt ein Ausgangspunkt in den 1970er-Jahren, als im Namen einer »Historischen Sozialwissenschaft« der Abschied von einem falschen Objektivitäts- und Neutralitätsideal gefordert wurde. Hans-Ulrich Wehler vertrat ein an einer normativ verstandenen »Modernisierungstheorie«20 orientiertes Konzept von Geschichtswissenschaft. Es ging dabei, wie Georg Iggers feststellte, darum,
»die Geschichte auf Grundlagen zu stellen, die mit den zeitgenössischen Vorstellungen von Wissenschaft, insbesondere von Sozialwissenschaft übereinstimmen, um so die Unzulänglichkeiten einer Vorstellung von Geschichtswissenschaft zu überwinden, die die geistigen Interessen und gesellschaftlichen Realitäten einer vergangenen Epoche widerspiegeln.«21
Diesem Konzept entsprechend forderte Jürgen Kocka,
»jenen Deutungen und Theorien den Vorzug geben, die bessere Chancen haben, einem Publikum mitgeteilt zu werden, denn die Mitteilung geschichtswissenschaftlicher Ergebnisse und Argumentationen ist notwendige Voraussetzung dafür, daß die Geschichtswissenschaft jene gesellschaftliche Funktion erfüllen kann, die man ihr vernünftigerweise zumuten kann und muß, wenn man sie als gesellschaftliche Veranstaltung eines relativ großen Mitteleinsatzes (Massenfach!) rechtfertigen will.«22
Ohne sich explizit auf diese Vorbilder zu stützen, spielt die Vorstellung von bewusster Normativität als Aufgabe der Geschichtswissenschaft auch heute eine Rolle. So bezeichnet etwa Andreas Wirsching die Zeitgeschichte als »Deutungswissenschaft der Gegenwart« und macht ihre Relevanz darin aus, dass sie »sich nicht um die Gegenwartsdeutung herumdrückt, sondern im Gegenteil sich offensiv in die Deutungskämpfe der Gegenwart einmischt«.23
Wo solche Einmischung in Deutungskämpfe geschieht, ist eine positiv gewendete Nutzung von Mythen oder zumindest »Narrativen« naheliegend. Schon früh waren die Warnungen vor der »Billigkeit der Mythenverachtung«24 vor allem dort zu beobachten, wo es um Geschichtspolitik ging oder zumindest um die Vermittlung historischer Forschungsergebnisse an eine nichtwissenschaftliche Öffentlichkeit, etwa in der Geschichtsdidaktik oder der konkreten historischen Bildungsarbeit anlässlich historischer Jubiläen.25 Ein prominentes Beispiel hierfür sind die beiden letzten Lutherjubiläen in Deutschland. 1983, anlässlich des 500. Geburtstags des Reformators, wurde Martin Luther in der DDR mit einem umfangreichen Ausstellungs- und Publikationsprogramm gewürdigt; Erich Honecker nannte Luther gar einen »der größten Söhne unseres Volkes«26.
In der Bundesrepublik fand eine große Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg statt, die dagegen weder auf Aktualisierung noch auf Identitätsstiftung, sondern auf distanzierte Wissenschaftlichkeit setzte. Der wissenschaftliche Leiter der Ausstellung, der Kirchenhistoriker Bernd Moeller, nannte als Ziel ausdrücklich, die Reformationszeit dem heutigen Besucher als eine »uns sehr fremde Zeit« vor Augen zu führen und Luther historisch zu kontextualisieren:
»Wir haben den Versuch unternommen, die Gestalt und das Lebenswerk Luthers in den Zusammenhang hineinzustellen, in den sie ursprünglich gehören, wir zeigen das geschichtliche Beziehungsgefüge, in das Luther hineingeboren wurde, das ihm die Voraussetzungen und Bedingungen bot zu dem, was man einen großen Mann nennt, zu werden und das er maßgebend umgestaltet hat.«27
Ein Rezensent quittierte diesen Versuch mit dem Urteil: »Nicht Objektivität ist das Ergebnis, sondern Langeweile.«28
Unveröffentlicht blieb seinerzeit eine briefliche Auseinandersetzung zwischen dem Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Günther Gillessen, und dem an der wissenschaftlichen Konzeption der Ausstellung beteiligten Historiker Hartmut Boockmann.29 Gillessen störte sich vor allem an der distanzierten Art der Ausstellungstexte, hinter der er eine kritische, ideologisch motivierte Stoßrichtung gegen die Religion überhaupt vermutete. Boockmann wies diese Vermutung zurück und verteidigte den nüchtern-distanzierten Standpunkt der Ausstellung mit dem Hinweis, es sei falsch, »dem Publikum Gefühle und Wertungen aufzunötigen«30. Gillessen antwortete:
»Wie fortgeschritten auch immer der Grad der Säkularisation in Europa erscheinen mag oder ist – der Besucher einer solchen Ausstellung sollte jedenfalls begreifen dürfen können, daß das, was er da sieht, ihn viel angeht, daß er da seiner eigenen Herkunft begegnet. Es gibt ja fast keinen Wert in unserer Zivilisation, in dem man nicht noch immer die christliche Prägeform […] erkennen könnte. […] Zuviel Distanz bedeutet auch Entwertung und Entwürdigung […]. Unser Disput geht nicht darüber, ob man anderen Wertungen aufdrängen dürfe, sondern über das Maß der Distanz. Soll vorhandene oder unterstellte Fremdheit des Publikums zum Gegenstand sich lösen können oder soll es sich in Ver- oder gar Entfremdung steigern? […] Und ist es nicht auch eine Bedingung historischer Forschung, daß der Forscher die Distanz nicht nur halten können muß, sondern auch aufgeben: daß er sich selbst in andere versetzen [kann] – die Grundlage allen Verstehens? Wie ›fremd‹ also darf eine Ausstellung über eine der großen religiösen Entscheidungen in Europa für das Publikum ausfallen?«31
Dieselben inhaltlichen Argumente – historische Kontextualisierung und wissenschaftliche Distanz auf der einen Seite, Identitätsstiftung und die Frage nach der Gegenwartsrelevanz des historischen Erbes auf der anderen Seite – spielten während des Reformationsjubiläums 2017 anlässlich des 500. Jahrestags von Luthers Thesenanschlag wieder eine Rolle; diesmal allerdings in einem öffentlich ausgetragenen Streit.32 Der damalige Vizepräsident im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Thies Gundlach, warf der theologischen Wissenschaft vor, keine konstruktive Perspektive für das Jubiläum zu besitzen. Während die »Überzeugung, in der Reformation, insbesondere in Martin Luther und seinen Anfängen, eine Substanz zu haben, die die Ängste der Gegenwart begrenzen und die Orientierungslosigkeit einhegen kann«33, vor allem jenseits von Theologie und Kirche verbreitet sei, pflegten die Wissenschaftler eine »grummelige Meckerstimmung« und »besserwisserische Ignoranz« gegenüber dem Jubiläum und spielten, wie schon in den 1980er-Jahren, die »Historisierungskarte«34:
»Will man für ein Geschichtsdatum eine aktuelle Relevanz und eine zukunftsweisende Bedeutung entfalten, sollte man nicht bei der historischen Forschung stehen bleiben. Das Risiko einer aktuellen Nutzung der Erinnerungen an die Reformation war und ist zuerst die Aufgabe und die Verantwortung der evangelischen Kirchen und ihrer Theologie, die auch gegenüber der Zivilgesellschaft sagen können muss, was an diesen historischen Ereignissen noch heute relevant ist. Dieser Aufgabe mussten sich die reformatorisch geprägten Kirchen oftmals ohne Begleitung durch die zuständige Wissenschaft stellen, und eben dies ist der Kummer vieler Kirchenleitender: Die theologische Wissenschaft kritisiert die Vorbereitung beziehungsweise Gestaltung des Jubiläums, lassen [sic!] sie aber bei einer gegenwartsbezogenen Interpretation des Jubiläums allein. Da bleibt die Frage zurück, was los ist in einer Wissenschaft, die ja im Grunde eine einzigartige Gelegenheit hätte, dieses Jubiläum zu nutzen, um einer distanzierten, vielleicht sogar skeptischen Gesellschaft die eigene Relevanz sichtbar und verständlich zu machen.«35
In einer Replik verwahrten sich der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann und der Systematische Theologe Martin Laube gegen den Wunsch, »geschichtspolitischen Voreingenommenheiten zu Dienst und Willen« zu sein, und warfen Gundlach vor, von der Wissenschaft »nichts anderes« zu wollen
»als monumentalische Geschichtsbetrachtung im Sinne des Philosophen Friedrich Nietzsche oder die Fortsetzung der DDR mit anderen Mitteln: Instrumentalisierung der Wissenschaft zum Zwecke staatlichideologischer Nützlichkeit oder kirchlicher Opportunität«.36
Zwar sei »die Frage, was uns mit der Reformation verbindet und was uns von ihr trennt«, auch für die wissenschaftliche Theologie wichtig, aber: »Nichts schützt so wirkungsvoll gegen vorschnelle Identifikationen und Instrumentalisierungen wie eine Historisierung.«37 Wer dagegen von der Wissenschaft erwarte, eine »gehaltvolle Gegenwartsdeutung der Reformation« im »Twitterformat« anzubieten, mache aus der Wissenschaft eine »Werbeagentur zur Vorbereitung staatlich-kirchlicher Eventkampagnen« und verkenne die notwendige Pluralität und Differenziertheit wissenschaftlicher Urteile und Deutungen.38
In der konkreten historischen Bildungsarbeit des Reformationsjubiläums schien sich allerdings weder die kirchliche noch die fachwissenschaftliche Position durchzusetzen, sondern eine vermittelnde. In den meisten der zahlreichen Jubiläumsaktivitäten wurde versucht, beide Anliegen – die differenzierte historische Kontextualisierung und die aktualisierende Aneignung des historischen Erbes – als prinzipiell legitim zusammenzudenken.39 In diesem Zusammenhang wurde auch auf überkommene Luthermythen zurückgegriffen; nicht nur, aber vor allem in den Werbemaßnahmen für Ausstellungen und andere Projekte.40 Das didaktische Argument für diese Praxis lautet, dass weder das zusammenhanglose Sammeln von Einzelfakten noch die reine Dekonstruktion überkommener Sinnbilder für die Ausbildung historischen Bewusstseins hinreichend ist.41 Aufgrund ihrer bildhaften Verdichtung und narrativen Eingängigkeit, aber auch aufgrund des Ziels, historisches Wissen als Bestandteil historischer Bildung zu aktualisieren, sei der Rückgriff auf Mythen vielmehr unumgänglich – umso wichtiger sei ein reflektierter Umgang mit Mythen.42
Neben der Erkenntnis der notwendigen Narrativität der Geschichtswissenschaft und den im weitesten Sinne didaktischen Argumenten für eine Nutzung von Geschichtsmythen liegt eine weitere Ursache für die Mythenrenaissance in den Langzeitkonsequenzen dekonstruktivistischer Ansätze. Diese stellen nicht nur traditionelle Geschichtsmythen infrage, sondern überhaupt die Annahme einer historischen Realität, die mithilfe einer methodisch geschulten Quelleninterpretation ermittelt werden kann. Wenn aber jede Form der Geschichtsschreibung eine Konstruktion ist, deren Realitätsgehalt nicht überprüft werden kann, dann spricht nichts dagegen, auch wieder offensiv auf normativ geprägte Narrative zurückzugreifen. Vor diesem Hintergrund scheint das Bedürfnis, alte Mythen zu dekonstruieren, weniger der Tatsache geschuldet gewesen zu sein, dass es sich dabei um Mythen handelte, sondern eher mit deren konkreten inhaltlich-normativen Implikationen zusammenzuhängen. In diesem Sinne werden dann eher alte durch neue Mythen und Narrative ersetzt – und nicht so sehr alte Mythen durch eine wissenschaftlich abgesicherte Faktizität oder gar eine »wissenschaftliche« Wahrheit. In dem Zusammenhang spielt auch eine Rolle, dass eine Dekonstruktion von Mythen gar nicht in jedem Fall zu einer quellenadäquateren Interpretation der Vergangenheit führt.43 Wenn dagegen dem dekonstruierten Mythos ein eigener, positiver Interpretationsentwurf entgegengesetzt wird, ist dieser in der Regel auf dieselbe Weise und mit denselben Mitteln dekonstruierbar wie der ursprüngliche Mythos. Es wird dann faktisch lediglich ein alter Mythos durch einen neuen Mythos ersetzt.44 Gerade diejenigen, die sich innerhalb wissenschaftlicher Debatten gegen von anderen Wissenschaftlern vertretene »Mythen« zur Wehr setzen, bestätigen damit, dass es zwischen Geschichtswissenschaft und Mythos ein besonderes Näheverhältnis gibt, das mit der Sinnstiftungsfunktion sowie mit der narrativen Struktur der historischen Erkenntnis zusammenzuhängen scheint.
Die Auseinandersetzung zwischen »Mythosfreunden« und »Mythosfeinden« liegt allerdings nicht nur an inhaltlichen Divergenzen, sondern hat auch mit begrifflicher Unschärfe zu tun. Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition, was ein Mythos oder zumindest ein Geschichtsmythos eigentlich ist. Auch existieren verschiedene Ersatzbegriffe, die entweder dasselbe Phänomen erfassen wollen oder zumindest Verwandtes bezeichnen. Dazu gehören »Erinnerungsorte«45, »Erinnerungskultur«46 und »intentionale Geschichte«47. Viele Arbeiten operieren aber auch einfach ohne genauere Definition mit dem Mythosbegriff.48 Das ist insofern problematisch, als schon die beiden häufigsten Begriffsverwendungen – der Alltagssprachgebrauch vom Mythos als verbreitetem Irrtum und der religionswissenschaftliche Begriff vom Mythos als einer »heiligen Geschichte« – weit auseinandergehen. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Mythosbegriff erfolgt in dieser Arbeit in Kapitel 1; als Arbeitsdefinition soll hier aber bereits festgehalten werden:
Ein Geschichtsmythos ist eine Erzählung über die Vergangenheit, die in der Gegenwart für eine Gruppe Sinn und Bedeutsamkeit stiftet.
Der Mythosbegriff ist dabei adäquater als die bisher vorgeschlagenen Alternativbegriffe, gerade weil bei dem als Geschichtsmythos bezeichneten Phänomen der Alltagssprachgebrauch und der religionswissenschaftliche Mythosbegriff in ihrer Bedeutung »mitschwingen« und so der zentrale Aspekt eines Geschichtsmythos – die Sinnstiftungsfunktion für die Gegenwart – im Fokus bleibt.
Von diesem Begriff ausgehend, soll im Folgenden der Versuch unternommen werden, einen Zugang zum Phänomen Mythos zu entwickeln, der Geschichtsmythen historisch erfassbar und erforschbar macht. Dieses Anliegen mag auf den ersten Blick überraschen, vor allem angesichts der Menge geschichtswissenschaftlicher Arbeiten, die verschiedene Geschichtsmythen untersuchen. Allerdings ist die bisherige geschichtswissenschaftliche Mythosforschung nach wie vor häufig mit dem Anliegen einer »Dekonstruktion« von Mythen in entlarvender Absicht verbunden – oder betreibt umgekehrt affirmativ selbst Mythisierung mit dem Hinweis auf die Unvermeidbarkeit von narrativer Sinnstiftung auch durch die Geschichtswissenschaft selbst. Erst in jüngerer Zeit und angeregt durch die Mythosforschung anderer Disziplinen gibt es in der Geschichtswissenschaft Ansätze zu einer Mythenanalyse, die möglichst ohne dekonstruierende oder affirmierende Absicht zunächst einmal das Phänomen selbst verstehen will.49 Diese Ansätze bewegen sich allerdings meist entweder auf einer sehr abstrakten Ebene, die zu allgemein ist, um beispielsweise eine Kategorisierung oder Typisierung von Mythen zu ermöglichen, oder sie beziehen sich wiederum sehr konkret auf einen einzigen Mythos, der in seiner Genese und Funktion erforscht wird. Es fehlt dagegen bislang eine systematisierende Synthese, es fehlt ein Überblick, es fehlt auch an einer tragfähigen Theorie und Methodik geschichtswissenschaftlicher Mythosforschung.
In diesem Buch soll genau das geschehen. Die Leitfrage dieser Untersuchung ist daher nicht, ob und inwiefern Geschichtsmythen der historischen Wirklichkeit entsprechen. Vielmehr sind Leitfragen der Untersuchung: Wie entsteht ein Geschichtsmythos? Sind Geschichtsmythen sämtlich »konstruiert«, und sind sie es alle in derselben Weise? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Mythos sich in einer Gruppe oder einer Gesellschaft etabliert? Welchen Wandlungen und Transformationen sind Mythen ausgesetzt? Wie wandelbar sind sie überhaupt? Wie werden sie um- und bekämpft? Was muss geschehen, um einen Mythos wieder zum Verschwinden zu bringen? Und welche Rolle spielt die Geschichtswissenschaft bei alledem?
Um diese Fragen zu beantworten, schafft dieses Buch eine neue Grundlegung für eine Geschichtsmythenforschung. Es beantwortet die Frage, was Geschichtsmythen sind, wie man sie erforscht und was man bereits über sie weiß.
In Kapitel 1 wird dazu von einem »weiten« Mythosbegriff ausgegangen, der im Grunde alles als Geschichtsmythos fasst, was als solches bezeichnet wird, und dann in Auseinandersetzung mit der Mythosforschung innerhalb wie außerhalb der Geschichtswissenschaft eine Arbeitsdefinition für Geschichtsmythen entwickelt, die vor allem auf die Funktionsunterschiede zwischen wissenschaftlichem und mythischem Zugang zur Vergangenheit abhebt. Unter Bezugnahme auf den »klassischen« Streit zwischen theoretisch und narrativ orientierter Geschichtswissenschaft sowie in kritischer Auseinandersetzung u. a. mit Hayden White wird die Argumentation entwickelt, dass Geschichtsmythen und Geschichtswissenschaft in einem Nahverhältnis zueinander stehen, aber doch hinreichend klar voneinander unterscheidbar sind. Gemeinsam haben sie, dass es sich um Narrationen über die Vergangenheit handelt; unterscheidbar sind sie aber dadurch, dass die Narrationen der Geschichtswissenschaft nachprüfbar und kritisierbar sind, und dadurch, dass Geschichtswissenschaft in erster Linie die Erkenntnis der Vergangenheit verfolgt, während der Mythos primär auf die Sinnstiftung in der Gegenwart zielt.
Vor diesem Hintergrund gibt es drei mögliche geschichtswissenschaftliche Zugänge zu Geschichtsmythen: die Mythenkritik, die die Plausibilität geschichtsmythischer Narrationen am Maßstab der Geschichtswissenschaft misst; die »Arbeit am Mythos«50 mit dem Ziel, als konstruktiv verstandene Geschichtsmythen zu schaffen oder zu unterstützen; und schließlich die Mythenanalyse, die Geschichtsmythen als eigene historische Phänomene geschichtswissenschaftlich untersucht und auf diese Weise Entstehungs- und Wirkmechanismen von Geschichtsmythen erforscht. Im Kapitel 1 »Welche Arten von Geschichtsmythen gibt es« wird für die Mythenanalyse als genuin wissenschaftlichen Zugang plädiert und ein Vorschlag für eine Methodik mythenanalytischer geschichtswissenschaftlicher Mythosforschung entwickelt. Diese Methodik wird ergänzt durch den Vorschlag einer Typologie historischer Mythen. Diese umfasst die wesentlichen Aspekte von Geschichtsmythen, die mithilfe der Geschichtswissenschaft untersucht werden können. Es handelt sich dabei um die Entstehung und Etablierung eines Mythos, um Mythentransformationen, Mythenkämpfe sowie das Verschwinden eines Mythos.
In den Kapiteln 2 bis 5 werden dann konkrete Geschichtsmythen untersucht, um zu zeigen, dass die vorgeschlagene Typologie »funktioniert«. Leitfragen sind dabei: Wieso sind manche Mythen erfolgreich, andere aber nicht (Kapitel 2)? Wie weit geht die Konstruier- und Wandelbarkeit von Mythen (Kapitel 3)? Und unter welchen Bedingungen büßt ein einmal erfolgreicher Mythos seine Wirkmächtigkeit wieder ein (Kapitel 4 und 5)? Diese Leitfragen hat die Geschichtsmythenforschung bislang nicht oder kaum gestellt. Dabei sind diese Fragen notwendig, um überhaupt ermitteln zu können, in welchen Aspekten Geschichtsmythen einander ähneln und in welchen Aspekten sie sich voneinander unterscheiden. Eine Kernthese dieses Buches ist, dass sich Geschichtsmythen tatsächlich im Hinblick auf alle diese Fragen voneinander unterscheiden; dass also Mythen nicht nur – wie bisher in der Forschung gängig – im Hinblick auf die unterschiedlichen mythisierten historischen Gegenstände oder im Hinblick auf ihre inhaltlich-politischen Funktionen voneinander unterscheidbar sind, sondern dass es darüber hinaus auch unterschiedliche Typen von Geschichtsmythen im Hinblick auf ihre Funktionalität und ihren Etablierungserfolg gibt und dass die Zuordnung eines konkreten Geschichtsmythos zu einem bestimmten Typus Prognosen über dessen Erfolg erlaubt.
Anhand von zwei direkt miteinander konkurrierenden Mythen, nämlich dem Bismarck-Mythos und dem Wilhelm-der-Große-Mythos, wird in Kapitel 2 die Frage beantwortet, was den Erfolg von Geschichtsmythen ausmacht, unter welchen Voraussetzungen also ein Mythos entsteht und in einer Gruppe etabliert wird. Die Wandelbarkeit von Geschichtsmythen wird in Kapitel 3 anhand des Luther-Mythos und des Jeanne-d’Arc-Mythos untersucht. Die Bedeutung von Mythenkämpfen, also konflikthaften Auseinandersetzungen über einen Geschichtsmythos, ist Gegenstand von Kapitel 4; Fallbeispiele sind hier der Befreiungskrieg-Mythos und der Resistenza-Mythos. In Kapitel 5 wird die Frage des Verschwindens von Geschichtsmythen behandelt. Hier wird ein besonderer Fokus auf die Rolle der Geschichtswissenschaft für die Wirksamkeit von Geschichtsmythen gelegt. Untersuchte Geschichtsmythen sind hier wieder der Resistenza-Mythos und der Befreiungskrieg-Mythos, außerdem werden die Debatte über Luthers Thesenanschlag sowie der Churchill-Mythos analysiert. Kapitel 6 führt die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen für eine künftige Geschichtsmythenforschung, aber auch für die bleibende Bedeutung von Geschichtsmythen. Diese, so die Überzeugung des Verfassers, werden keineswegs nur von Diktatoren oder totalitären Regimes genutzt, sondern spielen in allen Gesellschafts- und Staatsformen eine Rolle, auch in der Moderne, auch in der Demokratie, aller vermeintlichen »Aufgeklärtheit« zum Trotz. Wenn wir also die Geschichtsmythen nicht loswerden können, dann ist es umso wichtiger, sie zu kennen und zu verstehen.
Kapitel 1 GRUNDLEGUNG EINER GESCHICHTS-MYTHENFORSCHUNG
DIE NÄHE DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT ZUM MYTHOS
Die Geschichtswissenschaft hat sich stets auch über ihre Abgrenzung vom Mythos definiert. Sie beansprucht, kritische Analyse zu betreiben und sich gerade dadurch von mythischem Denken zu unterscheiden. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich: Die Beziehung ist komplizierter. Geschichtswissenschaft ist dem Mythos viel näher, als man es auf den ersten Blick vermuten würde. Dieses Kapitel geht der Frage nach, in welchem Verhältnis Geschichtswissenschaft und Mythos zueinander stehen und was das für den Umgang mit Geschichtsmythen bedeutet.
Auch Historiker erzählen
Die Geschichtswissenschaft tut sich traditionell schwer damit, ihr Verhältnis zum Geschichtsmythos zu bestimmen. Folgt man den Überlegungen, die Jörn Rüsen in seiner 2013 erschienenen Historik anstellt, so hat wissenschaftliches historisches Denken drei Dimensionen: eine disziplinäre, eine interdisziplinäre und eine transdisziplinäre. Die transdisziplinäre Dimension enthält den Bezug der Geschichtswissenschaft zur »menschlichen Lebenspraxis«, zur »Geschichtskultur«, zum »historischen Gedächtnis« und zur »Erinnerungskultur«.51 In diesen Zusammenhang gehören auch die Geschichtsmythen, und in diesem Zusammenhang ist die Frage nach dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Mythos zu klären. Dass diese Verhältnisbestimmung komplex ist, macht Rüsen selbst deutlich: Die Geschichtsschreibung nehme
»gegenüber der Forschung eine eigentümliche Sonderstellung ein; denn sie folgt Gesichtspunkten der Darstellung, die sich nicht hinreichend aus der Forschung ergeben, sondern über sie hinaus, oder genauer: hinter sie zurück in den Bereich der Produktion und Rezeption von Texten führen.«52
Ähnliches gilt für die von Rüsen reklamierte »Orientierungsfunktion«53 der Geschichtswissenschaft, die ohne eine Beziehung zu außerwissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht zu haben ist. Diese kommen nicht etwa erst ins Spiel, wenn es um die transdisziplinäre Vermittlung geschichtswissenschaftlicher Forschungsergebnisse geht, sondern auch umgekehrt beeinflusst die öffentliche Geschichts- und Erinnerungskultur – und beeinflussen die historischen Mythen – von Anfang an die historische Forschung.
Kernaufgabe der Geschichtswissenschaft ist nach Rüsen historische Sinnbildung und damit Orientierung in der Gegenwart:
»Sinn macht Orientierung möglich; er stellt das menschliche Leben in einen Horizont von Deutungen; er macht die Welt und den Menschen sich selbst verständlich; er hat eine Erklärungsfunktion; er formiert menschliche Subjektivität in das kohärente Gebilde eines (personalen und sozialen) Selbst; er lässt Leiden erträglich werden und stimuliert Handeln durch Absichten.«54
Kernmittel zur historischen Sinnbildung sei sinnbildende Narration, da Sinnbildung durch »narrative Logik«55 funktioniere, durch die Herstellung eines Sinnzusammenhangs zwischen Ereignissen mittels einer Erzählung: Ein Sachverhalt in der Gegenwart soll erklärt werden; dazu wird eine Geschichte erzählt, wie es zum entsprechenden Zustand gekommen ist, und damit »wird zugleich eine handlungsstimulierende Zukunftsperspektive entworfen«.56 Es handele sich bei der sinnbildenden Narration nicht um eine vom Forschungsprozess getrennte »Anwendung« historischer Erkenntnis, sondern die Narration gehe aus einer Erfahrung hervor, die nach einer Deutung verlangt, und die geschehe »durch Integration dieser Erfahrung in die Vorstellung eines sinn- und bedeutungsvollen Zusammenhangs zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft«.57 Das Erzählen sei ein »mentaler Vorgang«, der »empirisch und normativ zugleich« sei, damit also der »in der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie außerordentlich wichtigen grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Tatsachen und Normen oder Werten noch voraus« liege.58
Die narrative Dimension der Geschichtswissenschaft galt lange als selbstverständlich. Johann Gustav Droysen, einer der Klassiker geschichtswissenschaftlicher Theorie, musste umgekehrt darauf hinweisen, dass die »erzählende Darstellung« nicht die einzig legitime sei. Droysen unterscheidet in seiner »Historik« vier Arten historischer Darstellung: die »untersuchende«, die »erzählende«, die »didaktische« und die »diskussive«.59 Die ersten beiden Arten ordnen laut Droysen das historische Material unterschiedlich: Die untersuchende Darstellung formuliere eine Forschungsfrage und erarbeite die Antwort aus den Quellen; die erzählende »stellt das Erforschte als einen Sachverlauf in der Mimesis seines Werdens dar«60. Die beiden anderen Arten seien wesentlich durch ihren Zweck gekennzeichnet: Die didaktische Darstellung ziele auf »Bildung«, indem sie nach der »lehrhaften Bedeutung« für die Gegenwart frage; die diskussive Darstellung ziele auf eine konkrete Entscheidung in der Gegenwart, die besser historisch informiert als »doktrinär« erfolge.61
Ohne dass beide Unterscheidungen einfach dasselbe meinten, nahm Droysen mit der Unterscheidung zwischen untersuchender und erzählender Darstellung doch bereits zum Teil die Trennung zwischen »Theorie« und »Erzählung« vorweg, die in den 1970er-Jahren in der Geschichtswissenschaft zu Kontroversen zwischen »Theoretikern« und »Erzählern« führte.62 Die »historistische« Tradition narrativer Geschichtsschreibung stand aus Sicht der »Theoretiker« unter Ideologieverdacht, zumal sie ihre faktische subjektive Willkür hinter einem vermeintlichen Objektivitätsideal verstecke und zudem den Kriterien moderner Wissenschaftlichkeit nicht standhalte. Hans-Ulrich Wehler und andere Vertreter einer Historischen Sozialwissenschaft forderten daher, die Geschichtswissenschaft als »theoriegeleitet« neu zu fundieren und damit einen »Bodengewinn für die Geschichtswissenschaft«63 zu erzielen. Wehler räumte zwar ein, dass mit »Theorieverwendung« ein »Verlust an Anschaulichkeit« einhergehe, doch dieser werde durch das Erreichen »klarer Ordnung der Darstellung und ihrer Ergebnisse« kompensiert.64
Vor allem aber, so Wehler, gebe es in Wahrheit gar keine »untheoretische« narrative Geschichtsschreibung, denn jede Darstellung folge mindestens implizit theoretischen Vorannahmen. Erst wenn man die theoretischen Vorannahmen explizit mache, würden diese und ihr Einfluss auf die Untersuchung reflektiert und stärker kontrollierbar gemacht. Selbstverständlich müssten sich Theorien an den Quellen ausrichten; Hauptkriterium für die Beurteilung historischer Theorien sei ihre »Angemessenheit […] im Sinne der Realitätsadäquanz oder Annäherung an die historische Wirklichkeit«.65
Könnte man also mithilfe einer nicht mehr narrativen und stattdessen bewusst theoriegeleiteten Geschichtswissenschaft den Mythos loswerden? In einer Replik auf Wehler warnte Golo Mann davor, dass die Verwendung von Theorien zu deren Absolutsetzung führen könnte, was immer zu einseitigen, die Komplexität historischer Wirklichkeit verfehlenden Schlussfolgerungen führen werde.66 Die erzählende Geschichtsschreibung sei dagegen in der Lage, multiperspektivisch vorzugehen und den Standpunkt der wissenden Nachgeborenen mit den Standpunkten der Zeitgenossen zu verbinden. Was Wehler als angeblich unbewussten Theorieschmuggel durch den »Erzähler« bezeichne, sei in Wahrheit
»nichts anderes als die Summe von menschlichen Erfahrungen, die schon in seinem Geist präsent ist: Erfahrungen seiner eigenen Zeit und seines eigenen Lebens, ohne die kaum je ein großer Historiker Geschichte geschrieben hat, ferner dann Erfahrungen, die sich aus Studien über andere Gegenstände, andere Epochen schon ergeben haben.«67
Der Fortschritt der Geschichtswissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten habe nichts zu tun mit einer Überwindung des »Historismus«, sondern »er besteht ausschließlich in der Erweiterung der Fragen, in der Vermehrung der Gegenstände, mit denen sich die Geschichtswissenschaft befaßt.«68 Die Idee, mithilfe von Theorieanwendung könne man die Wissenschaftlichkeit der Geschichtswissenschaft steigern, sei Unsinn; im Sinne der Naturwissenschaften sei die Geschichtswissenschaft nun einmal keine Wissenschaft und könne es auch nicht werden.69
Wehler wiederum vermutete hinter der Theorieskepsis Manns den »konventionelle[n] Eskapismus vor präzisen Fragestellungen«70. Die bewusste Theorieverwendung, die klare Benennung der Fragestellung und der Methodik, so Wehler,
»verstärkt die diskursive Dimension moderner Geschichtswissenschaft, ist aber der stillschweigend eingeschleusten oder unbewußt gehaltenen Leitvorstellung allemal vorzuziehen. Denn die Transparenz der Auswahl zu steigern, ihre Rechtfertigung zu verbessern, das methodische Verfahren durchsichtig zu machen, die Interpretation möglichst überprüfbar zu halten, ist für die Geschichte als Wissenschaft ein Gewinn an sich.«71
Golo Mann wiederum gestand Wehler zu, dass historische Analysen und Untersuchungen eine theoriegeleitete Fragestellung benötigten; für die historische Gesamtdarstellung gelte dies aber nicht. Zudem dürften Theorien immer nur als Bausteine für Erklärungen verwendet werden und niemals »beanspruchen, das Ganze zu bieten, welches, ehe sie antraten, noch nie geboten wurde. Tun sie das, so geraten sie in Unwahrheit.«72
Die wechselseitigen Warnungen – der »Theoretiker«, dass mangelnde theoretische und methodische Reflexion zu subjektiver Willkür führe; der »Erzähler«, dass Theorieverwendung zu einer einseitig-verzerrenden Sicht auf die historische Wirklichkeit führe – deuten darauf hin, dass keine der beiden Perspektiven per se eine klare Trennung der Geschichtswissenschaft vom Mythos erlaubt: Die narrative Form der Geschichtsschreibung entspricht der von Geschichtsmythen; die Theorien beruhen auf weltanschaulichen Prämissen, die nicht rational ableitbar sind. Überhaupt erweist sich der Versuch, »Erzählung« und »Theorie« in der Geschichtswissenschaft voneinander zu trennen, als faktisch unmöglich. Die fast zeitgleich mit dem Theorie-Erzählungs-Streit in der deutschen Geschichtswissenschaft entstandenen Arbeiten des US-amerikanischen Historikers und Literaturwissenschaftlers Hayden White zur Narrativität der Geschichtsschreibung haben dies deutlich vor Augen geführt.
White geht davon aus, dass die Idee, es könne auch eine nichtnarrative Geschichtsschreibung geben, auf einem falschen Begriff von Narrativität beruhe. Narrativität sei nicht zwangsläufig durch eine bestimmte, dramatisierende oder »theatralische« erzählerische Form gekennzeichnet, sondern durch die Existenz eines wissenden »narrators«73, der die Aufmerksamkeit des Lesers auf die relevanten Fakten und ihre Bedeutung lenkt. In diesem Sinne sei jede Geschichtsschreibung narrativ, da in jedem Fall der Historiker als wissender Erzähler den Stoff auf eine bestimmte Weise ordne und organisiere. Im Unterschied zu dem, was White »mythische« und »fiktionale« Erzählungen nennt, produziere die Geschichtswissenschaft »realistische« Narrationen, da sie den Anspruch erhebe, dass die von ihr dargestellte Handlung belegbar oder zumindest plausibel sei angesichts der zur Verfügung stehenden Quellen.74 Allerdings gehe geschichtswissenschaftliche Arbeit weder in einer reinen Ermittlung der »Chronik« der Ereignisse auf noch in einer aus den Quellen empirisch und logisch eindeutig deduzierbaren Deutung. Vielmehr bilde der Historiker aus den Ereignissen und Fakten der Vergangenheit »motific clusters« und »thematic continuities« und bringe diese schließlich in eine »plot-structure«, die sich nicht von selbst aus den Quellen ergebe, sondern den Grundformen der Literatur entspreche, und die aus der »Chronik« überhaupt erst eine »Geschichte« mit einer Bedeutung mache.75
In seinem 1973 erschienenen Buch Metahistory führt White diese Auffassungen systematisch aus anhand einer Analyse der Klassiker der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts von Leopold von Ranke bis Jacob Burckhardt. White zufolge unterscheiden sich Historiker (und Geschichtsphilosophen) hinsichtlich der Wahl der Plotstruktur, der herangezogenen Grundannahmen über den historischen Verlauf und der ideologischen Implikationen ihrer Darstellung – sie gleichen sich aber alle darin, dass sie erstens die von ihnen dargestellten Ereignisse zur »Chronik« organisieren, diese zweitens in eine »Fabel« – einen Ereigniszusammenhang mit Anfang, Mitte und Schluss – umwandeln und sie schließlich drittens durch jeweils spezifische »narrative Modellierung«, »formale Schlußfolgerung« und »ideologische Implikation« zu einer historischen Erklärung ausbauen.76 White unterscheidet verschiedene »historiographische Stile«77 als Kombinationen aus je einem Typus der narrativen Modellierung, einem der formalen Schlussfolgerung und einem der ideologischen Implikation. Darüber hinaus vertritt er die Ansicht, dass Historiker das von ihnen bearbeitete historische Feld durch einen »poetischen Akt, der den formalen Analysen vorangeht«, selbst vorstrukturieren: Auf diese Weise »bringt der Historiker seinen Untersuchungsgegenstand hervor und legt gleichzeitig vorab die begriffliche Strategie fest, der er sich bei seinen Erklärungen bedienen will.«78 Mit Hinweis auf die Literaturwissenschaft unterscheidet White vier von ihm »Tropen« genannte Grundformen der poetischen Vorstrukturierung: Metapher (darstellend-identifizierend), Metonymie (reduktionistisch), Synekdoche (integrativ) und Ironie (negatorisch).79 Die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, so White, habe in Reaktion auf den ironischen Skeptizismus der Spätaufklärung verschiedene Versuche eines Realismus entworfen, die jeweils dem metaphorischen, metonymischen und synekdochischen Tropus zugeordnet werden können, bevor sie zum Ende des 19. Jahrhunderts wieder vorherrschend ironisch geworden sei.80
Entscheidend für die Frage nach dem Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Mythos ist Whites Behauptung, dass weder die Wahl des »Tropus« noch die Wahl der darauf beruhenden narrativen Modellierung, formalen Argumentation und ideologischen Implikation aus den Quellen selbst zwingend ableitbar oder überhaupt epistemologisch zu rechtfertigen sei:
»Die Entscheidung eines herkömmlichen Historikers, die Äußerungen bewußter Absichten durch den geschichtlichen Akteur für bare Münze zu nehmen, ist weder mehr noch weniger gerechtfertigt als die Entscheidung des materialistischen Deterministen, die bewußten Absichten auf den Status von Wirkungen einer psychophysischen Ursache zurückzuführen, oder als die des Idealisten, sie als Funktion eines ›Zeitgeistes‹ zu deuten. Solche Entscheidungen entspringen fundamentalen Vorstellungen von der Form, welche historische Theorien haben sollen. Aus diesem Grund sind sich Historiker zwangsläufig nicht nur uneins über die Beschaffenheit des ›Gegebenen‹, sondern auch über die Form der Theorien, mit deren Hilfe Daten als ›Probleme‹ artikuliert und sodann, indem man sie mit den Theorien zur ›Erklärung‹ vereinigt, gelöst werden.«81
Da die Historiker des 19. Jahrhunderts
»das historische Feld in verschiedener Weise aufbauen, legen sie sich implizit auf verschiedene Strategien der Erklärung, der narrativen Modellierung und der ideologischen Implikation fest, anhand deren sie seine ›wahre Bedeutung‹ bestimmten. Die ›Krise des Historismus‹, in die das Geschichtsdenken während der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts geriet, war daher eng verknüpft mit der Einsicht in die Unmöglichkeit, zwischen den verschiedenen Betrachtungen der Geschichte, die diese alternativen Deutungsstrategien zuließen, theoretisch angemessen eine Wahl zu treffen.«82
Historiker, die diese Erkenntnis ernst nähmen,
»sind dann frei, in derjenigen Denkform die Geschichte begrifflich zu entwerfen, ihre Inhalte wahrzunehmen und erzählende Darstellungen ihrer Verläufe aufzuzeichnen, die zu ihren eigenen ästhetischen und moralischen Imperativen passt.«83
Trotz berechtigter Kritik an manchen Schlussfolgerungen von White84 dürften zwei wesentliche Grundannahmen, die auch Rüsen teilt, weitgehender Konsens sein, nämlich erstens, dass jede Form der Geschichtswissenschaft sinnbildend-narrativ ist, und zweitens, dass Geschichtswissenschaft nicht vollständig a-normativ sein kann. Damit bleibt aber die Frage bestehen, inwiefern sich geschichtswissenschaftliche sinnbildende Narration von anderen Formen sinnbildender Narration – etwa dem Mythos – unterscheidet.
Rüsen verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Mythos von einer außerweltlichen »Traumzeit« berichte, während historisches Erzählen innerweltlich sei.85 Damit bezieht sich Rüsen aber nur auf den religionswissenschaftlichen Mythosbegriff im engeren Sinne. Beziehe sich dagegen der Mythos auf Historisches, sei eine Unterscheidung zwischen mythischem und historischem Erzählen schwieriger: »Festzuhalten bleibt, dass ein Erzählen dann historisch ist, wenn es sich auf reale Geschehnisse in der Vergangenheit bezieht.«86 Auch White scheint ein entsprechendes Realitätskriterium anzulegen, wenn er geschichtswissenschaftliche Narrationen als »realistisch« im Unterschied zu »fiktiven« Narrationen einerseits, »mythischen« Narrationen andererseits bezeichnet und von der »Chronik« als der Reihe realer vergangener Ereignisse und Fakten spricht.
Damit ist das entscheidende Kriterium angesprochen, das normalerweise für den Unterschied zwischen einem Geschichtsmythos und einer geschichtswissenschaftlichen Deutung angegeben wird – und das von den Kontrahenten im Streit zwischen »Theorie« und »Erzählung« auch jeweils anerkannt worden war –, nämlich dass sich erstere auf Fiktionen, letztere auf Tatsachen bezögen.87 Dieses Kriterium ist allerdings aus zwei Gründen problematisch: erstens, weil es vorauszusetzen scheint, dass Mythen sich nicht auch auf historische Tatsachen beziehen können. Und zweitens, weil es die Existenz einer historischen Realität voraussetzt, die mithilfe geschichtswissenschaftlicher Arbeit ermittelt werden kann. Diese Voraussetzung wird aber aus konstruktivistischer Perspektive infrage gestellt, was wiederum die Frage aufwirft, ob sich – vorausgesetzt, die konstruktivistische Perspektive ist zutreffend – überhaupt noch ein qualitativer Unterschied zwischen mythischer und geschichtswissenschaftlicher Narration festhalten lässt. Dieser zweite Grund, weshalb eine Unterscheidung zwischen Geschichtswissenschaft und Mythos nicht einfach unreflektiert mit der Unterscheidung von Realität und Fiktion gleichgesetzt werden kann, wird daher im Folgenden genauer analysiert. Die konstruktivistische Perspektive stellt faktisch das stärkste Hindernis für eine tragfähige Geschichtsmythenforschung dar, weil sie die Geschichtswissenschaft als Wissenschaft selbst infrage stellt.
Warum der Konstruktivismus keine Lösung ist
»Forscher begannen, selbstkritisch über ihre eigenen Methoden zu reflektieren, die Grenze zwischen beobachtendem Subjekt und beobachtetem Objekt wurde infrage gestellt, historische ›Tatsachen‹ wurden als erfunden und ›natürliche‹ Fakten als kulturell geprägt entlarvt, kurz gesagt: Alle Gewissheiten begannen zu bröckeln.«88
Der Schriftsteller Guillaume Paoli beschreibt mit diesem Satz das, was er generalisierend die »postmoderne Theorie« nennt. Dabei handele es sich nicht um eine konkret fassbare, von bestimmten Autoren klar vertretene Position, sondern um eine »zombie theory«89 – um eine Reihe von Annahmen und Überzeugungen, die bewusst oder unbewusst den akademischen Diskurs bestimmen. Im Prinzip, so Paoli, entspreche die postmoderne Theorie der aufklärerischen Maxime, keine Wahrheitsgewissheiten a priori zuzulassen, sondern durch kritisches Denken die Wahrheit zu suchen. Allerdings führe sie durch radikale Zuspitzung die Maxime selbst ad absurdum, da sie die »Unmöglichkeit, von stabilen, allgemeingültigen Prinzipien aus denken zu können,«90 postuliere, damit die Wahrheitssuche faktisch für aussichtslos erkläre und sie dadurch aufgebe:
»›Wahrheit‹ war nur noch kontextbezogen zu haben, als diskursives Produkt von kontingenten Machtverhältnissen. Jeder universalistische Anspruch wurde abgestritten.«91
Die praktische Konsequenz aus dieser Theorie seien ein »Kathedernihilismus«92 und ein allgemeiner Wahrheitsrelativismus:
»Sobald ich die Existenz von allgemeingültigen Prinzipien bestreite, muss ich akzeptieren, dass jeder seine eigene Wahrheit beanspruchen kann. Alle Meinungen sind gleichwertig. Mit dieser augenscheinlichen Toleranz wird in der Tat die Möglichkeit eines Dialogs unterbunden.«93
Man könne dementsprechend dann in einer inhaltlichen Auseinandersetzung nur noch entweder die eigenen Prämissen verraten oder »die Machtkarte«94 spielen, nachdem Analyse und Kritik durch den »neuen Modus Operandi der Dekonstruktion«95 ersetzt worden seien.
Paoli beschreibt damit weniger eine dezidiert formulierte Position, sondern eher die epistemologischen Konsequenzen, die sich seiner Meinung nach aus einem radikalen Konstruktivismus ergeben. Dessen philosophischer Begründer, Ernst von Glasersfeld, hat entsprechende relativistische Konsequenzen des Konstruktivismus allerdings bestritten. Ihm geht es vornehmlich um die Zurückweisung eines »essentialistischen« oder »naiv-realistischen« Standpunktes, nach welchem eine vom erkennenden Subjekt unabhängige objektive Realität existiere, zu der das erkennende Subjekt Zugang habe. In Zuspitzung von Kants Erkenntniskritik vertritt von Glasersfeld die Auffassung, dass ein solcher Zugang zu einer objektiven Realität unmöglich sei, da die Erkenntnis immer von den subjektiven Voraussetzungen des Sinnesapparats und der eigenen begrifflichen Kategorien abhängig sei. Daher könne man Aussagen niemals nach ihrem Wahrheitsgehalt beurteilen, sondern immer nur danach, ob sie »viabel« sind, also zweckdienlich und mit der eigenen Erfahrungswelt nicht kollidierend.96
In der Geschichtswissenschaft wirkt sich der radikale Konstruktivismus unter anderem so aus, dass die Untersuchung von Diskursen an die Stelle der Untersuchung der historischen Realität gesetzt wird, da die Frage, ob es »ein Leben hinter dem Text«97 gibt, faktisch verneint wird. Allerdings beruft man sich dabei zumeist weniger auf von Glasersfeld und andere philosophische Vertreter eines radikalen Konstruktivismus, sondern neben den Vordenkern der »Postmoderne« – Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard etc. – auf Hayden Whites bereits erwähnte Überlegungen zur Narrativität der Geschichtsschreibung. Angesichts einer Wiederentdeckung der Narration in der Geschichtswissenschaft der 1990er-Jahre warnte White davor, das narrative Element als bloßes Darstellungsmittel zu verstehen, dessen man sich bedient, um ein größeres Publikum zu erreichen, und der Narration somit eine Nebenrolle als Explikation und Illustration des historischen Materials zuzuweisen.98 Einer solchen Auffassung liege die falsche Vorstellung zugrunde, Narration sei etwas, das man einem Inhalt einfach hinzufügen könne, ohne ihn zu verändern, ja sie sei überhaupt klar vom transportierten Inhalt zu unterscheiden. Gerade die unvermeidbare Nähe des narrativen Diskursmodus zum Mythos sei es gewesen, die in der Nachkriegszeit zur »condemnation of narrative history as a manifestation of mythical thinking in historical reflection«99 geführt habe. Wie Fernand Braudel und Roland Barthes gezeigt hätten, führe narrative Geschichtsschreibung nicht nur zu einer Dramatisierung und Theatralisierung der Geschichte, sondern gehe von lauter ideologischen Voraussetzungen aus – dem transzendentalen Beobachter des historischen Prozesses, dem souveränen Subjekt als historischem Handlungsträger, dem Ereignis als Basiseinheit historischer Realität, der Anekdote als Mittel zur Erklärung, dem Fehlschluss von zeitlicher Abfolge auf einen Kausalzusammenhang –, die eigentlich mythischem Denken entstammten.100
Indem historische Ereignisse in eine narrative Plot-Struktur – Epos, Komödie, Tragödie, Farce – gebracht werden, so White, liefern sie eine Erklärung der Geschichte mit, und damit mindestens implizit auch Prinzipien der Klassifizierung, Charakterisierung, Kausalität und Bedeutung. Das aber heiße, »that any narrative account of historical events remains contaminated by representational practices of a distinctively fictionalizing and mythicalizing kind«.101 Um daher weiterhin an der Wissenschaftlichkeit von Geschichtswissenschaft festhalten zu können, müsse man sie entweder von ihren narrativen Elementen reinigen – was unmöglich sei – oder zeigen, dass die historische Realität selbst narrativ sei; dass Historiker also narrative Elemente nicht einfach beliebig konstruierten, sondern im historischen Material vorfänden und aufnähmen.102 Diesem Problem entgehe man auch nicht durch eine Absage an sogenannte »Meisternarrative« und eine Beschränkung auf die Produktion von »small narratives«103. Auch kleine Narrative machten nämlich die Entscheidung für eine bestimmte Plot-Form nötig; das führe unweigerlich dazu, dass es Darstellungen derselben Ereignisse gebe, die den Anspruch erhöben, wissenschaftlich fundiert zu sein, die sich aber gegenseitig ausschlössen. Die Frage sei daher, ob es über das Kriterium der »factual accuracy« hinaus Kriterien gebe, die ein bestimmtes »Emplotment« als realistischer und damit wissenschaftlicher erwiesen als andere.104
Während in dieser Problembeschreibung noch ein »essentialistischer« Rest steckt – nämlich die Annahme, man könne bei historischen Darstellungen die Faktentreue tatsächlich beurteilen –, gehen andere Historiker unter Rückgriff auf White noch darüber hinaus, bestreiten die Existenz von historischen Fakten als »constructed artefacts no different in cognitive origin than any other made thing or ›fiction‹«105 und lehnen den Begriff der »historischen Wirklichkeit«106 ganz ab. Selten geht diese Auffassung so weit, dass die Existenz der Vergangenheit als solche geleugnet wird; manche Positionen laufen aber durchaus darauf hinaus, dass es faktisch keine Möglichkeit gebe, diese zuverlässig zu erforschen. So meint etwa Alun Munslow, die narrative Struktur unserer Sprache, unserer Interpretationen und Erklärungen, aber auch die Konstruktion von Fakten durch die Aufladung von Quellenbelegen mit einer Bedeutung »mediate reality so much so that they effectively close off direct access to it«107. Der Geschichtswissenschaft bleibe deshalb nur die Aufgabe, die potenziell unendlichen möglichen narrativen Repräsentationen der Vergangenheit aufzuzeigen, von denen »none can claim to know the past as it actually was«.108 Aus dieser Perspektive ist es nur konsequent, darauf hinzuweisen, dass die Geschichtswissenschaft eigentlich gar keine Wissenschaft sei, sondern bestenfalls eine »Protowissenschaft«109, schlimmstenfalls eine Form von »Literatur«110. Andere Forscher, wie Jonathan Friedman oder Robert Young, gehen noch weiter und sehen in der westlichen Geschichtswissenschaft nicht nur eine als Wissenschaft getarnte Literatur, sondern eine Produzentin von als Wissenschaft getarnten politischen Mythen, da die von ihr konstruierten historischen Narrative immer darauf zielten, in der Gegenwart Identität zu stiften.111
Auf das Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Mythos hat der konstruktivistische Ansatz direkte Auswirkungen, wie Thomas Etzemüller in seiner Einführung in historische Biografien verdeutlicht. Er unterscheidet einen »essentialistischen und einen konstruktivistischen Zugriff« und macht den entscheidenden Unterschied darin aus, dass der »Essentialist« mit dem Verweis auf die Fakten »Mythen zerstören« wolle, während der »Konstruktivist« die Frage nach den Fakten »suspendiere«, also auflöse.112 Der wesentliche Unterschied scheint also auf epistemologischer Ebene zu bestehen, in der Annahme des Essentialisten, es gebe eine historische Realität, zu der der Historiker – wie sehr »vermittelt« auch immer – Zugriff habe, gegenüber der Annahme des Konstruktivisten, es existiere keine historische Realität – oder zumindest könne der Historiker nicht darauf zugreifen.
Gegen diese erkenntnistheoretische Position des radikalen Konstruktivismus gibt es allerdings gewichtige Argumente, die in besonders pointierter Weise von Paul Boghossian und Markus Gabriel vorgetragen wurden, die beide auf den »Selbstanwendungswiderspruch«113 des Konstruktivismus verweisen.114 Boghossian wendet sich gegen den »Tatsachenkonstruktivismus«, also gegen die Auffassung, es gebe gar keine Tatsachen, da alle »Tatsachen« beschreibungsabhängig und alle Beschreibungen sozial bedingt seien.115 Das klassische Argument gegen einen solchen relativistischen Tatsachenkonstruktivismus laute: Entweder ist die Auffassung, es gebe keine objektiven Tatsachen, objektiv wahr – dann ist sie falsch, denn dann wäre es eine Tatsache, dass es keine Tatsachen gibt. Oder die Auffassung, es gebe keine objektiven Tatsachen, ist nicht objektiv wahr, dann ist sie nur eine von unendlich vielen potenziellen Auffassungen, über deren Wahrheitsgehalt sich nichts Relevantes aussagen lässt.116 Boghossian variiert und differenziert diese Argumentation, da sie nicht auf jede Art von Konstruktivismus zutreffe: Ein relativistischer Tatsachenkonstruktivismus, so Boghossian, gehe davon aus, dass es keine absoluten, sondern nur relative Tatsachen gibt, dass Tatsachen also durchaus wahr sein können, aber nur relativ zu einer Theorie und nicht absolut zur Realität. Das Problem bei dieser Argumentation allerdings sei, dass man damit einen infiniten Regress auslöse, denn die Aussage, etwas sei nur relativ zu einer Theorie wahr, könne wiederum nur relativ zu einer Theorie wahr sein:
»An jedem Punkt des drohenden Regresses muss der Relativist verneinen, dass die Behauptung an diesem Punkt einfach nur wahr sein kann, und wird darauf bestehen müssen, dass sie nur relativ zu einer Theorie wahr ist, die wir befürworten.«117
Markus Gabriel vermutet, dass der konstruktivistisch begründeten »Gleichwertigkeitsdoktrin«118 eine »falsche Philanthropie«119 zugrunde liege, die in letzter Konsequenz keine Unterscheidung mehr zwischen wahren und falschen Aussagen zulasse. Nur die Anwendung doppelter Standards oder eine rein axiomatische Setzung könnten dann noch dazu führen, dass manche Aussagen akzeptiert werden und andere nicht. Ein radikaler Konstruktivismus sei ein logischer Selbstwiderspruch, da die Möglichkeit von Erkenntnis grundsätzlich bestritten werde. Die Behauptung, irgendetwas sei sozial konstruiert, sei eine Tatsachenbehauptung, die »selbst gerade nicht sozial konstruiert [sei] oder zumindest nicht in derselben Weise«.120 Der Hinweis, dass etwas sozial konstruiert sei, ergebe überhaupt nur einen Sinn, wenn es daneben auch Dinge gebe, die nicht sozial konstruiert seien.
Tatsächlich neigen konstruktivistische Positionen dazu, Grenzen zwischen wissenschaftlicher und nichtwissenschaftlicher Erkenntnis nicht mehr zuzulassen. Wer die wissenschaftlichen Grundsätze von Beleg und rationaler Begründung nicht akzeptiert beziehungsweise – auf wissenschaftlichem Feld – nur als eines von potenziell unendlich vielen denkbaren Prinzipien versteht, führt damit die Wissenschaft selbst ad absurdum. Auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen (Geschichts-)Wissenschaft und Mythos angewendet, würde das bedeuten, dass es faktisch keinen Unterschied zwischen beidem gibt, denn in beiden Fällen werden sinnstiftende Narrative über die Vergangenheit produziert, die in der Gegenwart etwas bewirken sollen. Dass die wissenschaftlich produzierten Narrative den Kriterien von Belegbarkeit und Begründbarkeit folgen müssen, die mythischen aber nicht, wäre aus einer radikalkonstruktivistischen Perspektive ein bloßer Scheingegensatz.
Eine solche Extremposition wird allerdings in der Geschichtswissenschaft eher selten vertreten, wie auch umgekehrt ein naiver, essentialistischer Realismus eher unterstellt als wirklich vertreten wird. Gelingt es, die Aporien beider Extrempositionen zu vermeiden – die Auflösung der historischen Wirklichkeit ebenso wie die Idee, man habe durch die Quellen einen unvermittelten Zugang zu ihr –, wäre für die Geschichtswissenschaft im Sinne eines »Postkonstruktivismus«121 viel gewonnen. Ein solcher Ansatz hat sich in »Urteilszurückhaltung«122 gegenüber epistemologischen Grundfragen zu üben, muss aber daran festhalten, dass man mithilfe der Quellen Aufschluss über die historische Wirklichkeit gewinnen kann und dass die
»geteilte Erlebniswelt, der wissenschaftliche Fortschritt, die Nachprüfbarkeit und Allgemeingültigkeit von Erkenntnissen und überhaupt die Möglichkeit der Kommunikation über ähnlich gesehene Probleme in einem gemeinsamen Diskursraum«123
die gegenteilige Annahme unplausibel erscheinen lassen. Daher besteht durchaus die »approximative, falsifizierbare Erkenntnischance der historischen Wirklichkeit, die stets frage- und perspektivengeleitet ist«124. Zugleich ist der konstruktivistische Hinweis auf die Narrativität und Medialität der Geschichte, die auch durch unmittelbaren Zugang auf die ihrerseits in narrativer und medialer Form vorliegenden Quellen nicht umgegangen werden kann, ebenso ernst zu nehmen wie die für die geschichtswissenschaftliche Arbeit notwendige »Reflexion und Relativierung des eigenen Sehepunktes«125.
Dass nicht alle Tatsachen zwangsläufig konstruiert sind – zumindest nicht in derselben Weise –, ist die eine für die Verhältnisbestimmung von Geschichtswissenschaft und Mythos relevante Konsequenz dieser Position. Die zweite Konsequenz ist die Begründungspflicht konstruktivistischer Annahmen. Plausibel führt der Konstruktivismus vor Augen, dass Auffassungen keinesfalls nur auf dem Wege empirischer Beobachtung und rationaler Erwägung zustande kommen, sondern dass dabei auch andere, sowohl zweckrationale (etwa Machtinteressen) als auch außerrationale (axiomatische Glaubensüberzeugungen) eine wesentliche Rolle spielen. Die Verwendung der Ingenieursprache – Konstruktion, Erfindung, »historical engineering«126 etc. – ist dabei allerdings problematisch, da sie suggeriert, dass Interpretationen, Deutungen und Überzeugungen bewusst »gemacht« sind. Diese Annahme ist aber nicht per se plausibel, zumal gerade von konstruktivistischer Seite regelmäßig betont wird, dass die »Konstruktionen« vielfach unbewusst erfolgen.127
Von einem solchen weiterführenden postkonstruktivistischen Ansatz zu unterscheiden ist ein inkonsequenter Konstruktivismus, der vor allem in historischen Debatten immer wieder zu beobachten ist. Inkonsequent ist der Konstruktivismus dann, wenn die konstruktivistischen Einwände nur gegen bestimmte Positionen vorgebracht werden, gegen andere – vor allem die eigenen – aber nicht. Die Versuchung, eine solche Position zu vertreten, ist groß. Wenn, wie es eine radikalkonstruktivistische Position nahelegt, Auffassungen nur relativ zu einer bestimmten Theorie wahr sind, dann sind der Theorie widersprechende Auffassungen nicht wahr. Die Theorie aber, die als Maßstab angelegt wird, wird dabei faktisch als nicht konstruierte Tatsache behandelt. Eine Kommunikation über die Theorien hinweg erscheint dann unmöglich, und die »Konstruiertheit« der eigenen Position droht in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung vergessen zu werden. Tatsächlich wird in geschichtswissenschaftlichen Arbeiten zuweilen argumentiert, eine bestimmte historische Darstellung sei »durch Konstruktionen charakterisiert und […] infolgedessen nicht als historisch zuverlässige Beschreibung«128 zu betrachten – was einerseits (teilweise) zutreffend ist, andererseits aber suggerieren könnte, dass es neben den »konstruierten« historischen Darstellungen auch solche gebe, die nicht von Konstruktionen charakterisiert sind. Mitunter wird eine solche Inkonsequenz im Sinne eines »strategic essentialism«129 ausdrücklich gefordert.
Noch problematischer ist es, wenn die Analyse der außerwissenschaftlichen Interessen und Gesichtspunkte, die beim Zustandekommen und bei der Durchsetzung einer Auffassung eine Rolle spielen, als Sachargument gegen die analysierte Auffassung verwendet werden. Die wissenschaftliche Arbeitsweise muss unbedingt die Sachebene des untersuchten Gegenstandes von der Untersuchung der mit dem Gegenstand verbundenen Interessen trennen. Sonst droht die durch den Konstruktivismus in aller Deutlichkeit in den wissenschaftlichen Diskurs eingebrachte Erkenntnis, dass Geschichtsdeutungen mehrdimensional sind und in ihren Motiven deutlich über rein wissenschaftliche Gesichtspunkte hinausgehen, wieder verloren zu gehen beziehungsweise auf ein rhetorisches Kampfmittel in Deutungskämpfen reduziert zu werden. Davor warnt auch Jörn Rüsen, wenn er angesichts der verschiedenen Dimensionen öffentlicher Geschichtskultur die Geschichtswissenschaft vor »kognitivistischer Selbstverkennung« warnt, die im schlimmsten Fall
»implizite politische Tendenzen der historischen Interpretation umstandslos als kognitiv geboten ausgeben und mit entsprechenden Geltungsansprüchen versehen [kann]. Abweichende Tendenzen und deren Perspektiven werden dann als sachlich falsch (und die eigene entsprechend als einzig sachlich gebotene) qualifiziert.«130
Durch eine postkonstruktivistische Perspektive dagegen ist das Verhältnis zwischen Geschichtswissenschaft und Mythos wieder klarer fassbar, da weder im Sinne des naiven Realismus ein starrer Gegensatz behauptet noch im Sinne des radikalen Konstruktivismus beides in eins gesetzt werden muss.
Wie kann man diese Einsichten für eine Geschichtsmythenforschung fruchtbar machen? Im Folgenden wird ein Vorschlag erarbeitet, der den Unterschied zwischen Wissenschaft und Mythos bewahrt, ohne die Nähe gerade der Geschichtswissenschaft zum Mythos zu ignorieren.
Was die Geschichtswissenschaft vom Mythos unterscheidet
Geschichtsmythen und Geschichtswissenschaft stehen in einem Nahverhältnis zueinander.131 Sie haben eine »signifikante Schnittmenge«132 und teilen die grundsätzlich narrative Struktur sowie die Funktion, durch Narration und »Emplotment« einzelne Ereignisse in einen größeren, sinnvollen Zusammenhang einzuordnen und damit Orientierung zu stiften. Postmoderne und Konstruktivismus haben zudem deutlich vor Augen geführt, dass klassische Unterscheidungsmerkmale zwischen Mythos und Wissenschaft – der Bezug auf die Fakten etwa in der Wissenschaft oder die selektive Auswahl der Ereignisse durch Mythen – problematisch sind und keineswegs eine eindeutige Unterscheidung zwischen beidem erlauben.133
Das Problem, angesichts einer notwendig narrativen und ebenso notwendig auf Sinnstiftung zielenden Geschichtswissenschaft eine hinreichend klare Unterscheidung zu anderen Formen von sinnstiftenden Geschichtsnarrationen zu bestimmen und überhaupt an der Wissenschaftlichkeit von Geschichtswissenschaft festhalten zu können, hat Hayden White sehr klar benannt. Er selbst hat zwei verschiedene Lösungsvorschläge für dieses Problem entwickelt. Zum einen verweist er auf die notwendige Unterscheidung der Ebenen des historischen Diskurses: Auf der Ebene der Inhaltsform könne man relativ klar nach dem Kriterium der Faktentreue urteilen, auf der Ebene der Ausdruckssubstanz, also der gewählten Plot-Struktur, gebe es höchstens allgemeine Plausibilitätskriterien. Allerdings gehe mit der Wahl einer Plot-Struktur jeweils eine bestimmte Inhaltssubstanz einher, also eine grundlegende Aussage über die Zusammenhänge der historischen Realität, und auf dieser Ebene könne man unterscheiden, ob eine Narration »historisch« oder »ideologisch« sei. Zum anderen hat White in Bezug auf den Nationalsozialismus und die »Endlösung« dafür plädiert, dass die verschiedenen »realistischen« Narrationsstile des 19. Jahrhunderts für ein Ereignis des 20. Jahrhunderts prinzipiell unangemessen seien und dass es stattdessen darum gehen müsse, einen »medialen« oder »transitiven« Stil zu entwickeln, der als »eine Antizipation einer neuen Form historischer Realität« verstanden werden müsse.134
Beide Vorschläge Whites sind aber keine Lösungen für das von ihm selbst benannte Problem, dass bei historischen Narrationen »die besten Gründe, eine Perspektive einer anderen vorzuziehen, zuletzt eher ästhetische oder moralische denn erkenntnistheoretische sind«.135 Sie illustrieren es vielmehr, denn die Plausibilität eines historischen Plots macht er daran fest, ob er die zugrunde liegenden geschichtsphilosophischen und sogar ideologischen Prinzipien teilt oder nicht. Das aber führt nicht zu einer Verwissenschaftlichung historischer Narrationen, sondern im Gegenteil zu ihrer weiteren Ideologisierung. Weiterführender als diese Versuche, bessere von schlechteren Narrationen auf der weltanschaulichen Ebene unterscheiden zu wollen, ist daher Whites eher sporadischer Hinweis auf die Faktentreue, anhand der man den Grad der Wissenschaftlichkeit einer Narration bestimmen kann. Bei der Art der narrativen Modellierung ist, wie White selbst feststellt, mehr als eine Plausibilitätsprüfung – im Blick auf die innere Konsistenz eines Entwurfs und im Blick auf die Plausibilität der aus dem Entwurf gefolgerten Hypothesen – nicht möglich.
Mehr ist aber auch gar nicht nötig, um geschichtswissenschaftliche von mythischen Narrationen unterscheiden zu können. Mit Recht wurde White entgegengehalten, dass er die Geschichtswissenschaft unzulässigerweise am Maßstab der Naturwissenschaften messe und daher unrealistische Erwartungen an die Exaktheit geschichtswissenschaftlicher Forschungsergebnisse habe.136 Um diesen Maßstab abzulehnen, muss man nicht wie Wilhelm Dilthey oder Hans-Georg Gadamer die prinzipielle Unvereinbarkeit zwischen Natur- und Geisteswissenschaften behaupten, sondern kann mit Max Weber davon ausgehen, dass Natur- und »Kulturwissenschaften«137 – mit dem Experiment bzw. der Bildung von Begriffen –
»zwei verschiedene, aber gleichrangige Verfahren der Erkenntnis« vollziehen, die aber »auf ein und derselben Idee von Wissenschaft beruhen: daß Wissenschaft ›Forschung‹ ist, d. h. eine empirisch gestützte und in Hypothesen fortschreitende Wissenschaft, die sich in einem prinzipiell unabschließbaren Prozeß des Fragens und Suchens befindet«.138
In diesem Sinne hat Thomas Haussmann in einer instruktiven Studie die Künstlichkeit einer Unterscheidung zwischen einem »verstehenden« und einem »erklärenden« Zugang zur Wirklichkeit herausgearbeitet.139 Haussmann zeigt, dass die Einwände gegen die Zuverlässigkeit historischer Erklärungen zwar stichhaltig sind, dies aber in keiner Weise gegen die Möglichkeit historischer Erklärungen spricht:
»Denn diese: die Unvollkommenheit und die Revisionsanfälligkeit, sind Eigenschaften, die alle Erklärungen, gleichviel in welchem Wissenschaftsbereich, haben. Daß sie in der Geschichtswissenschaft häufig in verstärkter Form auftreten, ist kein Grund, die prinzipielle Möglichkeit erklärenden Vorgehens in der Geschichtswissenschaft zu bestreiten.«140
»Verstehen« wiederum sei kein geisteswissenschaftliches Spezifikum gegenüber einem angeblich nur naturwissenschaftlichen »Erklären«, wie Dilthey oder Gadamer meinten, sondern sei – im Sinne eines »Erfassens« und »Begreifens« des zu erkennenden Gegenstands – allen Wissenschaften gemeinsam und bilde eine notwendige Voraussetzung für die Erklärung, die ebenfalls allen Wissenschaften gemeinsam sei.141 Verstehen sei einerseits Voraussetzung, um etwas erklären zu können, andererseits sei das Ziel des Erklärens, zum Verstehen beizutragen, und daher seien »Erklären und Verstehen hervorragend miteinander vereinbar«.142
Unter Verweis auf Nicholas Rescher vertritt Haussmann die Auffassung, dass Naturwissenschaften und Geschichtswissenschaft sich also nicht im Hinblick auf die Rolle von Verstehen und Erklären unterschieden, sondern stattdessen im Hinblick auf die Rolle, die »Gesetzesaussagen«143 bei ihnen spielen: Naturwissenschaftler sammeln Fakten, um Gesetzmäßigkeiten zu finden, während Historiker Gesetzmäßigkeiten nutzen, um Fakten zu erklären.144 Geschichtswissenschaftliche Aussagen seien deutlich unsicherer als naturwissenschaftliche, weil die Daten, Fakten, Interpretationen und Erklärungen, die benötigt werden, »häufig unüberschaubar, zahlreich, vielfältig und komplex sind«145. Daher hätten historische Erklärungen nur »tentative Geltung«146 und könnten auch keinen »Anspruch auf Wahrheit« erheben, sondern nur einen »Anspruch auf Plausibilität«.147 Das ändere aber nichts daran, dass es zu einem sowohl erklärenden als auch verstehenden Vorgehen in der Geschichtswissenschaft gar keine Alternative gebe, zumal eine negative Prüfung auf »Stichhaltigkeit, Rechtfertigbarkeit und Haltbarkeit«148 problemlos möglich sei. Damit seien geschichtswissenschaftliche Arbeiten wissenschaftlich beurteilbar: danach, ob die Ergebnisse nach den Regeln der Quellenkritik erhoben wurden, »ob sie mit allen bekannten Fakten vereinbar sind und ob dem Historiker bei seinen Erklärungen und Inferenzen irgendein Fehler unterlaufen ist«.149
Vor diesem Hintergrund bleiben zwei mögliche Kriterien, um geschichtswissenschaftliche von mythischen Narrationen zu unterscheiden: Erstens kann man auf den Unterschied in der Entstehung der jeweiligen historischen Erzählung verweisen und argumentieren, dass die Sinnproduktion der Geschichtswissenschaft auf rationalem, methodischem Weg geschieht und dabei den Kriterien der Nachprüfbarkeit und Plausibilität genügen muss. Zweitens kann man die Forderung aufstellen, die Geschichtswissenschaft müsse sich von allen normativen Vorgaben und Implikationen frei halten. Beide Merkmale sind zu Recht umstritten; wenn man sie allerdings ganz aufgibt, verliert man tatsächlich jede klare Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Geschichtswissenschaft und Geschichtsmythos. Im Sinne eines postkonstruktivistischen Zugriffs ist es aber durchaus möglich, beide Kriterien in einer die kritischen Einwände aufnehmenden Weise aufrechtzuerhalten.
Relativ problemlos ist das im Hinblick auf die geschichtswissenschaftliche Methodik – Quellenkritik, Nachprüfbarkeit, Plausibilität – möglich. Zwar wird zu Recht eingewendet, dass die Geschichtswissenschaft gar keine strenge Methodik kennt und »governed by convention and custom rather than by methodology and theory«150 sei. Das ändert allerdings nichts an der Geltung der Geschichtswissenschaft als
»Wissenschaft nicht im strengen, sondern im weiteren Sinne: ein organisiertes System von Wissen, erworben durch Forschung, die entsprechend allgemein anerkannter Methoden durchgeführt und veröffentlicht wird, der Prüfung durch die Gemeinschaft der Wissenschaftler unterworfen.«151
Eine solche pragmatische Definition des Wissenschaftscharakters der Geschichtswissenschaft muss als Minimalkonsens gelten, um überhaupt noch von Geschichtswissenschaft sprechen zu können. Die Überprüfbarkeit der aufgestellten Behauptungen, die Kritik durch die scientific community sowie das »Vetorecht«152 der Quellen sind keineswegs obsolet. Die Idee, dass es erstens eine historische Realität gibt, die man zweitens mithilfe der Quellen zumindest näherungsweise erkennen kann, ist die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt Geschichtswissenschaft zu betreiben. Allen berechtigten Einwänden gegen die Exaktheit und Zuverlässigkeit geschichtswissenschaftlicher Quellenkritik zum Trotz führt die Bestreitung dieses Sachverhalts letztlich in die Aporie des radikalen Konstruktivismus und würde jedes wissenschaftliche Arbeiten sinnlos machen. Es bleibt in dieser Hinsicht bei der Feststellung Reinhart Kosellecks, dass geschichtswissenschaftliche Deutungen der Vergangenheit durch die Quellen begrenzt, aber durch ihren sinnstiftenden Charakter, den sie als Deutungen haben, nicht vollständig wissenschaftlich auflösbar sind: