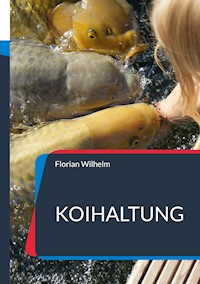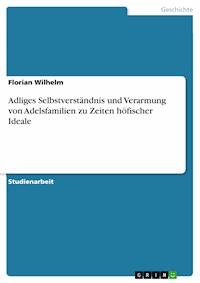Konsequenzen von Private-Equity-Beteiligungen für das Human Resource Management E-Book
Florian Wilhelm
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Private Equity Gesellschaften stehen immer wieder im Mittelpunkt von Diskussion über ihr Vorgehen und ihre Methoden. Kritiker erheben den Vorwurf, dass Renditen überwiegend zu Lasten der Mitarbeiter eines akquirierten Unternehmens erzielt werden. Befürworter widersprechen, dass die Beteiligung einer Private Equity Gesellschaft zu einem effektiveren Management, verbesserten Human Resource Praktiken und einer erhöhten Investitionsbereitschaft führe. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, systematisch aufzuzeigen, welche Konsequenzen sich bei einer Private Equity Transaktion für das Human Resource Management des akquirierten Unternehmens ergeben. Private Equity Transaktionen umfassen eine Vielzahl an Unterformen von Eigenkapitalinvestitionen, deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich die dominanteste Form (Buyouts) thematisiert. Dabei werden die Konsequenzen für das Management und die Mitarbeiter differenziert betrachtet. Es wird zunächst gezeigt, wie eine Private Equity Gesellschaft nach einer Unternehmensübernahme durch Veränderung der Corporate Governance Strukturen des akquirierten Unternehmens das Management dahingehend diszipliniert und motiviert, in ihrem Interesse zu handeln. Im Anschluss daran wird dargelegt, dass sich in Abhängigkeit der Strategie von Private Equity Gesellschaften unterschiedliche Konsequenzen für die Mitarbeiter des akquirierten Unternehmens ergeben. Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Der erste Abschnitt enthält begriffliche Grundlagen zu Private Equity, Buyout und Human Resource Management. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit den Maßnahmen der Private Equity Gesellschaft zur Interessensangleichung für das Management. Es folgen die Konsequenzen für die Mitarbeiter in Abhängigkeit der Strategie der Private Equity Gesellschaft. Abschließend werden Ergebnisse empirischer Studien dargelegt, die die Auswirkungen von Buyouts auf das Beschäftigungs- und Gehaltsniveau in Abhängigkeit der Strategie der Private Equity Gesellschaft zeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffliche Grundlagen
2.1 Private Equity: Definition und Abgrenzung
2.2 Buyout
2.3 Human Resource Management (HRM)
3 Maßnahmen der Private Equity Gesellschaft - Managementebene
3.1 Finanzielle Anreizschemata
3.2 Monitoring
3.3 Mentoring
3.4 Austausch des Managements
3.5 Kontrollfunktion des Fremdkapitals
4 Maßnahmen der Private Equity Gesellschaft - Mitarbeiterebene
4.1 Asset Extraction (Kurzer Anlagehorizont)
4.1.1 Organisationale Restrukturierung
4.1.2 Arbeitsbeziehung zwischen Management und Mitarbeitern
4.2 Asset Renewal Strategie (Langer Anlagehorizont)
4.2.1 Organisationale Restrukturierung
4.2.2 Arbeitsbeziehung zwischen Management und Mitarbeitern
5 Reale Auswirkungen - Mitarbeiterebene
5.1 Beschäftigungszahlen
5.1.1 Management Buyout (MBO)
5.1.2 Management Buyin (MBI)
5.2 Gehaltsniveau
5.2.1 Management Buyout (MBO)
5.2.2 Management Buyins (MBI)
5.3 Ergebnis
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Halbjährliche Private Equity Investitionen in Deutschland seit 2008
Abbildung 2: Ablauf eines Buyout Investments
Abbildung 3: Austausch des Managements USA – Europa
Abbildung 4: Anlagehorizont Buyouts Deutschland 1989 – 2011
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Anlagehorizont und HPWP
Abbildung 6: High Performance Work Practices
Abbildung 7: Verlauf des Organizational Slacks
Abbildung 8: Beschäftigungsentwicklung MBO / MBI
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
In jüngster Vergangenheit gerieten Private Equity Gesellschaften zunehmend in die Kritik von Politikern und Gewerkschaften. In Deutschland gab Franz Müntefering, ehemaliger SPD-Vorsitzender, mit seiner Aussage
„Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten - Sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter.“
(Bild am Sonntag, 2005).
den Anstoß zu einer kontroversen Diskussion über das Vorgehen und die Methoden von Private Equity Gesellschaften. Die Kritiker erheben in diesem Zusammenhang den Vorwurf, dass Private Equity Gesellschaften außerordentlich hohe Renditen bei einem Private Equity Investment überwiegend zu Lasten der Mitarbeiter des akquirierten Unternehmens erzielen. Befürworter von Private Equity Investments hingegen widersprechen diesem Vorwurf mit der Behauptung, dass die Beteiligung einer Private Equity Gesellschaft unter anderem zu einem effektiveren Management, verbesserten Human Resource Praktiken und einer erhöhten Investitionsbereitschaft in das Humankapital führt (Bacon, Wright, Ball & Meuleman, 2013). Die gegensätzlichen Standpunkte zeigen deutlich, dass die Meinungen über Private Equity-Beteiligungen und deren personalwirtschaftliche Auswirkungen auf das akquirierte Unternehmen weit auseinandergehen. Die Notwendigkeit zur Klärung dieses Widerspruchs wird dadurch bestätigt, dass die Auswirkungen von Private Equity Transaktionen auf das Human Resource Management aktuell verstärkt in den Fokus wissenschaftlicher Reflexion gerückt sind (Bacon et al., 2013; Rodrigues & Child, 2010).
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, systematisch aufzuzeigen, welche Konsequenzen sich bei einer Private Equity Transaktion durch eine Private Equity Gesellschaft auf das Human Resource Management des akquirierten Unternehmens ergeben. Private Equity Transaktionen umfassen eine Vielzahl an Unterformen von Eigenkapitalinvestitionen, deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich die dominanteste Form – Buyouts – thematisiert. Dabei werden die Konsequenzen für das Management und die Mitarbeiter differenziert betrachtet. Es wird zunächst gezeigt, wie eine Private Equity Gesellschaft nach einer Unternehmensübernahme durch Veränderung der Corporate Governance Strukturen des akquirierten Unternehmens das Management dahingehend diszipliniert und motiviert, in ihrem Interesse zu handeln. Im Anschluss daran wird dargelegt, dass sich in Abhängigkeit der Strategie von Private Equity Gesellschaften unterschiedliche Konsequenzen für die Mitarbeiter des akquirierten Unternehmens ergeben.
2 Begriffliche Grundlagen
2.1 Private Equity: Definition und Abgrenzung
Der Begriff Private Equity findet weder in öffentlichen Diskussionen noch in wissenschaftlichen Arbeiten einen einheitliche Verwendung. Aus diesem Grund folgt zunächst eine Erläuterung des Begriffs Private Equity. Unter Private Equity versteht man jegliche Form der Kapitalbereitstellung von voll haftendem Eigenkapital durch private oder institutionelle Anleger für (meist) nicht-börsennotierte Unternehmen (Vogt, 2009). Der Begriff Private steht für die nicht-öffentliche Form dieser Anlageklasse. Das Gegenteil dazu bildet Public Equity, bei dem die Eigenkapitalbeteiligungen an öffentlichen Börsen gehandelt werden (Hehn, 2011). Equity kennzeichnet den Eigenkapitalcharakter der Anlageklasse, d.h. der Eigenkapitalgeber nimmt uneingeschränkt an Gewinn und Verlust des Unternehmens teil (Leclere, 2013). Dadurch entsteht ein hohes Risiko für den Eigenkapitalgeber, da er in Höhe seiner Beteiligung für potentielle unternehmerische Verluste haftet (Kollmann, 2008). Bei wirtschaftlichem Erfolg liegt das Gewinnpotential deutlich über der durchschnittlichen Verzinsung von Fremdkapitalanlagen (RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, o.J.). Der Begriff Private Equity beschreibt demnach eine externe, außerbörsliche Eigenkapitalzuführung. Private Equity umfasst dabei verschiedene Eigenkapitalgeschäfte, wobei eine Differenzierung hinsichtlich des Entwicklungsstadiums des Unternehmens und des damit verbundenen Investitionsrisikos gemacht werden kann. Die verschiedenen Formen von Private Equity sind unter anderem Angel Investing, Venture Capital und Buyouts (Cendrowski, Petro, Martin & Wadecki, 2012). In dieser Arbeit erfolgt ausschließlich die Betrachtung der Konsequenzen von Buyouts auf das HRM. Eine solche Eingrenzung ist sinnvoll, da Buyouts als Unterform der außerbörslichen Eigenkapitalfinanzierung einen dominanten Anteil in allen nationalen und internationalen Beteiligungsmärkten ausmachen. In Anlehnung an die Ergebnisse des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften erfolgt nun eine Darstellung des Anteils von Buyout Investitionen innerhalb des gesamten Private Equity Marktes in Deutschland.
Abbildung 1: Halbjährliche Private Equity Investitionen in Deutschland seit 2008
(Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, 2014)
Auch im europäischen Raum sind Buyouts die vorherrschende Form von Private Equity Investitionen. In 2007 wurden 79% des gesamten Private Equity Investitionsvermögens in Buyouts investiert. Im Jahr 2009 waren es trotz eines starken Rückgangs - auch bedingt durch die Finanzkrise - noch 53% und in 2010 waren es 71% des Investitionsvolumens der gesamten Private Equity Anlageklasse (Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, 2010).
2.2 Buyout
Unter einem Buyout versteht man eine zeitlich begrenzte Unternehmensübernahme eines Unternehmens(-teils) durch einen oder mehrere Finanzinvestoren (meist Private Equity Gesellschaften, fortan PEG), gegebenenfalls unter Beteiligung eines internen bzw. externen Management Teams (Cumming, 2012). Bei einem Buyout Investment sind folgende drei Hauptakteure auszumachen: Auf der einen Seite die Investoren (sog. Limited Partner), die als bloße Kapitalgeber auftreten, denen ein Renditeanspruch, in der Regel aber kein Mitspracherecht hinsichtlich der Investitionsentscheidungen der PEG, zusteht (Appelbaum & Batt, 2012). Investoren sind überwiegend institutionelle Anleger, wie Pensionskassen, Investitionsfonds, Universitätsstiftungen und zu einem geringeren Anteil auch vermögende Privatanleger (Demaria, 2013) Dem gegenüber stehen die akquirierten Unternehmen als Kapitalnehmer. Als Verbindungsinstitution beider Seiten treten die Finanzintermediäre auf. Bei der Fokussierung dieser Arbeit auf Buyouts handelt es sich bei den Finanzintermediären um PEG (sog. General Partner