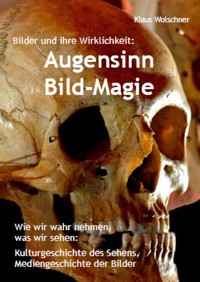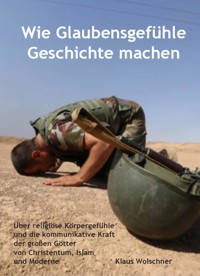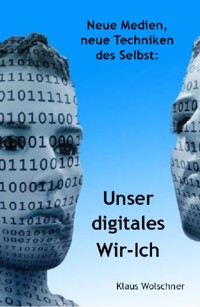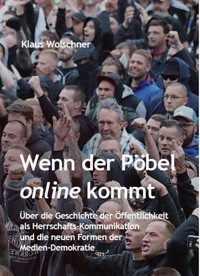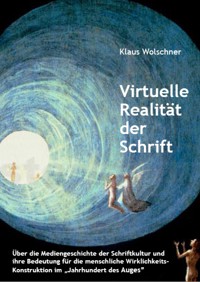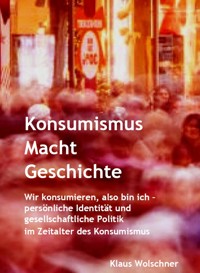
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Was ist Konsumismus? Ein frecher kleiner Medienwissenschaftler, Norbert Bolz, hat die großen konservativen Kulturkritiker und Geistesaristokraten wie Heidegger oder Adorno (und viele andere) herausgefordert mit einem Büchlein unter dem provokanten Titel: "Das konsumistische Manifest" (2002). Der "Konsumismus", behauptete Bolz, ist die Gesellschaftstheorie, die anerkennt, dass das entfesselte Konsum-Begehren die Triebkraft der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist. Einzig der Konsum, so Bolz, könnte alte und religiöse nationale Rivalitäten überwinden helfen, weil die Bedeutung des individuellen Konsums andere Identifikations-Konstruktionen verblassen lässt. Denn: "Der Konsum ist heute das Medium einer Kultur des Selbst." "Konsum" geht also über die Grundbedürfnisse hinaus. Die Produkte werden aus Holz, Mehl oder Plastik gemacht, die Traumbilder aus Kommunikation – vermittelt über Medien. Von den Produkten haben wir eigentlich genug, von den Traumbildern nie - sie sind es, die wir begehren, wenn wir "shoppen", zappen oder doomscrollen. In der Herrschaft des Konsumismus liege so die Hoffnung, den religiösen, nationalistischen oder rassistischen Hass zu überwinden - der Konsum mache alle gleich. Das war von Bolz damals mutig formuliert, im Jahre 2002 kurz nach dem furchtbaren islamistischen Terroranschlag auf das World Trade Center in New York. Angesichts der Ratlosigkeit gegenüber dem seitdem wachsenden Islamismus bleibt es eine trotzige Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Konsumismus Macht Geschichte
Wir konsumieren, also bin ich – persönliche Identität und
gesellschaftliche Politik im Zeitalter des Konsumismus
Von Klaus Wolschner
Bremen, März 2025
INHALT
Vorwort: Wir konsumieren, also bin ich. Ich ohne Wir, Bilder der symbolischen Selbst-Vergewisserung, Freiheit und Narzissmus, Konsumistische Identität
Geld und Mode
Vorgeschichte des Konsumismus. Die Fahrt ins Paradies der Phantasie, Kathedralen der Transzendenz, Philosophie des Geldes, Der soziale Sinn der Mode, Revolution des Konsums in der frühen Neuzeit. Genuss der Kolonialwaren, Ökonomie der Sklaverei. Die Gier nach Gold, Silber, Baumwolle und Seide, Zucker, Tee, Kaffee, Geltungskonsum der Sänften, „Pursuit of Happiness". Keine Revolution gegen die Sklaverei. Bürgerkrieg in den USA, Thomas Jefferson und die Sklaverei, Revolution in Saint-Domingue/Haiti:
Neuzeitlicher Medien-Konsum. „Lesesucht“ – vor allem der Frauen, Unkontrolliertes Wissen. Vom Konsum der Neuzeit zur industrielle Revolution
Demokratisierung des Konsums - Konsumismus
Warenhäuser des 19. Jahrhunderts – Konsum-Traum für alle. Feminismus des Konsums. Amerika - die USA betreten die Weltbühne. Fortschrittskreativität, Austauschbarkeit als Konzept der Arbeitsprozesse, Das mediale Konsumparadies.
Erfindung des Konsumismus – die goldenen 1920er. Nullpunkt des Sinns, Der neue Relativismus, Freizeit-Traum der goldenen 20er, Psychologie der Massen, Das Ende der Republik
Das Sehen der Moderne. Bilderflut und Aufmerksamkeit, Das 20.Jahrhundert als „Jahrhundert des Auges“: Film und Fernsehen
Von der Arbeits- zur Freizeit-Konsum-Gesellschaft. Keine Humanisierung der Arbeit, Individualismus der Warenwelt. National-sozialistische Kraft durch Freude. Hitlers Volksstaat, Ausplünderung der Juden und der besetzten Länder, „Gefälligkeitsdiktatur“. Wirtschaftswunder - Überwindung des Nationalsozialismus. Maggi und Überraschungs-Ei, Strukturwandel der Öffentlichkeit – Fernsehen, 1968 – alte Konsumkritik, neuer Hedonismus.
Konsumkritik von links und von rechts. Säkulare Krisenwahrnehmung in Weimar, konservative Kulturkritik auch von links, Marcuse und die „repressive Toleranz“. Konsumismus schlägt Kommunismus – das Ende der DDR
Die Zukunft – digitaler Konsumismus
Demokratie in Zeiten des Konsumismus. Marketing der Demokratie statt herrschaftsfreier Dialog. Globalisierung des Konsumismus. Japan, China, islamische Welt – der Konsumismus integriert. Öko-Krise des Konsumismus „Degroth“ oder: Wirtschaftswunder-Demokratie in der Krise, Öko für alle? Nur virtueller Konsumismus lässt sich globalisieren
Digitale Realität / Digitalisierung des Konsums. Die Wirklich der digitalen Netze, Big Data - das neue „Wir“,Die visuelle Konsumlust und der neue Feminismus, Herrschaft der digitalen Zeitgenossen oder Schwerkraft des Leibes?
Literaturhinweise
Vorwort
Konsumismus macht Geschichte
Der Mensch ist das Tier, das kein Tier sein will. Er verdeckt seine Haut, übertüncht seine Gerüche, schmückt seine natürliche Gestalt, ergänzt seine Körperkraft mit Werkzeugen und Waffen. Als „animal symbolicum“ hebt er mental ab, phantasiert sich gottgleich, verbreitet Ideen. Der Mensch transzendiert mit seinen großen Ideen seine schlichte Existenz, er ordnet zumindest geistig die Welt, rechtfertigt Ungleichheit und Gewalt. Große Illusionen schienen Geschichte zu machen.
Und dann haben die alten Kolonialwaren – Baumwolle und Bananen, Kakao und Tabak, Kaffee und Tee, vor allem der Zucker - die Menschen in die banale Konsumgesellschaft gelockt.
„Konsumismus“ ist der Geist der modernen Welt geworden. Es geht nicht mehr ums Überleben, sondern um das gute Leben. Nachdem die Aufklärer die Welt entzaubert hat, müssen spirituelle wie profane Utopien und alle anderen geistigen Konstruktionen, die eine Kompensation für das elende Leben versprachen, vor den Verlockungen des Konsums kapitulieren. Das konsumistische Begehren beherrscht die Individuen.
„Konsum“, der kulturelle Phantasien und Freizeit-Vergnügen einschließt, ist ein Schlüsselbegriff zum Verständnis moderner Gesellschaften geworden. Ist das gut oder schlecht? Das ist eine Frage, die die profanen Priester der Moderne interessiert. Und die sind dagegen. Den Konsum der „Massen“ als „Kulturindustrie“ und „Massenbetrug“ abzukanzeln war lange Jahrzehnte eine Attitude der linken Bürgerkinder. „Bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie Ich sagen.“ Der Satz stammt nicht von Martin Heidegger, dem konservativen Philosophen, der 12 Jahre NSDAP-Mitglied war (und nie ausgetreten ist), sondern von Theodor W. Adorno. Das Buch heißt „Minima Moralia“. Akademisch anspruchsvolle Kost für Menschen, die in der Schule griechisch gelernt haben. Nichts für das einfache Volk. Die Menschen lieben das Kino? Das allerletzte für Adorno: „Dem Film ist die Verwandlung der Subjekte so differenzlos gelungen, dass die ganz Erfassten, keines Konflikts mehr eingedenk, die eigene Entmenschlichung als Menschliches, als Glück der Wärme genießen.”
Entmenschlichung des Menschen! Heidegger verfremdete seine schlichte Massenpsychologie mit einem anderen Vokabular. Heidegger spricht von den Masse-Menschen, die vom „Man“ beherrscht seien, und die haben kein „eigentliches“ Leben, haben keine „Eigentlichkeit“, sind verfallen an „das Gerede“. (Und bedürfen eben, das sagte Heidegger 1927 noch nicht, eines Führers.) Ist das die Bilanz der „Dichter und Denker“ im 20. Jahrhundert?
Seit jeher suchen die Menschen ihr Glück im materiellen und im ideellen Konsum, und der „entmenschlicht“ den Menschen, der ihnen das nicht gönnt, wer das nicht akzeptieren kann. Es kommt also darauf an, die moderne Welt des Konsumismus zu begreifen – in ihren Auswirkungen auf die Individuen, die Kulturen und die politischen Auseinandersetzungen.
Traumliebhaber am Traumstrand
Die Traumbilder des Konsums sind es, die das „amerikanische Jahrhundert“ des Massenkonsums unwiderstehlich gemacht haben: Traumfigur, Traumauto, Traumküche, Traumliebhaber am Traumstrand. Die Kultur des Konsumvergnügens verändert die menschliche Subjektivität und Individualität. Erst das „Wirtschaftswunder“ des steigenden Konsums hat den Nationalismus in den Köpfen der Westdeutschen verdrängt. An dem konsumistischen Begehren ist dann auch die kommunistische Idee in der DDR gescheitert. Kein Herrscher, auch kein Autokrat, kann es sich heute noch leisten, das Konsumbedürfnis seines Volkes zu ignorieren. Wer herrschen will, muss ihm dienen. Die alten Heilsversprechen, die das konsumistische Leben transzendiern und ihm einen höheren Sinn zu geben versprechen, sind nur noch dünne Schichten an der Oberfläche. Auch die ökologischen Kritiker wollen die Welt nicht durch radikalen Konsumverzicht retten, sondern durch einen „anderen“ Konsum. Es gibt nichts mehr, wofür es sich zu sterben lohnen würde. Die islamische Kultur scheint die letzte, die der Macht des Konsums glaubt trotzen zu können.
Aber was ist Konsumismus?
Ein frecher kleiner Medienwissenschaftler, Norbert Bolz, hat die großen konservativen Kulturkritiker und Geistesaristokraten wie Heidegger oder Adorno (und viele andere) herausgefordert mit einem Büchlein unter dem provokanten Titel: „Das konsumistische Manifest“ (2002). Der „Konsumismus“, behauptete Bolz, ist die Gesellschaftstheorie, die anerkennt, dass das entfesselte Konsum-Begehren die Triebkraft der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist. Einzig der Konsum, so Bolz, könnte alte und religiöse nationale Rivalitäten überwinden helfen, weil die Bedeutung des individuellen Konsums andere Identifikations-Konstruktionen verblassen lässt. Denn: „Der Konsum ist heute das Medium einer Kultur des Selbst.“
In der Herrschaft des Konsumismus liege so die Hoffnung, den religiösen, nationalistischen oder rassistischen Hass zu überwinden - der Konsum mache alle gleich. Das war von Bolz damals mutig formuliert, im Jahre 2002 kurz nach dem furchtbaren islamistischen Terroranschlag auf das World Trade Center in New York. Angesichts der Ratlosigkeit gegenüber dem seitdem wachsenden Islamismus bleibt es eine trotzige Hoffnung.
Begriffe mit der Endung „-ismus“ bezeichnen allgemeine Gedanken- und Glaubensüberzeugungen, die kollektives und individuelles menschliches Verhalten auf einer geschichtsträchtigen abstrakten Ebene erklären wollen. Individualismus, Katholizismus, Kommunismus oder Liberalismus wären Beispiele.
Der Begriff „Konsumismus“ behauptet, dass für die Menschen der Konsum eine große, entscheidende Bedeutung hat - für ihre persönliche Identität wie für Gemeinschaften, also historische Prozesse. „Konsum“ geht also über die Grundbedürfnisse hinaus. Die Produkte werden aus Holz, Mehl oder Plastik gemacht, die Traumbilder aus Kommunikation – vermittelt über Medien. Von den Produkten haben wir eigentlich genug, von den Traumbildern nie - sie sind es, die wir begehren, wenn wir „shoppen“, zappen oder doomscrollen. Die Traumbilder des Marketings sind viel größer als die Produkte, für die sie werben. Mit „Geltungskonsum“ (Thorsten Veblen) konstruieren Menschen eine besondere Identität. Es geht um Tagträume, der moderne Konsument wird von der Werbung angeregt, sich seiner Phantasie hinzugeben – so wie Kinder eben mit einer Banane am Ohr telefonieren oder mit einem Plastik-Schwert Superman spielen können.
Der Konsumismus der schwachen Bindungen
Im Unterschied zu den starken Bindungen der Gemeinschaft kennt die liberale Gesellschaft nur schwache Bindungen. Diese schwache soziale Bindung begreift Bolz als Stärke dieses Systems. In der globalisierten Welt wird der Konsumismus zum einzigen denkbaren Lebensstil. Chinesische, russische und amerikanische, arabische und europäische Jugendliche lieben McDonalds und Jeans und dieselben Handy-Spiele mit ihren Bilder-Fluten. „Diese Welt ist — mit Max Webers Lieblingsvokabel — temperiert, und heiße Herzen empfinden sie als zu kalt. Doch heiße Herzen denken schlecht. Sie begreifen nicht, daß wir den Frieden genau so wie die Freiheit gerade der Entfremdung verdanken.“ (Bolz)
Gesellschaften sind komplexe Gebilde, wer sie „auf den Begriff“ bringen will, muss vereinfachen. Mit dem Begriff „Konsumgesellschaft“ soll herausgestrichen werden, dass Konsum eine eminent wichtige Rolle spielt. Er grenzt die Konsumgesellschaft ab von der der feudalen „Ständegesellschaft“ und von der „Klassengesellschaft“. Ebenso markiert „Konsumismus“ in provokanter Weise den großen Unterschied zum „Kommunismus“ – nicht mehr die Utopie einer konfliktlos geordneten Arbeitsgesellschaft beherrscht die Köpfe, sondern die Utopie des Konsums. Kaum jemand spricht noch von der „Humanisierung der Arbeit“, kaum eine Belegschaft der realsozialistischen Länder hat ihren „ihren“ vergesellschafteten Betrieb verteidigt.
Wenn Individuen sich freiwillig auf einer gesellschaftlichen Ebene zusammenschließen, um die Regeln ihres Zusammenlebens gemeinsamen zu beschließen, nennt man das Demokratie. Aber Demokratie bedeutet, dass die Gesellschaft die Rahmenbedingungen setzt und ansonsten die Menschen weitgehend in Ruhe lässt. Demokratie muss vor allem die Bedingungen dafür garantieren, dass jede/r am gesellschaftlichen Reichtum „gerecht“ teilhaben kann und ansonsten seines Glückes Schmied werden kann. Demokratie wird so zum Versprechen „Konsum für alle“. Denn gleichberechtigt sind die Menschen vor allem als Konsumenten, und im Konsum erleben sie sich als Besondere. Das ist ein amerikanischer Traum, 1923 hat Hazel Kyrk die Theorie des Konsums formuliert.
Als „Konsumismus“ hat Steven Miles 1998 die moderne Lebensweise („Way of Life“) bezeichnet. Das Konsumieren ist zum wichtigsten Lebenssinn geworden. Es geht nicht um den effektiven Verbrauch von nützlichen Gegenständen, sondern um die Konsumwunsch-Träume und Konsumverzicht-Ängste. Sicher wird noch gearbeitet, manche lieben sogar ihren „Job“. Man hat weiterhin Familie, Freunde, Bekannte. Viele sind politisch interessiert in dem Sinne, dass sie informiert sein und unter Freunden diskutieren wollen. Wenige sind aktive Mitglieder einer Partei oder Kirche. Die gemeinschaftlichen Bindungen sind nicht verschwunden, aber verblasst.
In der modernen „konsumistischen“ Gesellschaft verdrängt das Streben nach Geld die ewige Suche nach Sinn. Es gibt keine Wahrheit mehr und keine „Häretiker“. Nur wenn ich den anderen in seinem Anderssein respektiere, kann ich mit ihm in Austausch treten – und den gerechten Austausch vermittelt das Medium Geld und nichts anderes. Der Konsumismus gibt uns den Rahmen für Sicherheit und Vertrauen, er wird zur Ersatz für die Religion und die einzige Hoffnung gegen den religiösen Fanatismus: „Der Konsum integriert die postmaterialistische Gesellschaft durch Verführung. Das gemeinsame Angebot der postmodernen Märkte lautet: Wiederverzauberung der entzauberten Welt.“ (Bolz) Während die traditionelle Kulturkritik die Fetischisierung der Waren als Grundübel betrachtete, setzt Bolz darauf alle Hoffnung.
Demokratisierung des Konsums
In den modernen westlichen Gesellschaften haben aufgrund der kolonialistischen Ausbeutung der „dritten“ Welt und einer technologischen Entwicklung, die preiswerte Massenproduktion ermöglichte, alle gesellschaftlichen Schichten Zugang zum Konsum bekommen. Auf dem vormodernen Dorf produzierten die Menschen viele ihrer Waren für ihre „Notdurft“. Nur die reichen Oberschichten konnten sich Luxus und Geltungs-Konsum leisten. Kolonialismus und industrielle Revolution ermöglichten den Übergang zu einer „Konsum-Gesellschaft“ für alle.
Dieses Konsumverhalten, das im 20. Jahrhundert in Europa und den USA zum „Massenkonsum“ wurde, hat sich im adeligen Konsum der „höfischen Gesellschaft“ und im Luxus-Konsum der neuzeitlichen Handelsstädte vorbereitet. Die Weltausstellungen seit 1855 wurden zu Konsumgütermessen. Im 19. Jahrhundert waren die „Passagen“ die Vorboten für konsumistischer Status-Konsum, die Warenhauskataloge haben die Chance geboten, beim Blättern zu träumen. In den Warenhäusern gab es dann am Ende des 19. Jahrhunderts das konsumistische Erlebnis für alle, eben auch und vor allem für die Frauen. Die Geschichte der Mode ist die Vorgeschichte der Frauen-Emanzipation.
Wenn Geld das Medium wird, das alle Wünsche und jedes Begehren erfüllbar macht, beginnt man Geld als bloße Möglichkeit wertzuschätzen, auch wenn man diese Möglichkeit nicht wirklich nutzt, sondern „spart“. Schon der deutsche Soziologe Georg Simmel hat in seiner „Philosophie des Geldes“ (1900) festgestellt, dass Geld wird zum „Wert schlechthin“ wird „und eben dadurch psychologisch für die meisten Menschen zum absoluten Zweck“.
Konsum der Zeichen
Jean Beaudrillard hat 1966 (in seiner Dissertation „Das System der Dinge“) den Alltag als ein Zeichensystem beschrieben, in dem die Dinge wie Wunschmaschinen funktionieren. Autos vermitteln Fahrspaß, Duschgels sexuelle Attraktivität, Sammlerstücke bedeuten bildungsbürgerliches Prestige. Fälschungen befriedigen das gebliebene Bedürfnis nach ‚Echtem‘. Verbraucher konsumieren die Traumbilder des Designs und der Werbung.
Fiktionswerte haben schon immer über die materielle Dingwelt geherrscht. „Wenn man in ein Café geht, ist man nicht primär am Kaffee interessiert, sondern an den Leuten, der Atmosphäre, der Gelegenheit zum Gespräch.“ (Bolz) Auch die „einfachen“ Menschen, die einmal arbeitende Klassen genannt wurden, wollen sich bezaubern lassen, der Kampf um das Lebensnotwendige füllt sie nicht mehr aus. Dem dient eine ausufernde Unterhaltungsindustrie, die sogar echte Risiko-Abenteuer anbietet, wo das Leben vor lauter Versicherungen kein Risiko mehr bietet.
Während der Gebrauch von Dingen seine Grenze im vollen Bauch findet, kennt der Konsum der Zeichen keine (ökologischen) Grenzen. Die Dinge lassen sich als Zeichen beliebig konsumieren, ohne an soziale oder materielle Realitäten gebunden zu sein. Das war ein Gedanke der Situationistischen Internationale, die der französische Künstler und Philosoph Guy Debord als „Gesellschaft des Spektakels“ (1967) identifiziert hatte. Das Reale ist in der medial erzeugten Hyperrealität aufgegangen, so erklärte Beaudrillard schon 1976: „Das Reale ist tot, es lebe das realistische Zeichen!“
Und er ahnte noch nichts von der Künstlichen Intelligenz.
Wir konsumieren, also bin ich – über konsumistische Identität
Bei der Identität einer Person geht es um das, was ihr wichtig ist, was sie an sich selbst richtig und schön findet. Bei der Identität geht es um eine bewusst reflektierte Ebene und viel unbewusstes Empfinden.Wenn Identität sich nicht mehr zwingend in sozialen Umgebungen bildet, wird Identität zu einer Konstruktion, die im Laufe des Lebens immer wieder neu hergestellt werden muss. Bei der Suche nach Identität geht es dann um die Stimmigkeit in der jeweils veränderten sozialen Lebensumwelt. Bei dem sprachlich artikulierbaren Selbstverständnis geht es um die Konstruktion von Sinn, der das individuelle Leben einbindet in ein größeres Ganzes.
Mit dem Essen beginnt die gemeinschaftliche Ess-Kultur. Aus dem gemeinsamen Topf darf nur essen, wer zur engsten Gemeinschaft gehört. Wenn der stärkste Hunger gestillt ist, erhebt sich über dem Teller der Duft der gut gewürzten Speisen. Der eigene Teller und das Besteck stehen am Anfang der hohen Esskultur. Die Serviette gehört zur „Herrschaft der Dinge“ - man mache sich die Finger nicht „schmutzig“. Nach-Tisch ist Luxus. Wie der Wein. Im Gespräch mit Gästen erweitert sich die Gemeinschaft zur feinen Gesellschaft, die sich bedienen lässt. Die Arbeit tun die anderen. Deshalb, so argumentiert Mike Featherstone, „kann der Konsum nicht mehr als unschuldiger Akt betrachtet werden“. Konsum ist eine konkrete Handlung im Rahmen „der gegenseitigen Abhängigkeiten und Netzwerke, die die Menschen in der ganzen Welt in Bezug auf Produktion, Konsum und auch die Anhäufung von Risiken miteinander verbinden“.
Wenn Menschen das, was sie als richtig und schön empfinden, im realen Leben nicht verwirklichen können, lassen sie ihre Phantasie das Leben bereichern. Dies könnte man als Selbsttäuschung kritisieren, aber es ermöglicht den Menschen, ihre Tagträume zu genießen. Das ist die auch alte Funktion der Fetische. Das Kreuz – egal ob aus Holz oder aus Kreide - verbindet sich mit der Hoffnung auf Unsterblichkeit.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
In Zeiten der Not spendet sakraler Konsum Trost. Wer nichts zu verlieren hat, sucht im Glauben einen Ersatz für Identität und Geltung.Das wussten die Väter Israels, schon im Deuteronomium (5. Buch Moses) heißt es: „Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des HERRN geht.“ Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow (1908-1970) hat diesen alten Gedanken zu seiner „Bedürfnispyramide“ umformuliert, die mit denGrundbedürfnissen nach Nahrung, Wärme und Schlaf beginnt und über die „Sozialbedürfnisse“ (Wertschätzung) hin zu dem Bedürfnis nach Selbsttranszendenz führt.
Die Weisheit „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ wird im Neuen Testament aufgegriffen und das Brot wird im Christentum zur zentralen Brücke zwischen dem leiblichen Leben und dem transzendenten Erleben. Die Hostie als zentrales „Medium" der Abendmahlfeier hat eine 1500-jährige Erfolgsgeschichte. Das Abendmahl stiftet Gemeinschaft und das Brot wird zu einem heiligen Zeichen, es stiftet direkte Kommunikation mit Gott. Der Glaube an die Präsenz des Leibes Christi ist für die an Wunder gewöhnten Menschen selbstverständlich. Erst die Reformation hat die Hostie zum Zeichen zurückgestuft - im Zeitalter der Schrift ist Kommunikation über Zeichen auch ohne reale Präsenz möglich. Aber auch das zum Zeichen reduzierte Abendmahl wird in einer Weise ritualisiert, die den aufgeklärten Alltagsverstand übersteigt. „Kommet und schmecket" ist der Lockruf auch in der protestantischen Liturgie noch heute. „Christi Blut, für dich vergossen“ lautet die Abendmahls-Formel, die in der Tradition des Psalmes 34 steht: „Spürt und seht, dass der Ewige gütig ist. Glücklich ist der Mann, der auf Ihn vertraut“.
Sakraler Konsum und spirituelles Marketing
Die Erfolgsgeschichte des Christus-Glaubens hat Rüdiger Graf mit Kategorien des modernen Marketings beschrieben. Der am Kreuz gescheiterte Jesus wurde von einigen seiner Anhänger mit griechischer Vorbildung in einen griechischen „Christos“ verwandelt. Der Mythos stiftete eine starke neue Gemeinschaft dank der Lehre vom „Sühnopfer“ eines Gottessohnes.
Missionare aller Couleur verwenden viel Phantasie darauf, den Menschen als sündig darzustellen, um damit das Bedürfnis nach Erlösung zu schaffen. Dass die Sexualität als Erbsünde den Bedarf an Erlösung totsicher schafft, war die Idee des Augustinus 400 Jahre nach Jesu Tod. Die Adressaten der Predigt von der sündigen Sexualität „kaufen“ am Ende die Angebote der Vergebung. Genauso wie Menschen, denen gepredigt wird, dass Falten etwas Unmenschliches seien, am Ende eine Faltencreme kaufen. Geradezu harmlos war dagegen der jüdische Ritus des Osterlamms - auch das Osterlamm dient der Entsündigung. Es wird rituell geschächtet und dann von den Opfernden in einem üppigen Mahl verzehrt. Ein Menschenopfer war zu Zeiten des Jesus in Judäa ein religiöser Skandal, es wurde wird im griechisch-christlichen Ritus zum Zentrum von virtuellen Fetisch-Handlungen und regelmäßig mit den lebensnahen Metaphern vom Brot und Wein in Erinnerung gerufen. Das Angebot der Erlösung von den Sünden erfordert Bedürfnisweckung, permanente Arbeit am schlechten Gewissen.
Das Ich ohne Wir
Solche Riten funktionieren nur in einer Gemeinschaft gleichgesinnter. In dem Begriff „Commune“ steckt die alte Sehnsucht nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Der Mensch ist kein einsamer Wolf, sondern ein Gemeinschaftswesen. Vom Bauch her fühlt er sich wohl in der kleinen Gemeinschaft, im Dorf, in der Familie oder dem Familienersatz. Das ist die Grunderfahrung des Säuglings, die die Psyche des erwachsenen Menschen prägt. In Japan gibt es dafür das Wort „Amae”, was mit „Wunsch nach Anlehnung” und „Freiheit in Geborgenheit” übersetzt wird. Diese Sehnsucht nach einer Welt, in der es keine Bösartigkeiten gibt, hat die Phantasien vom Paradies geprägt und vom ewigen Leben. Jean-Jacques Rousseau hat diese Sehnsucht nach Harmonie als den Wunsch „Zurück zur Natur“ formuliert.
Je mehr die kleine Gemeinschaft von der Lebenswelt der großen Gesellschaft ersetzt wird, desto geringer wird die gefühlsmäßige Bindung. In der Stadt müssen die Menschen als Vereinzelte mit vielen Fremden halbwegs friedlich auskommen. Die gemeinschaftlichen Bindungen werden schwächer und setzen einsame Menschen frei. Scheinbar „selbstloses“ Geben, das auf Reziprozität „irgendwann“ setzt, spätestens im ewigen Leben, wird verdrängt von den Maßstäben des (geldwerten) Vorteils. Selbst Brüder beginnen, ihren Tausch nach dem Geldwert der getauschten Güter zu bewerten. Der moderne Mensch lebt in einer Gesellschaft der Fremden. Geschenke werden taxiert nach dem Wert dessen, was man als Geschenk bekommen hat. Wenn menschliche Beziehungen „monetarisiert“ werden, schwächt das die Gefühlsbindung, die im Gabentausch immer mitschwang. Der Stadtmensch lernt, den vielen Fremden gleichgültig zu begegnen. Für die Waren, die gehandelt werden, ist es egal, wer sie produziert hat, sie bekommen ein Eigenleben. Das Produkt der Arbeit wird dem Produzenten entfremdet.
Freiheit und Narzissmus
Den Verlust der traditionellen Gemeinschafts-Bindungen erlebt der aufgeklärte Mensch als Gewinn von Freiheit, er begreift sich als „freischwebendes Subjekt“, als „Ich” ohne „Wir”.Dieses Subjekt hat sich aus seinen symbolischen und kulturellen Bedeutungszusammenhängen befreit, es hat die Freiheit gewonnen, sich kulturell neu zu orientieren und beliebig und befristet zu binden. Der neue soziale Raum des freischwebenden Subjektes war die Stadt, in der der vereinzelte Mensch mit „Fremden“ neue kommunikative Freizeit-Gemeinschaften bilden konnte. In der Stadt kann man sich mit Fremden austauschen, man tritt ihnen aber nicht zu nahe. Im Unterschied zum Dorf, wo es kaum eine „Intimität“ gibt, weil alle alles über alle wissen, entsteht in Abgrenzung zu der städtischen Öffentlichkeit ein Bereich der Intimität, der als „privat“ aus der öffentlichen Kommunikation ausgeschlossen werden muss.
Der Verlust des Gemeinschaftssinns betrifft auch die Hausgemeinschaft (oikos), „flexibel“ wird der Mensch auch im Hinblick auf persönliche Bindungen, die binden nur für „Lebensabschnitte“. Familie ist Kleinfamilie zum Zwecke der Aufzucht der unmündigen Kinder, die pragmatische Ehe muss also maximal 15 Jahre halten, auch wenn Eheverträge keine Ablauf-Fristen haben. Familie ist nicht mehr prioritär ein unkündbarer Generationenzusammenhang, dessen Bindungen von dem Gedanken leben, der Mensch könne in seinen Kindern fortleben. Es gibt nur das Hier und Jetzt, der moderne, freischwebende und flexible Mensch sorgt sich um seine Gesundheit, um seine Konsum-Chancen und um die hedonistische Gestaltung seiner Freizeit.
Und obwohl sich die meisten Menschen in ihrer Patchwork-Identität höchst individuell vorkommen, ähneln sich die Identitätskonstruktionen. Konsum erscheint uns individuell, ist aber sozial. Kein Produkt in den Tempeln des Konsums ist ein Unikat. Kein Wunsch kommt aus dem Nichts in uns, Wünsche kommen aus den Bildern, die wir sehen. Selbstverwirklichung gibt es nur im „Wir“ der Nachahmung. Die Bilder und die Muster des individuellen Konsums liefern die Massenmedien. Die Filme – in der Tradition der Romane des 18. Und 19. Jahrhunderts - liefern sogar die Muster der wahren Liebe. Die Partner gibt es online im Abo bei LemonSwan (Starterpaket 139,95,- Euro, dann mtl. 38,90 Euro) oder Parship (54,90 Euro. mtl. bei Jahres-Abo)
Bilder der symbolischen Selbst-Vergewisserung
In vormodernen Zeiten gab es nur wenige Bilder im Kopf, die immer wieder betrachtet werden konnten: Das Haus, die vier Wände, die Familie, den Gekreuzigten, den Kirchturm und den Horizont. Es waren innere Bilder der Gemeinschaft. Nur die Reichen konnten sich ein Portrait malen lassen. Angesichts der Techniken der Reproduktion von Abbildungen wurde im 19. Jahrhundert schon über die „Bilderflut“ geklagt. Dabei symbolisierten in analogen Zeiten die wenigen für die Erinnerung verfügbaren Bilder immer noch eine gemeinsame Wirklichkeit und wurden in Familien-Alben gesammelt. Erst die Selfies auf den Handys sind fast ausnahmslos „Ich-Bilder“, in der Kultur der Selfies spiegelt sich das Ich scheinbar mühelos. Aber diese Bilder-Medien sind soziale Medien, sie sind alle gleich.
In der Kulturkritik wird viel darüber geschrieben, dass die Kultur des diskursiven Textes verloren geht in der schönen neuen medialen Bilderwelt. Aber das ist eine Klage der Bildungsbürger. Die Mehrzahl der Menschen hat auch früher keine diskursiven Texte gelesen, sondern sein Ich aus der Spiegelung im Wir gewonnen.
Das um sein natürliches „Wir“ beraubte „Wir-Ich“ kann sein Spiegelbild nur als narzistisches Ich wahr-nehmen. Die animalische Leiblichkeit kommt nicht mehr mit, wenn das digitale Ich seine Höhenflüge antritt. Das narzistische Ich will den Leib beherrschen, aber es kommt nicht los von ihm. Das Selbstbild scheitert immer wieder an der Schwerkraft – und ist schließlich verdammt dazu, sich zu arrangieren.
Der medial vermittelte Bilder-Konsum liefert das Reservoir für die Stütze der personalen Identität. Die Beliebigkeit des Konsums prägt auch die Rahmenbedingungen der kollektiven Identität. Die medial angebotenen und konsumierten virtuelle Sinn-Angebote sind austauschbar, sie bieten für die Ich-Identität nur flüchtige Verankerung an der theatralischen Oberfläche der Person. Das ist die Kehrseite der Freiheit. Ich kann mich heute mit einem Filmstar identifizieren und morgen bei einem indischen Guru Halt und Orientierung suchen. Während junge Menschen in traditionellen Gesellschaften durch ihre familiären und religiösen Einbindungen ein Leben lang geradezu schicksalhaft geprägt wurden, kann die Prägung durch die beliebig wechselnden Angebote der Konsum-Kultur keine tiefgreifende Bindungskraft entfalten. Der Sinn des Lebens war in traditionellen Einbindungen prägend vorgegeben, ein Mensch konnte sich nur konflikthaft davon frei machen. Der Preis der Freiheit des Konsumismus ist die schwache Bindung - ich kann den Job genauso wechseln wie das Rasierwasser, die Lebensabschnittspartner oder die Weltanschauung. Alles wird mit einem hohen Image-Faktor angeboten und mit einem flüchtigen Sinn für die Persönlichkeit.
Dieser vereinzelte Mensch kann nicht anders als eine narzisstische Subjektivität entwickeln, seine Identität entfaltet sich im Konsum. Daher der Konsumfetischismus. Nur „flexibel“ und flüchtig ist das narzisstische Subjekt in übergreifende kulturelle Bedeutungszusammenhänge verstrickt, es ist ungebunden und kann sich nicht als Gemeinschaftssubjekt „erfahren“. Der Konsumfetischismus prägt auch das Verlangen nach erotischer Verschmelzung mit einem Anderen. Die Wirklichkeit erlebt das narzisstische Subjekt in den projizierten Bildern des eigenen Selbst, Gemeinschaft wird dort als bedeutungsvoll erlebt, wo sie das Ego widerspiegelt und verdoppelt.
Konsumistische Identität
Das Streben nach Sozialprestige, das Bedürfnis, sich vor anderen auszuzeichnen, ist ein altes Motiv menschlichen Verhaltens. Je stärker der gemeinschaftliche Verband ist, desto bedeutsamer die Stellung im Verband. Zum Sozialprestige gehört die kollektive Erinnerung – an vergangene Heldentaten oder vergangene Bedeutung – und der Reichtum. Im modernen arbeitsteiligen Betrieb ist die „Stellung“ und „Bedeutung“ des Einzelnen schwer zu beschreiben und die Erzählungen der eigenen Wichtigkeit übertreffen in der Regel die reale Bedeutung bei weitem. So wichtig der Wunsch nach sozialem Aufstieg ist, so schwer ist er objektivierbar.
Sichtbar wird vor allem der demonstrative Konsum, zu dem der auch demonstrativen Müßiggang – die Freizeit – gehört. Materielle Güter dienen der Selbstdarstellung. Das neue, teure Kleid ist ein Objekt eines „erweiterten Selbst“, es wird bewundert und fühlt sich daher attraktiv an – wie das schnelle Auto, das (Pferde-)Stärke und Freiheit suggeriert. Die symbolische Bedeutung der Gegenstände trägt wesentlich zu ihrer emotionalen Realität bei. Mit den besonderen Düften, den farbigen Kleidern, dem kultivierten Essen und den kunstvoll gefertigten Dingen beginnt die kulturelle Evolution des Menschen, der sich aus dem Tierreich erhebt.
Genuss-Kommunikation und imaginativer Konsum sind wesentliche Mittel einer symbolischen Selbstergänzung zur Selbstdarstellung. Durch genussbringende Bilder bekommen die realen Güter ihr Traumpotential. Dabei ergibt sich zwingend der ständige Vergleich mit der Realität. Ein Ehering erinnert an die Hochzeit, die hohe Zeit einer emotionalen Bindung zwischen zwei Personen und wird bis zum bitteren Ende getragen. Der Mensch als „animal symbolicum" (Ernst Cassirer), als symbolschaffendes Wesen, kreiert eine Welt voller Bedeutungen.
Unsere Sehnsüchte, Lüste, Begierden und Ängste veranlassen uns, banale Dinge mit Bedeutungen aufzuladen. Diese Bedeutungen bilden ein Netzwerk symbolischer Sinnstiftung. Der symbolische Sinn ist der Stoff für das Gewebe von Gemeinschaften und damit für die soziale Ordnung. In modernen Gesellschaften wandern die Sehnsüchte, Lüste, Begierden und Ängste in die Sphären der Kultur und der Kultur des Spiels.
Viele materielle Güter erwerben wir nicht, weil wir ihren praktischen Nutzen brauchen. Das Produkt-Marketing in den reichen Ländern der westlichen Welt zielt auf kaufkräftige Kunden, die alles haben, was sie brauchen. Warum brauchen Menschen ein neues, größeres, stärkeres Auto? Die „Marke“ bietet Möglichkeiten der Identifikation. Deswegen ist das neue Auto für viele Männer ein Spielfeld der Männlichkeit. Der Kauf-Akt ist emotional aufgeladen, es geht um die Selbstbespiegelung der Identität. Im Shopping genießen wir das Begehren eines Objektes. Wir schmücken uns mit dem, was wir gekauft haben oder was wir kaufen könnten, weil andere es gekauft haben oder weil die Werbung es uns vorgeführt hat. Das betrifft Dienstleistungen wie Gegenstände, Ferienreisen, Tai Chi-Kurse, Uhren, Autos.
Konsumgüter funktionieren wie ein Make-up der Identität. Das Marketing bietet Formulierungshilfen für das Selbst-Bild. Der Konsumismus funktioniert wie eine ideologische Linse, durch die wir uns in der Welt erleben. Es geht zunehmend um virtuelle Erfüllungen. Und mehr an Sinn gibt es nicht. Wer niemanden hat, der ihn wirklich braucht und der ihm Aufmerksamkeit schenkt, kauft sich ein Haustier.
Auch die „einfachen“ Menschen, die einmal arbeitende Klassen genannt wurden, wollen sich bezaubern lassen, der Kampf um das Lebensnotwendige füllt sie nicht mehr aus. Mit bitterer Ironie hat Philipp Blom das „große Welttheater“ dieses modernen Konsum-Menschen beschrieben – als Zoo:
„Umgeben von künstlichen Felsen, sorgfältig kuratierten Pflanzen und eingehegt von hohen Zäunen lebt Homo sapiens occidentalis in seinem Freigehege, verfettet und gelangweilt. Er weiß, dass er für repetitive und sinnlose Handlungen belohnt wird, indem er regelmäßig zu fressen bekommt, vor Angreifern beschützt und medizinisch versorgt wird. Manchmal setzt die Verwaltung sogar ein paarungswilliges Weibchen ins Gehege. Natürliche Feinde hat er nicht, nur er selbst kann sich gefährlich werden. Es kostet viel Energie, diesen Zoo zu unterhalten. Er besteht nur noch auf Pump, von Ressourcen, die er sich von denen nimmt, die noch nicht geboren sind, noch nicht nein sagen können, von denen, die zu schwach sind, die nicht zählen. Die Zoobewohner aber sehen keine Alternative zu dem Leben, das sie führen, lenken sich mit Spielzeug ab, das die Zooleitung ihnen ins Gehege gelegt hat, abends mit Beleuchtung... Und da sitzen sie und kauen, weil es sonst nicht viel zu tun gibt.“
Das Bedürfnis nach Sinn
Für die alten Buch-Kulturen war es selbstverständlich war, dass große Horizont-Ideen wie Gott, Unsterblichkeit, Familie, Individuum und Freiheit das Feld des Sinns besetzt hielten. Jeder kann heutzutage glauben, was er will, es gibt keine verbindlichen gemeinsamen Horizont-Ideen mehr. In den sozialen Medien tobt sich die totale Beliebigkeit aus.
Gemeinsam ist den Menschen das Streben nur nach mehr Geld. „Mehr Geld“ist Lebenssinn-Ersatz. Die Produkte der Warenwelt machen sogar aus der Kritik an der Warenwelt ein Geschäft. Auch an Bioprodukten wird gut verdient. Und für die Suche nach den emotionalen und lebensgeschichtlichen Hintergründen des subjektiven Gefühls der „Authentizität“ gibt es die Psycho-Dienstleister. Während man, um sich als etwas Besonderes darzustellen, vorher noch Hermann Hesse, Goethe oder Proust im Regal oder zumindest die ZEIT unter dem Arm brauchte, reichen im Zeitalter der digitalen sozialen Medien ein paar Klicks für eine Inszenierung auf der Facebook-, Instagram- oder TikTok-App. Wer will, kann sich auch eine Kultur der Innerlichkeit leisten - als Distinktionsmittel gegenüber der Kultur des Massenkonsums.
Das Problem der Konsum- und Freizeitgesellschaft ist nicht, dass die Menschen sich zu Tode amüsieren. Sie würden sich zu Tode langweilen ohne Vergnügungs-Industrie. Die Erfolgs-Geschichten der Science-Fiction-Filme zeigen, was den Menschen fehlt: Bedrohung, Existenzkampf, Liebe. Eben Sinn. Die Vergnügungs-Industrie bietet auf Knopfdruck die Wiederverzauberung der entzauberten Welt.
Geld und Mode - Vorgeschichte des Konsumismus
Natürlich hat die Massengesellschaft des Konsums ihre Vorgeschichte. Schon in der Affenhorde gibt es eine Hierarchie beim Zugang zu den fetten Brocken der Beute. Konsum war immer schon ein demonstratives Zeichen der gesellschaftlichen Stellung. In den aufblühenden Handels-Städten brachte die Geldwirtschaft seit dem 14. Jahrhundert die herkömmliche soziale Ordnung durcheinander – sichtbar in den neuen Möglichkeiten des Konsums, vor allem an der Mode. Die Obrigkeiten wollten durch „Sittlichkeitsgesetze“ festzurren, wer sich wie standesgemäß zu kleiden habe und wer wieviel „Geltungskonsum“ in der Öffentlichkeit zeigen durfte.Geld und Mode waren die symbolischen Zeichen der neuen Zeit. Die Kleidung als „soziale Haut“ visualisierte die soziale Ordnung – und die Mode ist der Schauplatz der Revolte gegen die Selbstverständlichkeiten der alten Ordnung.
Genügsamkeit und Sparsamkeit sind die angemessenen Werte in einer Gesellschaft, in der immer wieder Hungersnöte und früher Hungertod eine ernsthafte Bedrohung für die meisten Menschen sind. Luxus und Prunk gehören zur Kultur der Reichen. Über Jahrhunderte waren die Gesellschaften, was den Luxus-Konsum angeht, stabil gespalten. Aus dem alten Rom sind diverse Reden über „Luxus-Dekadenz" und „Sittenverfall" überliefert, die aber keinerlei Bedeutung für den Adel hatten. Die feine römische Gesellschaft konnte bei ihren Gelagen beredt Klage führen, schreibt der Althistoriker Karl-Wilhelm Weeler, „man hatte ja schließlich die Rhetorikschule besucht.“ Man konnte „beim small talk auf Partys der Oberschicht … mit sorgenumwölkter Stirn in den Chor der Luxuskritiker einstimmen, die den Staat in Gefahr sahen - einen edelsteinbesetzten Becher mit altem Falernerwein in der Hand, auf einer von Purpurdecken und perlenbestickten Kissen gepolsterten Edel-Kline aus bester griechischer Produktion gelagert, mit dem Blick auf marmorinkrustierte Tricliniumwände, von Silbergeschirr überbordende Prunktische und Statuen alter Bildhauer-Meister aus Athens größter Zeit“.
Schon Aristoteles kritisierte in seiner Ethik die Menschen, die dem Geld und dem Ruhm nachrennen– und damit das wahre Glück verfehlen würden. Epikur predigte Lebensfreude aus dem Verzicht. Solche philosophischen Argumentationen waren sensationell, und sie gehörten zum Luxus. Das Christentum hat mit seiner Liste der sieben „Totsünden“ diese Tradition des Verzichts auf Leibesfreude fortgesetzt, aber nur soweit Erfolg gehabt, wie es zur Legitimierung von Armut benutzt wurde. Die Heuchelei scheint den großen Weltreligionen gemeinsam - die „wichtigste“ christliche Feier ist seit längerem das Weihnachtsfest. Die Tradition des jüdischen Osterfestes ist wie die des Ramadan bis zur Unkenntlichkeit überwuchert - von den Ritualen des Konsumismus.
Die Fahrt ins Paradies der Phantasie
Der Luxus der Reichen beflügelte im „christlichen“ Mittelalter die Phantasien der armen Bauern. Deren imaginiertes Schlaraffenland kannte vor allem Müßiggang, Völlerei und Trunksucht. „Gebratene Schweine wandern mit Messern im Rücken umher, um das Tranchieren zu erleichtern, gegrillte Gänse fliegen einem direkt in den Mund, gekochte Fische springen aus dem Wasser und landen zu den Füßen. Das Wetter ist immer mild, der Wein fließt in Strömen, Sex ist leicht zu haben, und alle Menschen genießen die ewige Jugend“, so fasst Herman Pleij die mittelalterlichen bäuerlichen „Träume vom Schlaraffenland“ zusammen. Vom Himmel regnet es Käse, auf Erden gibt es sexuelle Freiheiten und die Demütigung von Autoritätspersonen durch ihre Untergebenen – Karneval.
Eine frühe schriftlich überlieferte Version ist das satirische Gedicht „The Land of Cockaygne“. Solche Geschichten wurden im 14. Jahrhundert im ganzen mittelalterlichen Europa erzählt. Das Volksfest war die Gelegenheit, die Sorgen des Alltags zu vergessen und Sinnesfreuden zu erleben, die im Alltag unmöglich und verboten sind. Die Geschichte der Volksfeste ist die Geschichte des realen und virtuellen Vergnügens. Das ganze Dorf kam zusammen, um zu feiern, zu tanzen, zu essen – und vor allem zu trinken. Da gab es Zauberer und Wahrsager, Puppenspieler und Pantomimen, Bärenführer und Komödianten, Jongleure und Seiltänzer, Bänkelsänger und Moritatenmaler.
Der Weltreisende Peter Mundy zeichnete 1620 in seinen Tagebüchern ganz ähnlich einen Festplatz im Osmanischen Reich - mit Schaukeln, Karussellen und Riesenrädern. Volksfeste gab es auch am Rande von Viehmärkten. Für junge Menschen war das Volksfest eine Dating-Börse. Goethes Faust pries die Freiheit des Volksfestes mit dem sprichwörtlich gewordenen Satz: „Hier ist des Volkes wahrer Himmel, zufrieden jauchzet Groß und Klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“
Die Gebildeten der Zeit liebten die derben Träume des Volkes nicht. In seinem Buch „Utopia“ (1516) malte Sir Thomas More (1478-1535, lateinischer Name Thomas Morus, eine Welt der Vernunft. Im Mittelpunkt steht Nützlichkeit, nicht Verschwendung und Genusssucht. Ein Gewand, das vor allem gegen das Klima schützt, sollte reichen. Und in der Ausbildung des Geistes soll man das Glück des Lebens suchen.
Kathedralen der Transzendenz
An den mittelalterlichen Höfen trafen sich Adlige, Höflinge, Geistliche und schöne Frauen in prunkvollen Räumlichkeiten zu feierlichen Veranstaltungen und Prunk, etwa dem „goldenen Käfig“ von Ludwig XIV. in Versailles. Als Zentren des Konsums förderten die Höfe die Beschäftigung und die beteiligten Kurtisanen, Handwerker, Kunsthandwerker, Modeschöpfer, Köche, Architekten und Finanziers lieferten nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern beobachteten auch deren Nutzung durch Könige und Aristokraten.