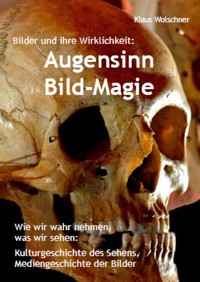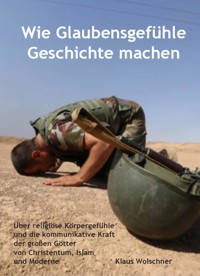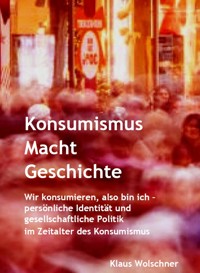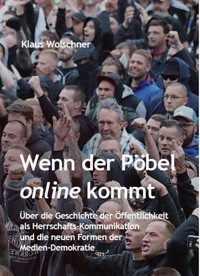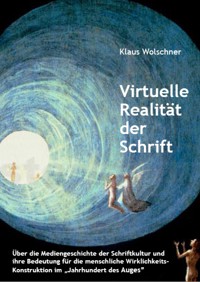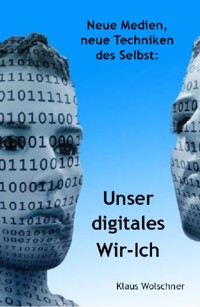
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was macht die neue digitale Medientechnik mit dem Menschen? Was machen sie mit dem uralten Sinn für Gemeinschaft, was mit der Arbeit, was mit dem Geld? Wie verändert sich Liebe unter dem Einsatz digitaler Kommunikation, wie das Gefühl für ein "Ich"? Diesen Fragen geht dieses Buch nach. War unser Ich nicht immer ein sozial geprägtes "Wir-Ich"? Das "Wir" dominiert in der Entwicklung der Kindheit und wie in den archaischen Kulturen der Menschheit. Das Selbstverständnis als Individuum ist kulturgeschichtlich jünger. Ist es mehr als eine "Ich-Illusion"? Klar ist: Die Balance des Wir-Ich ändert sich in der Geschichte und insbesondere durch die Medien der zwischenmenschlichen Kommunikation. Dieses "Wir" des Ich wird nun von digitalen Kommunikationsmedien neu geprägt. Was bedeutet das? Das Buch steht in der Reihe meiner medienwissenschaftlichen Texte. Erschienen sind: Virtuelle Realität der Schrift. Über die Mediengeschichte der Schriftkultur und ihre Bedeutung für die menschliche Wirklichkeits-Konstruktion im Jahrhundert des Auges (2016) Bilder und ihre Wirklichkeit: Augensinn, Bild-Magie. Wie wir wahrnehmen, was wir sehen. Kulturgeschichte des Sehens, Mediengeschichte der Bilder (2016) Wie Glaubensgefühle Geschichte machen. Über religiöse Körpergefühle und die kommunikative Kraft der großen Götter von Christentum, Islam und Moderne (2018) Wenn der Pöbel online kommt. Über die Geschichte der Öffentlichkeit als Herrschafts-Kommunikation und die neuen Formen der Medien-Demokratie (2020)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Wolschner
Neue Medien, neue Techniken des Selbst: Unser digitales Wir-Ich.
Wien/Bremen, im Mai 2022/2023
Inhalt:
VorbemerkungenUnser Wir-Ich - Kommunikation macht MenschenWas sein wird - Zukunftsängste, ZukunftshoffnungenDie Vorgeschichte der Mixed Reality
Vom Wir-Ich zur „ICH“-Illusion
Zur Vorgeschichte des IchDas Ich der Schrift-SpracheWelt der Zahlen - Die Mathematisierung des GeistesWie man den Mond wahrnehmen kannDas moderne kapitalistische Wir-Ich
Meine schöne neue digitale Welt
Die Zukunft des Körpers und des LeibesKonsum statt ArbeitDigitalisierung der Arbeit Digitalisierung der BilderDigitalisierung der SchönheitDigitalisierung des Glücks und der LiebeDigitalisierung des Todes
Unsere schöne neue digitale Welt
Digitalisierung der ZeitDigitalisierung des GeldesDigitalisierung der Demokratie
Digitalisierung des Wir-Ich
Literaturhinweise
Vorbemerkungen
War unser „Ich“ nicht immer ein sozial geprägtes „Wir-Ich“? Das „Wir“ dominiert in der Entwicklung der Kindheit und in den archaischen Kulturen der Menschheit. Das Selbstverständnis, der Mensch sei vor allem unteilbar, „Individuum“, ist kulturgeschichtlich jung. Ist es mehr als eine „Ich-Illusion“? Klar ist: Die Balance des Wir-Ich ändert sich in der Geschichte und insbesondere durch die Medien der zwischenmenschlichen Kommunikation, aber das „Wir“ bleibt grundlegend. Dieses „Wir“ des Ich wird nun zunehmend von digitalen Kommunikationsmedien neu geprägt. Was bedeutet das? Was macht die neue digitale Medientechnik mit dem Menschen?
Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“, Aldous Huxleys „Brave New World“ und George Orwells „1984“ waren die pessimistischen Utopien für das 20. Jahrhundert. Sie ahnten nichts von „Mixed Reality“, von den Möglichkeiten der elektronischen Digitalisierung der Kommunikation, von Nano-Technologie und Neuro-Enhancement. Aber ist Mark Zuckerbergs virtuelle „Metaverse“-Welt, in der die Menschen wie drei-dimensionale Avatare miteinander interagieren und sich unabhängig vom Ort der Körper einander nahe fühlen sollen, nicht nur ein aktualisierter „Neusprech“ von George Orwell?
Der Mensch macht sich zu einem „Prothesengott“, hat Sigmund Freud schon 1930 festgestellt. Er fühlt sich allmächtig und vollkommen - als Herr seiner Prothesen. Können wir uns Menschen, deren sinnliche Wahrnehmung durch elektronische Kommunikationsmedien zu einer gemischten Realität erweitert wird, als glückliche vorstellen?
Dieses Buch ist ein unmögliches Unterfangen. Nie haben die Menschen, wenige Jahrzehnte nachdem sie „neue Medien“ zu nutzen begannen, verstanden, was die mittel- und langfristige Bedeutung dieser neuen Kommunikations-medien für die menschliche Kultur und für das menschliche Selbst-Verständnis sein würde. Zeitgenossen taten sich immer schwer mit der Frage, was neue Medien für die Kulturgeschichte der Menschheit bedeuten könnten.
Aber ein Blick in die Geschichte kann einen Eindruck davon vermitteln, wie neue Medien den Menschen immer wieder verändern. Auch die Verallgemeinerung der Schriftkultur durch den Buchdruck hat über mehrere Jahrhunderte die menschliche Kultur neu geprägt und das Selbstverständnis der Menschen als Individuum vertieft und verallgemeinert. Und so neu ist nicht einmal „Mixed Reality“, wenn man darunter die Integration virtueller Welten in die Wahrnehmung der gegenständlichen Realität versteht. Am Beginn ihrer kulturellen Evolution haben die Menschen die Götter erfunden, die für die existentiellen Wahrheiten verantwortlich gemacht wurden und wichtige virtuelle Player waren in der Geschichte der Menschheit. Mit den Geschichten, die die Menschen von ihren Göttern fabulierten, haben sie Autoritäten erfunden, denen sie sich unterwarfen – eine Art „Mixed Reality“. Jedenfalls wenn Mixed Reality die Verschmelzung von realen und virtuellen Welten bedeutet, in denen physische und digitale Objekte koexistieren und in Echtzeit interagieren.
Menschen sind Objekte ihrer Mediengeschichte
Kommunikationsmedien (1) werden von Menschen genutzt, um sich selbst in ihrer ganzen Macht und Herrlichkeit darzustellen. Sie fühlen sich als Subjekt, sind aber im Grunde Objekt der Mediengeschichte („the medium ist the message“). Kein Affe wurde gefragt, was er davon hält, das gemeinsame Kraulen durch spezielle Sprachlaute zu erweitern und zu ersetzen. Durch die Sprache kam die neue Dimension geistiger – virtueller - Welt ins Leben der Menschen. Die Erfindung der Schrift hat diese geistige Welt noch einmal revolutioniert. Platon und seine Freunde waren bekanntlich höchst irritiert über die Verwendung von schriftlichen Zeichen zur Fixierung ihrer philosophischen Gedankengänge - nur tote Buchstaben seien das, fanden sie abfällig. Wenn Johannes Gutenberg geahnt hätte, dass seine geniale Erfindung zum Sturz der mächtigen Heiligen Kirche beitragen würde und zur Verbreitung der Idee, dass jedermann lesen lernen und alle Menschen gleich sein sollten, dann wäre er sicherlich entsetzt gewesen und hätte seine Hände in Unschuld gewaschen. Erst 400 Jahre später konnte Viktor Hugo den Gedanken denken, dass „die Erfindung der Buchdruckerkunst das größte Ereignis der Geschichte” sei: „C’est la révolution mère”, schrieb er 1831, sie ist die Mutter-Revolution, „sie gab der Menschheit ein neues Ausdrucksmittel für neue Gedanken.“
Noch Ende des 18. Jahrhundert diagnostizierte der Göttinger Frauenarzt Friedrich Benjamin Osiander bei seinen Patientinnen „Lesesucht“ – die Frauen sollten mental ihren Platz im Haushalt nicht verlassen. Im 19. Jahrhundert sorgten sich Mediziner angesichts der technischen Erfindungen, zu denen Fotografie, Fernsprech-Apparaturen und laufende Bilder (Film) gehörten, über die Überforderung des menschlichen Nervensystems - „Neurasthenie“ war der medizinische Fachbegriff für diese neue Zivilisationskrankheit. Das Radio sollte an seinem Anfang vom „Luftfahrt“-Ministerium kontrolliert werden und wurde als Tele-Zeitung gedacht. Deutsche Fernseh-„Intendanten“ - man staune über den dem Theater entlehnten Titel – wollten in den 1950er Jahren mit der neuen Technik den alten bildungsbürgerlichen Wissenskanon unter die unwissenden Schichten der Bevölkerung bringen. Als das Arpanet erfunden wurde, hätte man Visionen über ein zukünftiges „Smartphone“ für Spinnerei gehalten.
Marshall McLuhan hat 1964 den Begriff der Körperausweitung („Extension of Man“) geprägt, um die Bedeutung der Medien für den Menschen zu verstehen. Er ahnte nicht, dass 50 Jahre später das Smartphone erfunden würde, mit die Menschheit eine Körperausweitung in der Tasche mit sich herumträgt, die fast alle früheren Medien in sich vereinnahmt - Tonkommunikation, Schriftkommunikation, Bildkommunikation, Filmkommunikation. Nur riechen und fühlen kann das Smartphone noch nicht. Kaum mehr als zehn Jahren nach der Erfindung des Smartphones trägt über die Hälfte der Weltbevölkerung das Ding mit sich - in den alten europäischen Kulturnationen verbringen die Menschen rund vier Stunden pro Tag mit dem Wunderding, in den ehemaligen „Entwicklungsländern“ oft doppelt so viel Zeit. Sie lesen nicht mehr in der Bahn, sie chatten.
Steuert der Mensch seine eigene Evolution?
Die Bedeutung dieser neuen Medientechnologie für den Menschen beflügelt die Phantasien der Filmindustrie. Da lassen sich die Hoffnungen und Ängste ausleben, die bis zur Unterwerfung des Homo sapiens unter die Algorithmen der künstlichen Intelligenz gehen. Der Geist der Menschen, ihr Weltwissen und ihre Weltbilder sind durch digitale Technologien (2) geprägt. Digitalisierte Medizintechnik beherrscht ihre körperliche Natur und entscheidet letztlich darüber, wann Kranke sterben dürfen. Die Computerisierung verändert unser Denken, indem sie uns totale Berechenbarkeit vorgaukelt, sagen Kritiker. Menschen würden den Anweisungen, die von einem Computersystem stammen, oft mehr vertrauen als ihrer eigenen Erfahrung. Aber für die Computer ist nur das wirklich, was mathematisierbar ist und damit einer berechenbaren Logik unterworfen werden kann. Mit seinen intelligenten Apparaten scheint der Mensch seine eigene Evolution in die Hand zu nehmen und doch sind es die intelligenten Apparate, deren Potential die Zukunft des Menschen prägen.
Sicher ist nur: Die Potentiale der neuen Technik überfordern die rationale Technikfolgen-Abschätzung. Alle Appelle, die Menschen sollten die Entwicklung der digitalen Hilfsmittel kontrollieren und steuern, sind gut gemeint, sie werden die in Gang befindliche Medienrevolution nicht aufhalten.
Wie immer bei Medienrevolutionen. Der Begriff der „Medienrevolution“ ist dabei ein pädagogischer – mit ihm lassen sich Momente der Mediengeschichte markieren, an denen manchmal eine unscheinbar erscheinende Neuerung die Tür zu neuer Dynamik oder zu großen Veränderungen öffnet. In der über Jahrhunderte sich hinziehenden „Evolution“ der Aneignung von Medientechniken hat es immer wieder Kipp-Punkte gegeben, an denen etwas ganz Neues in der Mediengeschichte aufgetaucht ist, das langsam aber unaufhaltsam seine Potentiale entfaltet. Vier Jahrhunderte nach Gutenbergs Drucktechnik hatte die Masse der Menschen lesen gelernt, es gab gedruckte Massenmedien und den Ruf nach Demokratie für das lesend gebildete Publikum. Die Erfindung der Sprache, die Erfindung der Schrift, die Erfindung des Buchdrucks und die Erfindung elektronischer Telekommunikationstechniken sind solche medialen Innovationen, markante Wendepunkte der Mediengeschichte und epochale Einschnitte der Menschheitsgeschichte.
Der Mensch braucht Geschichten vom Bösen und vom Guten
Nichts spricht dafür, dass Menschen schon während der Geburtswehen der neuen digitalen Kommunikationstechnik eine klare Idee davon gewinnen könnten, wie die Menschheit sie sich später einmal „aneignen“ (könnte) und wie die digitalen Techniken die Menschen verändern werden.
So stehen den Techno-Utopien die alten bukolischen Idyllen gegenüber, Träume eines von menschlicher Technik unberührten „natürlichen“ Lebens. Der „Natur“ nahe sein und mit seinem eigenen - in der „Natur“ verwurzelten - Verhalten einen Beitrag zur Weltharmonie leisten, das ist die Sehnsucht vieler. Dieses Bild von „Natur“ ist das Sinnbild des Guten, frei von allen Grausamkeiten, ein mentales Konstrukt, das auf die Sehnsüchte des Menschen verweist. Da frisst niemand niemanden, der gute Mensch isst vegan und ist keines anderen Wolf. Zu dieser „Natur“ gehören keine Natur-Katastrophen, das Böse gehört nur in die Sphäre dessen, was der Mensch dieser allseits guten „Natur“ antut.
Der Mensch braucht aber auch die Geschichten vom Bösen. Erzählungen, die von einer großen Bedrohung des Planeten ausgehen und gleichzeitig einen Weg der Rettung vorschlagen, sind offenbar sehr attraktiv für die menschliche Orientierung in der Welt. Die erfolgreichen Religionen sind Beispiele dafür.
Können Menschen sich wohlfühlen in der schönen neuen Welt?
Das Smartphone symbolisiert die neue digitale Welt, kaum ein Lebensbereich wird von den Veränderungen ausgelassen werden. Die Vorstellungen von der Liebe werden genauso von den Möglichkeiten der neuen Techniken geprägt wie die Formen demokratischer Herrschaft. Wie die Dampfmaschine strukturiert die neue Technik die Produktion materieller Güter um. Bei der Orientierung in der Welt übertrifft das kleine Gerät in der Hosentasche alle unsere Vorstellungsmöglichkraft und macht sich die Phantasie der Menschen untertan. Wenn eine intelligente Brille für Autisten entwickelt wird, die ihnen helfen soll, die Gefühle ihrer Kommunikationspartner besser zu verstehen, dann stellt sich die Frage: Sind wir nicht alle ein wenig Autisten, denen die künstliche Intelligenz der Apparate zu einem menschlicheren Leben verhelfen können?
Können Maschinen dem Menschen das „Du“ ersetzen? Der 1878 in Wien geborene Religionsphilosoph Martin Buber hat in seinen Meditationen über „Du und Ich“ (1923) den wunderbaren Satz formuliert: „Der Mensch wird am Du zum Ich“. Viele „Du‘s“ tragen dazu bei, dass der Mensch zum „Ich“ wird. Den „Resonanzraum“, den die „Du’s“ um das Ich bilden, können Maschinen nicht ersetzen, hat der Psychologe Joachim Bauer im Jahre 2006 behauptet: „Warum ich fühle, was du fühlst“ geht nur mit fühlenden Menschen.
Die Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens vollendet die Auflösung von sozialen Zusammenhängen, das digitale Netz ermöglicht eine perfekte und vollendete Flexibilität der Subjekte - frei schwebend, ortlos, flexibel sogar in ihrer Identität. Die Menschen haben gleichzeitig noch nie so viel mit fremden und entfernten anderen Menschen kommuniziert wie im Zeitalter der Smartphones. Nie waren die Menschen so vielen informativen kommunikativen Eindrücken ausgesetzt wie im Zeitalter der Smartphones. Es scheint, als würde das Individuum eingesponnen in ein ungeheuer vielfältiges Netz von sozialen Kontakten und Informationen, die den Einzelnen prägen und zu einem sozialen Ich machen. Nie war die leibliche Basis ihrer sinnlichen Erfahrung so schmal.
Potenzieren sich Freiheit und Vielfalt der sozialen Kontakte und Kommunikationsmöglichkeiten auf Kosten der Intensität?
Ist ein gesteigerter Narzissmus feststellbar und erklärt der sich mit der geringen emotionalen leiblichen Verankerung der virtuellen sozialen Kontakte?
Wie schafft die moderne Mediengesellschaft für das narzisstische „Ich“ ein verlässliches „Wir“? Was wird aus dem uralten Sinn für Gemeinschaft?
Was wird aus der Arbeit? Kann der Konsum das ersetzen, was die Arbeit einmal Sinn stiftend für das menschliche Selbstbewusstsein bedeutete?
Wie wird die Neurochemie die Maßstäbe für das verändern, was wir unter Glück verstehen? Wird das digital dating die Liebe verändern?
Werden die Menschen sich an diese schöne neue Welt gewöhnen und sich darin irgendwann wohlfühlen?
Fragen über Fragen, die in diesem Buch eingekreist werden sollen.
Wien/Bremen, im Mai 2022
Anmerkungen:
(1) Als Kommunikations-Medien wollen wir all jene Techniken und Praktiken verstehen, mit denen sich Wörter, Zahlen, Klänge oder Bilder verbreiten und manipulieren lassen – und neuerdings als digitale Daten elektronisch gespeichert und ausgetauscht werden können. Die digitalen Kommunikationstechniken erlauben es, dass auch physische Objekte untereinander Daten austauschen und in diesem Sinne „kommunizieren“, gesteuert über virtuelle „Objekte“. Man nennt das das „Internet der Dinge“. Ein handelsübliches digitales Blutzucker-Messgerät ermittelt die aktuellen Glukosewerte und rechnet die richtige Insulinmenge aus, dokumentiert beides in einem elektronischen Tagebuch und steuert, wenn es sich um ein in den Körper eingebautes Gerät handelt, die Insulin-Abgabe. Die Maschine kommuniziert also aktiv mit der Biochemie des Körpers – ein Beispiel für „Mixed Reality“ und ihre selbstverständliche Nutzung durch Patienten.
(2) Mit dem Begriff der „Digitalisierung“ wird gewöhnlich ein umfassender kultureller Wandel bezeichnet, der bewirkt wird durch den Einsatz moderner elektronischer Technik im 21. Jahrhundert. Dieser Wandel betrifft nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche. Im engeren Sinne bezeichnet (elektronische) Digitalisierung die Darstellung analoger akustischer, visueller oder mechanischer Prozesse mit Hilfe digitaler Daten, die digitalen Repräsentationen sind der „Rohstoff“ der elektronischen Datenverarbeitung.
Schon die „analoge“ Elektronik hat es möglich gemacht, Stimmen zu speichern oder per „Fernübertragung“ an Orten hörbar zu machen, an denen die Sprecher nicht waren. Die Erfindung der Schrift und der Druckerei-Kunst hatten es ermöglicht, Worte zu visualisieren und damit zu konservieren. Die Elektrochemie hat seit dem 19. Jahrhundert reproduzierbare Bilder von „Augenblicken“ ermöglicht. Das Morsealphabet hat einzelne Buchstaben „digitalisierbar“ gemacht. Es gab vor der elektronischen Digitalisierung das Wählscheiben-Telefon, das Analog-Modem und den Röhrenmonitor. Wenn also gesagt wird, „Digitalisierung“ bedeute die „Dematerialisierung der gesamten physischen Welt“, so ist das unzulässig verkürzt. Mit der geistigen Welt gab es immer schon eine zweite dematerialisierte Welt neben der rein physischen Welt. Mit der Elektrizität entstand eine Tele-Kommunikationswelt. „Digitalisierung“ meint speziell die elektronische Digitalisierung.
Bei der Digitalisierung werden komplexe und oft unüberschaubare vielfältige analoge Informationen reduziert und damit für Maschinen lesbar gemacht. Diese reduzierten und eindeutigen Informationen lassen sich verlustfrei speichern und reproduzieren.
Die digitalisierten elektronischen Datensätze von physischen Interaktionen, Dingen oder Menschen können mit Hilfe von Algorithmen vernetzt werden, automatisierte Datenverarbeitungsprozesse können wiederum umgewandelt werden in analoge physische, akustische oder visuelle Impulse für Maschinen. Ein Lautsprecher ist in diesem Sinne eine Maschine, die digitale Daten in Luft-Schwingungen umwandelt – in für den Menschen hörbaren Frequenzen. Auf einem Bildschirm können digitale Daten in grafische Zeichen umgewandelt werden - die lesekundige Menschen als Schriftzeichen begreifen können.
Für den Menschen sichtbar und fühlbar wird nur das von der digitalisierten Welt, was in die analoge Impulse zurückverwandelt worden ist und für die körperlichen Sinne wahrnehmbar wird.
Unser Wir-Ich – Kommunikation macht Menschen
Was wird aus dem Individuum in der modernen Großstadt-Gesellschaft? Wie wird die virtuelle Kultur der digitalen Kommunikationstechniken dieses Individuum neu formen? Wer solche Fragen aufwirft, muss dem Phänomen „Individuum“ auf den biologischen und kulturellen Grund gehen.
Das „Ich“ ist ein trügerisches Konstrukt des sprachlich geformten Bewusstseins. Es gibt kein Ich ohne Wir. Am Anfang war die symbiotische Einheit von Neugeborenem und Mutter, daran erinnert den erwachsenen Menschen vor allem die gemeinsame Einverleibung von Nahrung und die leibliche Verschmelzung in der Liebe. Diese unbewusste leibliche Erinnerung erklärt die emotionale Bedeutung des Gemeinschafts-Mahles und der Institution, die leibliche Verschmelzung zu garantieren verspricht - der Ehe.
Die Illusion, dass das Wir-Ich ein autonomes Ich sei, kann erst in der sprachlichen Kommunikation entstehen, mit der Menschen sich auf Distanz verbinden. Um diese illusorische Selbst-Gewissheit zu irritieren und die Bedeutung des „Wir“ im „Ich“ zu betonen, benutzte ich die Sprach-Konstruktion vom „Wir-Ich“.
Was ist der Mensch? Einerseits „Wille“ des Leibes, also Biologie, und andererseits Vorstellung, also Kreation des Geistes, hat Arthur Schopenhauer formuliert. Mein Leib existiert in einer Umwelt, durch meinen Leib habe ich Umwelt. Betrachtet man die unmittelbaren leiblichen Sinne, allen voran das Tasten und die oralen Sinne des Schmeckens und Riechens, dann wird aus der abstrakten Welt die konkrete Umwelt, an der ich mich stoßen und verbrennen kann, aus der ich mir Nahrung einverleibe und in der ich auf nahe Mitmenschen stoße, denen ich im leiblichen Füreinander-Dasein verbunden bin. Der Mensch ist „Holobiont“ nicht nur im Hinblick auf die Natur-Umwelt der Bakterien und Mikroben, sondern auch im Hinblick auf die Mitmenschen. Am intensivsten wird dieses Füreinander-Dasein in der symbiotischen kindlichen Beziehung mit der Mutter erlebt, die sich in dem Verschmelzungswunsch zweier Liebender wiederholt. Mit seiner provokanten Formulierung, es gebe das Baby gar nicht, sondern nur das Baby in der Einheit mit der Mutter, hat der Psychoanalytiker und Kinderarzt Donald Winnicott auf die eminent soziale Verfasstheit des Menschen hingewiesen.
In der emotionalen Beziehung zur Mutter dreht sich bei dieser symbiotischen Beziehung alles um die Nahrung, die der Säugling sich einverleibt – und die Sicherheit, dass es Nahrung gibt. Mit der zunehmenden Distanz zur Mutter muss der kindliche Leib lernen, die Nahrung, die er sich einverleiben will, anderswo zu suchen – die Umwelt des Leibes weitet sich aus, wird zur unsicheren „Welt“. Während Säuglinge in der Umwelt der Mutter ihr selbstsüchtiges Selbst ausleben konnten, müssen sie in eine Welt hineinwachsen, in denen es auch andre Selbste gibt, die ihnen Grenzen setzen. Sich mit anderen in der Kommunikation, im gemeinsamen Gesang oder im Gastmahl zu verbinden und die Nahrung in einer Gemeinschaft aufzunehmen, ist daher ein höchst feierlicher Akt des leiblichen Menschen.
Gefühle gehören dem Zwischen von Ich und Wir
In der japanischen Kommunikations-Kultur ist – deutlich anders in der „westlichen“ – das Bedürfnis nachGeborgenheit in Abhängigkeit legitim, man darf es zeigen. Im Japanischen gibt es dafür den Begriff Amae („Anlehnung“). In der japanische Alltagskultur hat das Bedürfnis nach persönlicher Unabhängigkeit und Freiheit einen geringeren Stellenwert hat als in westlichen Kulturen. Zentral in der japanischen Philosophie ist heute noch der Begriff des „Zwischenseins“ als Fundament der Beziehung von Ich, Du und Er. „Was nicht im Zwischensein ist, kann weder Ich noch Du werden. ... Der Mensch wird im Zwischensein ‚Ich‘.“ (Watsuji Tetsurö)
Aus europäischer Sicht verwundert gleichzeitig die sehr viel weitergehende Nutzung digitaler Distanz-Kommunikation und die Einsamkeit unter den „digital natives“ – als wäre die japanische Tradition des „Zwischenseins“ unrettbar verloren.
Unser Sinnenleben ist voller Phänomene, die „erfühlt“ werden und sich einer einfachen und rationalen sprachlichen Beschreibung entziehen. Der Begriff „Gefühl“ hat etwas Unbestimmtes, es ist ein typischer „semantischer Brückenkopf in das reflexiv Unerfassbare hinein“ (Albrecht Koschorke). Jeder kennt Situationen, in denen er sich über seine eigenen Gefühle nicht ganz klar ist. Gefühle können außer Kontrolle des Verstandes geraten, ihnen liegen Erregungen des Leibes zugrunde. Wenn sich Gefühle einem Anderen mitteilen, erfüllen sie den Zwischenraum zwischen den zwei Personen. Gefühle sind etwas Zwischenmenschliches, sie gehören dem Ich und dem Wir. Intensive Resonanzerfahrungen werden dabei als Momente des Überwältigtwerdens empfunden – als Erlebnisse einer Regression in unmittelbare Wir-Ich-Erfahrungen.In den Schrift-Sprachen gibt es für das „Zwischen“ meist keine Worte.
Das Wort „Gefühl“ ist eine Konstruktion der Neuzeit. „Fühlen“ bezog sich eigentlich auf das körperliche Tasten. Seit dem 17. Jahrhundert wurde es zunehmend auf seelische Empfindungen übertragen, die körperlich spürbar sind. Gefühle verbinden auf komplexe Weise die körperlichen Reaktionen mit mentalen Mustern des Selbst-Bewusstseins.
Der Mensch ist Sinnenwesen
Auch für erwachsen werdende Menschen bleibt der Tast-Sinn der wichtigste Körpersinn. Dank des Tast-Sinnes sind wir uns unserer leiblichen Existenz bewusst: „Wir denken uns nicht selbst, sondern wir fühlen uns“, formuliert der Psychologe Martin Grunwald. Menschen können blind oder taub geboren werden und aufwachsen, überlebenswichtig für die embryonale und frühkindliche Entwicklung ist der Tastsinn. Er bildet das biologisch größte und einflussreichste Sinnessystem auch beim Menschen. Der Tastsinn verbindet den Menschen elementar-körperlich mit den Mitmenschen.
„Wir halten uns für rationale Wesen, die denken und sprechen“, sagt der Philosoph Emanuele Coccia, das habe Rene Descartes uns eingeredet. Aber: „Wir können nur durch das Sinnliche leben.“ Denn „wir sind, für uns selbst wie für die anderen, nicht mehr als eine sinnliche Erscheinung: Unsere Haut und unsere Augen haben eine Farbe, unser Körper hat eine Ausstrahlung und gibt fortwährend Gerüche und Geräusche von sich, wenn wir uns bewegen, sprechen, essen oder schlafen.“ Das Sinnenleben ist „die Art und Weise, in der wir uns der Welt hergeben, die Form, in der wir in der Welt sind (für uns und für die anderen), und das Medium, in dem die Welt für uns erkennbar, bewohnbar, lebbar wird. Nur im Sinnenleben bietet sich die Welt dar, und nur als Sinnenleben sind wir auf der Welt.“
Seit Aristoteles ist in der klassischen Philosophie das Tasten nur der fünfte Sinn. Falsch, sagen uns die modernen Biologen - das Tasten und Ertasten ist der wichtigste Sinn, auch wenn das oft nicht bewusst wird - der Mensch ist ein „Homo hapticus“ (Grunwald). Ein blinder Mensch hat Probleme, ein sprachloser Mensch ist taub, aber neu geborene Menschen, deren Tastsinn nicht „funktioniert“, sind nicht lebensfähig. Das deutsche Wort „fühlen“ umgreift das gespürte passiv-taktile wie das bewusste aktiv-haptische Tasten.
Gefühle steuern soziale Verhaltensmuster
Gefühlsäußerungen können ansteckend sein wie das Weinen und sie scheinen ganz intime Phänomene zu sein, dennoch können wir sie Anderen gegenüber schwer verbergen. Wie ein Hilfe-Schrei können die spontanen leiblichen Regungen des Gefühls – zum Beispiel der Angst - gleichzeitig kommunikative Handlungen darstellen. Auch Trauer-Reaktionen sind in erster Linie subjektive, leibliche-psychische Empfindungen, Bewältigungsstrategien von Situationen, in denen es keine Handlungsoption gibt. Verzweiflung kann aufgrund seiner leiblichen Ausdrucksformen wie ein kommunikativer Akt wirken, wie eine unausgesprochene Bitte um Zuwendung. Gefühlsäußerungen sind Instrumente der Kommunikation. Gefühle (nicht nur akute Flugangst) sind komplexe Selbst-Wahrnehmungen und können gleichwohl auch „anstecken“. Gefühlsäußerungen haben einen wichtigen Anteil an der Körpersprache. Gefühlsäußerungen folgen sozialen Konventionen – oder sprengen sie.
Das, was wir als Gefühl empfinden, hat einen evolutionsgeschichtlichen, leiblichen Kern - und eine kulturelle Gestalt, in der es erscheint. Zum Beispiel die Liebe. Sie erscheint uns als das intimste der Gefühle, und doch lieben alle ähnlich und lieben in der Regel nur den, der die Liebe erwidert. Verschmähte Liebe kann schnell in Hass und Verachtung umschlagen. Die „Kunst der Liebe“ gilt als Handwerk, man kann dazu Tipps geben. Die Liebe ist ein Naturereignis, es erwischt einen, man „fällt“ in Liebe - und doch, so konstatieren die Ratgeber, ist sie kein einmal durchgesetzter Zustand, sondern muss täglich aufs Neue gestaltet werden. „Ich verliebe mich nicht, wenn es mich nicht vorher danach verlangt hätte; die Leere, die ich in mir ausfülle ... ist nichts anderes als die Zeitspanne, in der ich meine Umgebung … nach jemandem absuche, den ich lieben kann“, formuliert Roland Barthes in seinen Fragmenten einer Sprache der Liebe (1984).
Emotionen und Gefühle - zwischen Körper und Geist
Der Neurobiologe Mario Damasio unterscheidet sprachlich zwischen den Emotionen (engl. emotions), womit er Körperzustände bezeichnet, und Gefühlen als bewusst wahrgenommenen Emotionen, interpretierten Empfindungen (engl. feelings). Zum Beispiel kann es körperliche emotionale Reaktionen geben ohne kognitive Anteilnahme, also ohne bewusste Selbstwahrnehmung. Emotionen „entstehen“ oft schneller als der Verstand sie verarbeiten und zu Bewusstsein bringen kann. Verletzungen der jeweiligen Gehirnbereiche haben spezifische Auswirkungen auf die empfundenen Gefühle.
Den sichtbaren Gefühlsäußerungen können unterschiedliche emotionale Erregungen zugrunde liegen – Lachen kann ausgelöst sein durch Freude, durch Kitzel, durch Witz oder auch durch Verlegenheit. Es gibt sogar Lachen aus Verzweiflung. Genauso kann man Weinen vor Freude, nicht nur aufgrund von Leid. Ich weine, das ist ein spontaner Gefühlsausdruck. Wenn ich damit nicht eine kommunikative Botschaft verbinden möchte, muss ich mich abdrehen und eine einsame Ecke aufsuchen.
Dargestellte Gefühle müssen gleichzeitig die Erwartungen der anderen berücksichtigen - wenn ich guter Laune bin, warum auch immer, und begebe mich in eine Trauergesellschaft, dann versuche ich zunächst, mich zu kontrollieren in meinem Gefühlsausdruck – und schließlich lasse ich mich anstecken von der Trauer. Nicht nur Lachen, auch Trauer steckt an.
Emotionen, sagt Antonio Damasio, sind mentale Programme zur Lösung von zwischenmenschlichen Orientierungsproblemen. Angst erhöht nicht nur die Empfindlichkeit des Gehörs, sie aktiviert die Aufmerksamkeit für alles, was mit Bedrohung und Sicherheit zusammenhängt. Angst schärft die visuelle Wahrnehmung undeutlicher Reize. „Besäßen wir nicht die Fähigkeit, aus der Beobachtung von Menschen ohne jegliches Nachdenken intuitive Gewissheiten über ihre Absichten und den weiteren Ablauf des Geschehens zu gewinnen, dann müssten wir uns in zwischenmenschlichen Belangen mit der Sehkraft eines Maulwurfs begnügen“, stellt Joachim Bauer fest. Emotionen aktivieren, deaktivieren und justieren kognitiver Systeme, mit denen das Individuum eine bestimmte Situation bewältigen kann. Emotionen sind nicht nur mentale Programme zur Koordination von Handlungen, sondern auch Grundlage des gemeinsamen Antriebsmanagements sozialer Gruppen. Emotionen schweißen Familien zusammen – Gemeinschaften, die durch gegenseitige Hilfe, Partnerschaft, Respekt, Aufmerksamkeit zusammengehalten werden und in denen Eltern ganz uneigennützig „alles“ für ihre Kinder tun – bis hin zu bedingungsloser Liebe. Emotionalisierte Gruppen sind gleichzeitig zu aggressiven Handlungen fähig, bei denen jeder Einzelne für sich Hemmungen hätte. Kollektives Gelächter verbindet und auch das Hänseln eines Dritten fördert den Gruppenzusammenhalt. Die Äußerung von Emotionen stärkt gewöhnlich das Empfinden der Emotionen.
Emotionen „aus zweiter Hand“ - mediales Probehandeln
In der Sphäre der kulturellen Praxis erlernt, bestätigt oder korrigiert der Mensch eine große Vielfalt von emotionalen Handlungsmustern im Sinne von „Probehandeln“, spielerisch, unverbindlich und ungefährdet. Wie alte mythologische Erzählungen führen moderne filmische Erzählungen oft eine desorientierte Lebensumwelt vor, aus der heraus der Held der Geschichte in eine Ordnungsform zurückfindet, so dass die Zuschauer sich emotional wieder heimisch fühlen können.
Die mündliche Erzählung und mehr noch das Lesen, also das Medium Schrift, verlangt von den Lesenden (oder Zuhörenden) die Ausformung der Bilder und Gefühle durch eigene Erinnerungen, durch die Sedimente des eigenen Realitätsbezugs. Diese Verarbeitung erleichterte schon das klassische Theater, die modernen audiovisuellen Medien liefern die Gefühls-Kultur frei Haus. Daher bevorzugen die Menschen letztere. Auch im Kino stimulieren laute Geräusche die emotionalen Reflexe von Flucht und/oder Kampf – jedenfalls für einen kurzen Moment. Medial vorgeführte Ereignisse mit vorsätzlicher Gewalt wirken dabei intensiver, alarmierender und unangenehmer als vorgeführte Ereignisse mit Maschinen- oder „Roboter“-Gewalt – es gibt einen „Reality-Kick“. Die mit wirklichem Erleben verknüpfbaren Emotionen haben eine deutlich intensivere Qualität als die Reaktion auf willkürlich („unrealistisch“) konstruierte mediale Vorführungen.
Emotionale Programme integrieren eine Vielfalt von Lebenserfahrungen. Viele dieser „Erfahrungen“ machen Menschen in spielerischen Situationen, nicht nur Kinder. Der Reiz des Theaters oder des Kinofilms liegt oftmals in der spielerischen Auseinandersetzung mit Emotionen oder emotional stark besetzten Handlungen. Auch die Vorliebe zur Oper hat darin ihren Grund: Opern sprechen mit „leichter Kost“ die zentralen Themen der Gefühls-Atmosphären an. Menschen suchen mediale Vorführungen mit emotionalem Inhalt, mit Vorliebe werden Geschichten mit Liebe und Mord ausgewählt. Das Erleben von „Probehandeln“ kann eine Gefühlslage verändern und wird vor allem gesucht, um schlechte Laune zu vertreiben. Das erklärt auch die besondere Faszination, die Action-Filme haben oder Liebesfilme, es erklärt den Reiz etlicher Computerspiele.
Medien sind attraktiv, weil sie Gefühle transportieren. Schock, Ekel, Angst oder auch Schadenfreude in medialen Darstellungen sind gewollt. Wer einen Film nach einigen Jahren zum zweiten Mal sieht, erinnert sich besonders an Emotionen wie das flaue Gefühl im Bauch, die der Film für ihn transportiert hat. Diese Gefühle hängen weniger von dem ab, was der Film für alle sichtbar zeigt, als von dem emotionalen Lebenskontext derer, die den Film sehen und verarbeiten. Jedes Individuum hat ein spezifisches emotionales Gedächtnis, das zum großen Teil unbewusst ist.
Das kulturell geformte Selbst
Aberder Mensch ist kein einsamer Wolf, sondern ein Gemeinschaftswesen. Vom Bauch her fühlt er sich wohl in der kleinen Gemeinschaft, der Familie, dem Familienersatz. Das ist die Grunderfahrung des Säuglings, die die Psyche des erwachsenen Menschen prägt. In Japan gibt es dafür das Wort „Amae”, was mit „Wunsch nach Anlehnung” und „Freiheit in Geborgenheit” übersetzt wird. Diese Sehnsucht nach einer Welt, in der es keine Bösartigkeiten gibt, hat die Phantasien vom Paradies geprägt und vom ewigen Leben. Jean-Jacques Rousseau hat diese Sehnsucht als den Wunsch „Zurück zur Natur“ formuliert.
Je mehr die kleine Gemeinschaft zur großen Gesellschaft wird, desto geringer wird die gefühlsmäßige Bindung. In der Stadt müssen die Menschen als Vereinzelte mit vielen Fremden halbwegs friedlich auskommen. Die gemeinschaftlichen Bindungen werden schwächer und setzen Individuen frei. Den Verlust des traditionellen Gemeinschaftssinns erlebt der aufgeklärte Mensch als Gewinn von Freiheit, er philosophiert vom „freischwebendes Subjekt“, vom „Ich“ ohne Wir. Dieses Subjekt hat sich aus seinen symbiotischen Bindungen befreit, es hat die Freiheit gewonnen, sich in symbolischen und kulturellen Bedeutungszusammenhängen neu zu binden.
Der neue soziale Raum des „freischwebenden“ Subjektes ist die Stadt, in der das Individuum mit „Fremden“ neue kommunikative Arbeits- und Freizeit-Gemeinschaften bilden kann. Der Stadtmensch tauscht sich mit beliebigen Fremden aus, tritt ihnen aber nicht zu nahe. Im Unterschied zum Dorf, wo es kaum eine „Intimität“ gibt, weil alle alles über alle wissen, entsteht in Abgrenzung zu der städtischen Öffentlichkeit ein Bereich der Intimität, der als „privat“ aus der öffentlichen Kommunikation ausgeschlossen werden soll.
Über dem leiblich gespürten Kern-selbst erhebt sich dort das große kulturelle Gebäude der Gedankenformationen und der Ich-Illusion. Identität ist nichts, was man hat, sondern ein ständiger Prozess, der gemeinsame Realitätserfahrungen in unterschiedlichen Gemeinschaften bündelt - zu einem mehr oder weniger kohärenten Selbst-Bewusstsein einer Person. Aber auch wenn das Ergebnis sich als „autonomes“ Individuum begreift – die Subjekte sind sozial und kulturell geformt. Kern des sozialen Selbst bleibt ein Verbundenheitsgefühl. Das Individuum sucht Geborgenheit und kollektive Identität.
Der moderne Mensch lebt in der Großstadt als anonyme Masse, er schaut gern weg und will mit den Nachbarn nichts haben, sucht aber gleichzeitig eine abstrakte Gemeinschafts-Identität – als Nation. Diese virtuelle Gemeinschaft wurde im 19. Jahrhundert mit den Zeitungen zu einer Nachrichten-Gemeinschaft, die Zeitungen schufen einen gemeinsamen Wissenskodex über die Gesellschaft, Zeitungen sind Medien der Synchronisation und ermöglichen die „Gesamtinklusion von Bevölkerungen“ zu einem gedachten einheitlichen Kollektiv. Armin Nassehi: „Politisch, ästhetisch und kulturell ansprechbare Kollektive wären ohne die Zeitung nicht möglich gewesen.“
Das individualisierte „Ich“ bleibt ein soziales Wir-Ich, mit alten unbewussten und den neuen bewussten Komponenten. Die Kultur stellt eine „Ordnung des Wissens“ bereit, die kommunikative Gemeinschaften begründet. Die geteilten rein geistigen Überzeugungen der neuen Ordnungen des Wissens erklären nicht die emotionale Kraft der Verbundenheit, für die der Einzelne im Zweifelsfall sein Leben riskiert, sei es für den Glauben, die Freiheit oder die Nation. Das in leiblichen Bedürfnissen verankerte Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit in einer Gemeinschaft ist offenkundig die Basis und Bedingung für ein stabiles, mit sich zufriedenes Selbst. Keine Aufklärung über den imaginären Charakter von kollektiver Identität kann das unstillbare Begehren danach auslöschen.
Kommunikation schafft „communio“
Das Wort „kommunizieren“ stammt von Lateinischen „communicare", wörtlich übersetzt bedeutet das gemeinsam machen, vereinigen, zusammenlegen, mitteilen, besprechen. „Communio“ ist die Gemeinschaft. Da geht es zuerst darum, die grundlegende Frage zu klären: Feind oder Freund. „Guten Tag, wie geht’s?“ „Danke, und selber?” Solche scheinbar inhaltsleeren Kommunikations-Floskeln sind Signale der emotionalen Freundschaft und Gemeinschaft - wie eine symbolische, flüchtige Umarmung oder das Händeschütteln. Solche körperlichen oder sprachlichen Botschaften schaffen zwischenmenschliche „communio“, sie wirken im Bauch. Das alltägliche zwischenmenschliche Verstehen gründet auf einen „ahnenden Anteil" (Wolfram Hogrebe), wir sehen in das Gesicht eines anderen Menschen und spüren oft unabhängig von dem, was er sagt, wie er uns gegenüber gestimmt ist.
Es gibt Befindlichkeiten, die Bedeutung haben, sich aber nur schwer versprachlichen lassen und die bei unserer aufgeklärten und sprachfixierten Reduktion von Wirklichkeit oft als irrational abgewertet werden. Kommunikation hat immer solche Untertöne für das Bauchgefühl - auch wo es vordergründig um sachliche Debatten zu gehen scheint. Sie ist eine vertrauensbildende Maßnahme – Sprache ist „kommunikatives Kraulen”, sagte der britische Psychologe Robin Dunbar dazu. „Phatische Kommunikation“ hat das der polnische Sozialanthropologe Bronislaw Malinowski 1923 bei seinen Beobachtungen auf den Trobriand-Inseln genannt, eine „Art der Rede, bei der durch den bloßen Austausch von Wörtern Bande der Gemeinsamkeit geschaffen werden“. Nicht nur der Tausch von Gaben ist vor allem ein symbolischer Austausch, sondern auch der Austausch von Lauten - unabhängig vom Inhalt, besonders also von scheinbar nutzlosen, redundanten und überflüssigen Sprech-Äußerungen.
Tiere kommunizieren direkt körperlich, sie machen sich durch Laute, Schreie und Gesang bemerkbar und beobachten die Körpersprache ihres Gegenübers. Der Homo sapiens hat auf diese „natürlichen“ Kommunikationstechniken aufbauend die Sprache entwickelt. Aber in Face-to-Face-Situationen können Menschen gar nicht anders als auch die Körpersprache ihres Gegenübers wahrzunehmen, also direkt körperlich zu kommunizieren. Nonverbale Kommunikation umfasst Gesten, Mimik, Gerüche, Tastempfindungen, Berührungsverhalten, Körperhaltung, Geruch, Körpertemperatur, Augenkontakt, Lautstärke und Melodie der Stimme. Mit Körperbewegungen, die Distanz oder Nähe signalisieren, übermitteln wir ständig Botschaften, ob wir wollen oder nicht.
Wir kommunizieren unbewusst mit „präsentativen“ Symbolen.Wenn Menschen Wut, Schmerz oder Freude, Trauer, Scham oder Zorn empfinden, also körpergebundene Emotionen, dann gibt es dafür mimisch-gestische Ausdrucksweisen, die „verständlich“ sind, auch wenn die Betroffenen ihre Gefühle nicht bewusst zeigen wollen. Es gibt das Lächeln als unwillkürlichen Ausdruck und als absichtliche, konventionelle Geste (als „performatives Symbol“, wie Susanne Langer in ihrer „Philosophie auf neuem Wege“ sagt). Lebewesen nehmen ihre Umwelt sinnlich wahr und zu der Umwelt gehören auch die anderen Lebewesen, deren unwillkürliche Ausdrucksweisen als (präsentative) Symbole gelesen werden. Vorsprachlich empfundene Emotionen können natürlich auch bewusst in ihren Ausdruckssymbolen dargestellt werden. Der Betrachter empfindet das lächelnde Gesicht als Zeichen der Entwarnung, eventuell als Signal der Sympathie. Eine dargereichte Blume ist eben nicht nur eine duftende, farbenreiche, fraktal-ästhetisch schöne Blüte, sondern auch ein Symbol des Dankes, der mehr empfunden wird als dass er ausgesprochen werden könnte.
In der Kommunikation verfügen Auge und Ohr über ein großes vorsprachliches Spektrum von Formen des Wahrnehmens und Begreifens, in dem es fließende Übergänge zwischen natürlichen und kulturellen Symbolen gibt. Präsentative Zeichen haben eine unmittelbar sinnlich-körperliche Wirklichkeit, sie müssen nicht übersetzt werden in diskursive Symbole der Sprache.
Der Mensch als Holobiont
„Nicht der Mensch bewohnt diesen Planeten, sondern Menschen“, hat Hannah Arendt einmal formuliert. Was sie nicht ahnte: Diese Menschen sind nicht nur kommunikativ, sondern auch schon biologisch vernetzt. Was wir „sehen“ ist nur die abschließende Außenhaut. Der ausgewachsene menschliche Körper setzt sich aus rund 75 Billionen Zellen zusammen.Neunzig Prozent dieser Zellen sind Einzeller, Bakterien, Geißeltierchen und Amöben, die von den Produkten unseres Stoffwechsels leben. Diese Zellen sind in unseren Armen und Beinen, auf unserer Haut, in unserem Herzen und in unseren Gedärmen. Milben arbeiten in den Nasenlöchern, Würmer im Verdauungstrakt. Insgesamt gibt es im menschlichen Körper mehr Bakterien und deutlich mehr Viren als körpereigene Zellen. Auch die Oberflächen des Körpers - Haut, der Darm, Atemwege, Lunge - sind von einem stabilen Mikrobiom besiedelt. Diese Zellen gehören zu dem, was Leben ist - viele haben symbiotische Lebensfunktionen, einige schmarotzen, erregen Krankheiten. Und diese Einzeller respektieren nicht die Haut als Außengrenze eines Imperiums, das der Mensch als sein „Ich“ betrachtet, sie tauschen sich mit den Einzellern anderer Menschen aus, sie „kommunizieren“, bilden Gemeinschaften auf ihre Art. Das ist der Mensch, wie ihn moderne Biologen wie der Zürcher Ökologe Paul Schmid-Hempel beschreiben. Organismen sind immer multi-organismisch, es gibt im engeren Sinn keine Individuen, die für sich alleine bestehen könnten. Unser Körper ist eine Lebensgemeinschaft. Wir können nur als Ökosystem existieren in einer evolutionären Partnerschaft mit Mikroben – darauf verweist der Begriff „Holobiont“. Und die Mikroben, Bakterien, Viren, Sporen usw. stehen in einem unaufhörlichen Austausch – auch mit Zellen anderer Lebewesen.
Dem kommunikativen Kraulen mit Hilfe der entwickelten Sprache geht also die direkte „leibliche Kommunikation“ von Holobionten voraus. Leibliche Kommunikation ist die grundlegende Form der gegenseitigen Wahrnehmung, ein „bemerken, was los ist“ – bevor spezifischen Empfindungen aus Sinnesreizen aufgenommen und affektiv verarbeitet werden. Leibliche Kommunikation geschieht überwiegend präpersonal, d.h. nicht bewusst. Eigenleibliches Spüren und affektives Betroffensein, so formuliert der Kieler Philosoph Hermann Schmitz, sind die Formen der ganzheitlichen Wahrnehmung. Der Schreck ist ein typisches Beispiel leiblicher Kommunikation, wir „verstehen“ eine schreckhafte Reaktion, auch wenn wir nichts über die Gründe wissen. Der Schreck wirkt unmittelbar ansteckend, bevor der Erschrockene seinen Schreck nach Ursache und Angemessenheit analysiert und rational begriffen hat.
Körper und Leib
Hermann Schmitz versucht, mit neuen Worten neue Blickwinkel zu eröffnen. Er betont die Unterscheidung von „Körper“ vom „Leib“. Diese Unterscheidung ist umso wichtiger, als in den digitalen Medien die kommunikativen Begegnungen ohne präsenten Leib zunehmen. Die Bilder können den Körper zeigen, nicht den Leib. Was macht den Unterschied aus, warum ist es sinnvoll, „Körper“ und „Leib“ zu unterscheiden?
Der biologisch-medizinische Blick hat aus dem „Körper“ ein Objekt gemacht, einen sichtbaren Gegenstand, ein nach außen abgeschlossenes Objekt der Betrachtung, Überlegung und Benutzung. Was wir sehen und ertasten können, ist die Oberfläche. Und aus der Biologie haben wir anschauliche Vorstellungen von den mechanischen Mechanismen des Körpers und von den inneren Organen – Bilder, die aber künstliche Visualisierungen sind. Niemand kann ein reales Herz so sehen wie es im Biologiebuch abgebildet ist.
Leib ist für Schmitz dagegen das, was der betreffende Mensch selbst spüren kann, „ohne sich auf das Zeugnis der fünf Sinne, besonders des Sehens und Tastens, zu verlassen“. (Schmitz) Der Mensch empfindet seinen Leib als unteilbar und damit sich als ein Ganzes. Mein Leib ist das gefühlte Ich, das ich anderen Menschen nur schwer mitteilen kann und das ich vor allem mit geschlossenen Augen deutlich spüren kann. Besonders sensibel ist das Spüren an der Außengrenze – der Haut.
Der Säugling ist, was er spürt und was er empfindet und fühlt in der symbiotischen Einheit mit dem Mutterleib. Erst wenn er sich im Spiegelbild erkennen kann, sagt man ihm: Das ist dein Körper. In den letzten 200 Jahren haben die zunehmenden biologischen und medizinischen Kenntnisse von dem Körper, mit dem wir praktisch umgehen können, den subjektiv gespürten Leib verdrängt. Nur in dem Gegensatz von „Unterleib“ und „Oberkörper“ lebt die alte Terminologie weiter.
Das gefühlte Ich ist „binnendiffus“ (Schmitz), d.h. an ihm ist nicht alles (eventuell gar nichts) einzeln erkennbar und benennbar. Eine Situation wird durch ihre Bedeutsamkeit zusammengehalten. Die Bedeutsamkeit vermittelt sich spontan durch leibliche Wahrnehmung und emotionale Kommunikation.