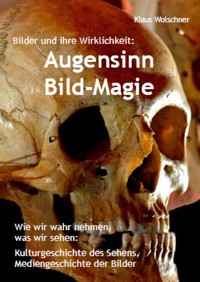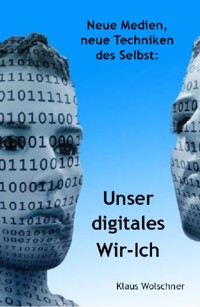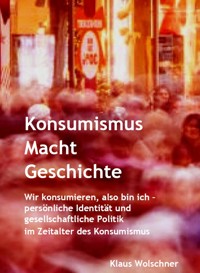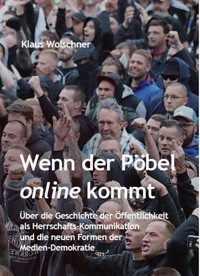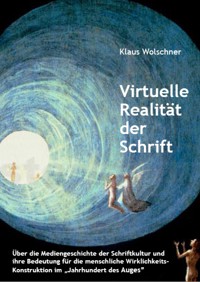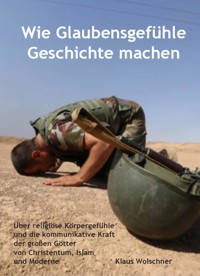
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Religiöse Kommunikation kennt unzählbare Erzählungen, aber in ihrem Zentrum steht das Gefühl. Der alte Cicero hat das wunderbar formuliert: Die Philosophen haben unterschiedlichste Ansichten über Gestalt der Götter und ihren Aufenthaltsort. Es gibt sogar Philosophen, "die meinten, die Götter kümmerten sich überhaupt nicht um die menschlichen Geschicke". Bis heute empfinden religiös gebundene Menschen ihre Beziehung zu Gott. Religiöse Riten zelebrieren das gemeinsame Gefühl. Bei aller Unterschiedlichkeit der Religionen und ihrer Erzählungen - die fromme Körperpraxis ist austauschbar. Auch wenn viele Worte gemacht werden – im Kern des Glaubens geht es um dasselbe, um dieselben Emotionen. Nur der gefühlte Glaube ist höher als alle Vernunft. Erst im Lichte des gefühlten Glaubens werden die wundersamen und unglaublichen Erzählungen zu Metaphern höherer Wahrheit. Sowohl das Christentum wie der Islam sind nur zu "Weltreligionen" geworden, weil sie machtpolitisch in Dienst genommen wurden. Gibt es solide politische Macht ohne spirituelle Basis, die sich in Glaubensüberzeugungen und Unterwerfungs-Ritualen ausdrückt? Da wo der Staat nicht solche Glaubensüberzeugungen einfordert und anbietet, wuchern sie als wilde populistische Strömungen von unten. Die Idee eines Patriotismus, der sich auf die Verfassung bezieht, scheint eine Illusion der Aufklärung. Was sich zeigt, ist ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen nach einer rückhaltlosen Identifikation mit der Gemeinschaft, nach einer religiösen oder quasi-religiösen Form der Identifikation. Weder der "Konsumterror" noch die Verlockungen der "Erlebnisgesellschaft" haben den Menschen dieses Bedürfnis ausgetrieben. Die Texte in diesem Buch spüren den historischen Erscheinungsformen religiöser Kommunikation nach - mit einem Ausblick auf die Leerstelle im modernen Denken, die das Verblassen des Christentums im aufgeklärten Europa hinterlässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Wolschner
Wie Glaubensgefühle Geschichte machen
Über religiöse Körpergefühle und die kommunikative Kraft der großen Götter von Christentum, Islam und Moderne
Bremen, März 2018/2025
INHALT
Kapitel
1 - Wie der Geist in den Kopf kam
2 - Meistererzählungen der symbolischen Kultur
3 - Körper beten - die leibliche Wahrnehmung des Göttlichen
4 - Der gescheiterte Jesus und der Erfolg des Christentums
5 - Aber Gott ist auch weiblich
6 - Das Scheitern des ursprünglichen Islam
7 - Der imperiale osmanische Islam
8 - Erfolgsgeschichte der Reformation – warum Luther?
9 - Der moderne Sisyphos
10 - Populismus in der aufgeklärten Moderne
Literaturhinweise
Vorwort
Wie Glaubensgefühle Geschichte machen
Über religiöse Körpergefühle und die kommunikative Kraft der großen Götter von Christentum, Islam und Moderne
Für die französischen Revolutionäre - und nicht nur für sie - war klar, dass man ohne die emotionalen Bindungen der Menschen keinen Staat machen kann. Weil sie die katholische Kirche entmachten wollten, suchten sie profanen Religionsersatz. Und scheiterten damit. In Anwesenheit von 6.000 Würdenträgern und Diplomaten wurde Napoleon Bonaparte schließlich „durch die Gnade Gottes und die Konstitutionen der Republik“ in der Kathedrale Notre Dame 1804 zum Kaiser gekrönt - er nahm Papst Pius VII. die Krone aus der Hand und setzte sie sich selbst auf. Im Jahre 1806 dekretierte Napoleon die Feier des „Heiligen Napoleon“, angeblich eines Märtyrers aus der Zeit des Diokletian, den der römische Märtyrer-Kalender allerdings nicht kannte. Der Nationalfeiertag sollte schließlich der 15. August sein - Napoleons Geburtstag, Tag der Feier von Mariä Himmelfahrt und der Tag der Unterzeichnung des Konkordats von 1801, mit dem der Frieden mit der katholischen Kirche geschlossen worden war. Das war ein Spektakel seiner Macht, das an den konstantinischen römischen Kaiserkult anknüpfte. Napoleon feierte sich als Retter der Kirche, als Herrscher und lebender Heiliger. Der im Jahre 1806 gedruckte französische Katechismen erhielt einen Zusatz: „Wir schulden Napoleon Liebe, Respekt, Gehorsam, Treue und Gebete für seine Errettung. Unseren Kaiser zu ehren und ihm zu dienen bedeutet, Gott selbst zu ehren und ihm zu dienen.“ Die Katholiken, und das war damals die große Mehrheit der Franzosen, nahmen das Angebot Napoleons zufrieden an. Sie liebten ihren Napoleon und ihre Kirche.
Transzendente Überzeugungen bilden das emotionale Fundament staatlicher Macht. Daran laborieren säkulare Reformer seit der Erfahrung der französischen Revolution. Sowohl die kommunistische Staatsmacht wie der Nationalsozialismus bedienten sich umfangreicher quasi-religiöser Rituale und viele Untertanen entwickelten „glaubten“ an ihre Botschaft. Warum lässt sich die Magie der Glaubens-Wahrheiten zwar profan ersetzen, aber nicht überwinden?
Jesus von Nazareth ist Gottessohn, für mich gestorben, dann aber auferstanden von den Toten. Das ist der Kern der christlichen Glaubenssätze und enthält das klassische Muster einer Verschwörungstheorie: Da nicht sein kann, was nicht sein darf, war er nicht tot, sondern auferstanden wie mancher Halbgott in den damals verbreiteten Mythen. Auch 2000 Jahre danach ist das noch „Glaubenswahrheit“ für viele Menschen, die sonst in ihrem täglichen Leben mehr auf die Logik des „2x2=4“ bauen. Die Frage, ob eine Schöpfung nicht eine Fehlkonstruktion sein muss, wenn der Schöpfer seinen Sohn zur Rettung seiner wichtigsten Geschöpfe ans Verbrecherkreuz schicken muss, ist Ketzerei.
Aber wie kann jemand, der zutiefst von einer höheren Glaubens-Wahrheit überzeugt ist, konvertieren – als Christ zum Islam, das den einen Gott Allah nennt – oder zum Glauben an die Erleuchtung des Gautama Buddha? Unvorstellbar, dass ein Mensch zu der Vorstellung „konvertiert“, Steine würden nach oben fallen. Aber die „Konversion“ von den christlichen Glaubens-Wahrheiten zu denen des Islam oder fernöstlicher Gedanken ist ein alltäglicher Vorgang.
Religiöse Kommunikation kennt unzählbare Erzählungen, aber in ihrem Zentrum steht das Gefühl. Der alte Cicero hat das wunderbar formuliert: Die Philosophen haben unterschiedlichste Ansichten über Gestalt der Götter und ihren Aufenthaltsort. Es gibt sogar Philosophen, „die meinten, die Götter kümmerten sich überhaupt nicht um die menschlichen Geschicke“. Und die, die die Existenz von Göttern bejahen, tun das „unter Führung des natürlichen Empfindens“. (De natura Deorum, 45 v.u.Z.)
Bis heute empfinden religiös gebundene Menschen ihre Beziehung zu Gott, mit Riten zelebrieren sie das gemeinsame Gefühl. Bei aller Unterschiedlichkeit der Religionen bleiben ihre Erzählungen und ihre frommen Körperpraxen austauschbar. Auch wenn viele Worte gemacht werden – im Kern des Glaubens geht es um dasselbe, um dieselben Emotionen. Nur der gefühlte Glaube ist höher als alle Vernunft. Erst im Lichte des gefühlten Glaubens werden die wundersamen und unglaublichen Erzählungen zu Metaphern höherer Wahrheit.
Das Wort „heilig“ signalisiert, dass hier - quer durch das profane Leben - eine magische Grenze läuft: Schriften werden zu „Heiligen Texten“, sterbliche Menschen zu Heiligen und Gegenstände zu „heiligen Reliquien“. Religiöse Kommunikation ordnet mit der Macht der Emotionen den geistigen Horizont – es macht Unsagbares sagbar und schafft Abgrenzung gegen Fremdes. Mit Religion ist also Staat zu machen – gegen „ungläubige“ innere Feinde und äußere. Unsagbar niedere Motive werden zu sagbaren heiligen, also nicht hinterfragbaren Motiven.
Solche in Gefühlen verankerten Bedürfnissesind religionsübergreifend und sie überdauern historische und gesellschaftliche Veränderungen – es gibt seit den archaischen Zeiten keine Gesellschaft ohne Religion. Auch die Aufklärung und Jahrzehnte des militanten Atheismus in den Staaten des „realen Sozialismus“ haben den Menschen die religiösen Gefühle nicht austreiben können. In unserer modernen Konsumgesellschaft, die einer Welt voller individualistischer Unübersichtlichkeit ist, bieten die spirituellen Angebote wie auf einem „Sinnmarkt“ eine stabile Identität, eine krisenresistente Weltdeutung und ein dichtes Netzwerke der Solidarität. „Im Himmel ihres autoritären Vatergottes herrschen die klaren Verhältnisse unumstößlich evidenter Wahrheit.“ (Wilhelm Graf)
Glaube ist nichts Einsames, sondern etwas Gemeinsames. Glaube bindet persönliches Empfinden und persönliche Überzeugungen in die Überzeugungen und Empfindungen der Gemeinschaft ein. Religion ist die Institutionalisierung der Kommunikation einer Glaubensgemeinschaft, getragen von den Spezialisten für das Heilige, den Schamanen, Priestern und Predigern. Für das Volk bedeutet Religion die Verinnerlichung von rituellen Vorschriften, die, so das lateinische „relegere“, gewissenhaft beachtet werden sollen. Zur Kommunikation gehört der mythische Erzähl-Kanon genauso wie die Bereitschaft, die Botschaft gläubig anzunehmen und zu verinnerlichen, sie „im Herzen zu bewegen“.
Politische Macht braucht Glaubens-Wahrheiten. Sowohl das Christentum wie der Islam sind zu „Weltreligionen“ geworden, weil sie machtpolitisch in Dienst genommen wurden. Religiöse Neuerer- oder Erweckungsbewegungen sind nur von Dauer, wenn sie sich irgendwann in einen etatistischen Dienst stellen und entsprechend umformen lassen.
Gibt es solide politische Macht ohne spirituelle Basis, die sich in Glaubensüberzeugungen und Unterwerfungs-Ritualen ausdrückt? Diese Frage ist zum Beginn des 21. Jahrhunderts so aktuell wie in früheren Epochen. Da, wo der Staat nicht solche Glaubensüberzeugungen einfordert und anbietet, wuchern sie als wilde populistische Strömungen von unten. Die Idee eines Patriotismus, der sich auf die Verfassung bezieht, oder eines vernünftiges Dialoges vernünftiger Bürger, scheint gescheitert, eine Illusion der Aufklärung.
Was sich zeigt, ist ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen nach einer rückhaltlosen Identifikation mit der Gemeinschaft, nach einer religiösen oder quasi-religiösen Form der Identifikation. Das Bedürfnis nach mentaler Sicherheit sucht Antworten auf Fragen, die die eigene Vernunft übersteigen, weil es darauf keine vernünftigen Antworten gibt. Weder der „Konsumterror“ noch die Verlockungen der „Erlebnisgesellschaft“ haben den Menschen dieses Bedürfnis nach mythischer Verankerung ausgetrieben.
Die Texte in diesem Buch spüren den historischen Erscheinungsformen religiöser Kommunikation nach - mit einem Ausblick auf die Leerstelle im modernen Denken, die das Verblassen des Christentums im aufgeklärten Europa hinterlässt.
Kapitel 1 - Wie der Geist in den Kopf kam
Vom Beginn an nutzte der homo sapiens, als er sich in größeren Gruppen zu organisieren begann, seine Fähigkeit, mit seiner fiktiven Sprache mythische Gedanken zu denken und sich darüber auszutauschen, also sich gemeinsam Mythen vorzustellen und durch solche Mythen die Gemeinschaft zu festigen. Bis heute stützen sich die Machthaber großer Reiche auf große mythische Erzählungen. Religiöse Kommunikation ist eine Kultur-Technik für den Zusammenhalt menschlicher Gemeinschaften.
Als höhere „Wirklichkeit” werden Konstruktionen des Geistes normalerweise nur anerkannt, wenn sie bestätigt und geteilt werden von Bezugspersonen. Der Tod verliert seinen Stachel durch die Vorstellung, dass die Seele des Verstorbenen wie der Rauch des Feuers gen Himmel steigt. Insbesondere angesichts des Todes versprechen die Mythen aller erfolgreichen religiösen Kulturen der Weltgeschichte Trost und innere Ruhe. Gemeinschaften nutzen solche Mythen, um ihren Zusammenhalt zu organisieren und die Zumutungen des Zusammenhalts zu legitimieren. Der Glaube erhöhte schon immer den Zusammenhang der Gruppe und damit die Überlebenschance auch jedes Einzelnen. Religiöse Vergemeinschaftung verbindet durch Glaubensgefühle und tabuisiert den Kern der Regeln ihres Zusammenlebens, entzieht sie jeglicher Diskussion.
Kapitel 2 – Meistererzählungen der symbolischen Kultur
Die religiösen Erzählungen sind„Meistererzählungen“ mit jahrhundertelanger Wirkung. Warum haben die Menschen die „Big Gods“ erfunden? Das hat Albrecht Koschorke in seiner „Theorie der Erzählung“ überzeugend dargestellt. Haben wir nicht mit der Aufklärung das mythische Denken überwunden? Keineswegs. Der Urgrund des Denkens sind nicht die Wortkonstruktionen, die wir wie Wäsche an der Leine zu Sätzen aufreihen können. Den Urgrund des Denkens bilden innere Bilder, also schwankende Gestalten voller Emotionen. Mit seinen religiösen Gedankengebilden versucht das biologische Wesen Mensch seine Einbindung in ein soziales Gemeinsames zu be-greifen, sein individuelles Verhalten wird eingebunden in eine sinnhafte Menschheitsgeschichte, die Sünden, Anfang und Ziel kennt. Unergründliches wird mit den mythischen Sprachmetaphern benennbar.
Kapitel 3 – Körper beten – die leibliche Wahrnehmung des Göttlichen
Glaubens-Wahrheiten können und sollen nicht falsifiziert werden – genauso wie religiöse Überzeugungen. Glaubens-Wahrheiten sind das Ende des rationalen Diskurses. Offenbar gibt es eine emotionale Grundstruktur, die hinter ganz unterschiedlichen Erzählungen in unterschiedlichen Epochen steckt. Menschen beten nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Körper.
Welch herrliches Wort! Glaubens-Wahrheiten. Unser Glaube lässt Dinge als „wahr“ erscheinen, die wir nicht weiter begründen können und wollen. Der Mensch kann die göttliche Kraft nicht begreifen, sondern nur spüren. Er macht sich zum Kind, wo er den Vater anspricht und um Gnade für seine Sünden bittet - offenbar ist die Krone der Schöpfung mit all ihrer Vernunft nicht in der Lage, aus sich heraus ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Die Sünde wurde in die Gottesvorstellungen eingefügt, das Unmoralische seiner Kreatur zu erklären und die Gläubigen von der Hierarchie der Kirche abhängig zu machen.
Der Glaube ist etwas Persönliches, Individuelles und gleichzeitig ein kommunikativer Kitt, der große Gemeinschaften zusammenschmieden kann. Dieses Gemeinschaftserleben vollzieht sich im gemeinsamen Gesang und im chorischen Sprechen. Das Heilige erscheint in Kulthandlungen.
Kapitel 4 – Der gescheiterte Jesus und der Erfolg des Christentums
Unübersehbar sind die Schriften, die mehr oder weniger kritisch die Frage aufwerfen, wie aus der Lehre des „Juden Jesus“ das paulinische Gedankengebäude des Christentums werden konnte. Offenbar gab es im römischen Imperium keinen Bedarf mehr für eine authentische jüdische Reformbewegung. Aber es gab einen begrenzten Bedarf für die paulinisch-christliche Erzählung.
Dann wurde das christliche Glaubensbekenntnis wurde von dem römischen Kaiser Konstantin zum Zwecke der Macht-Legitimation geschaffen, in Nicäa in der Nähe von Byzantion. Der römische Imperator brauchte eine einheitliche Religion zur Herrschaftslegitimation und wollte daher die zerstrittenen christlichen Gemeinden einen. Erst als römische Kaiser über Generationen sich dieser Erzählung bedienten und sie mit aller Macht zur Herrschaftsideologie das römischen Imperium machten, setzte sich das Christentum durch – als Staatsreligion, zwei Jahrhunderte nach Konstantin. Das Christentum als institutionalisierte Kirche wurde umso erfolgreicher, je mehr das westliche römische Imperium niederging.
Kapitel 5 – Aber Gott ist auch weiblich
Die paulinische „Glaubenswahrheit“ hatte einen zentralen Webfehler – bei der Frauenfrage. Obwohl sich anfangs vor allem die Frauen den Paulus-Gemeinden anschlossen. Aber bis heute leidet das Christentum darunter, dass für die Frauen keine gute Geschichte angeboten wird. In den langen Jahrhunderten, in denen das Christentum quasi Staatsreligion war, wurde Maria – deren Rolle die Evangelisten nicht erwähnenswert fanden – zu einer heilsbringenden Lichtgestalt entwickelt, die im Glaubensleben der Menschen mehr Bedeutung hatte als der zürnende Gottvater. Gott wurde sozusagen weiblich - wieder. Schon die ganz alten Götter, die aus den Zeiten vor dem unsagbaren Herrscher JAHWE, waren auch Göttinnen gewesen.
Kapitel 6 – Das Scheitern des ursprünglichen Islam
Im Osten des römischen Imperiums hat sich ein abrahamitischer Monotheismus in Form des Islam als Instrument der Machtzentralisierung entwickelt. Die Stämme der Wüste schmiedete Muhammad im frühen 7. Jahrhundert zu einer schlagkräftigen arabischen Kriegergemeinschaft zusammen. Es gab verschiedene jüdisch-christliche Traditionen, die frühen arabischen Herrschaft in Damaskus bezogen sich auf christliche Symbolik und besiegten im innerarabischen Machtkampf den Kalifen von Mekka. Die eindeutig islamische Erzähltradition entstand erst hundert Jahre später fern ab von der Wüste im persischen Kulturraum, in Bagdad, zur machtpolitischen Abgrenzung von dem Kaiser in Konstantinopel. Und im 13. Jahrhundert scheiterte dieser Islam in internen Machtkämpfen - Bagdad wurde im Jahre 1258 dem Erdboden gleichgemacht.
Kapitel 7 - Der imperiale osmanische Islam
Dass der Islam seit 1453 über Jahrhunderte die Staatsreligion des Osmanischen Reiches wurde, ist eine andere Geschichte, die damit beginnt, dass die kriegerisch erfolgreichen Mongolen unter der Führung ihres Heerführers Osman ihre Stammesreligionen gegen den Glauben der eroberten Städte eintauschten.
Kapitel 8 – Erfolgsgeschichte der Reformation – warum Luther?
Der kleine Mönches Martin Luther war alles andere als ein Vordenker der Aufklärung. Dennoch hat die Reformation wie ein Brandbeschleuniger der Renaissance gewirkt. Sie hat den Funken der Erneuerung in den kulturell rückständigen deutschsprachigen Raum geholt.
Luther hatte sich nicht für das wiederentdeckte Wissen der Antike interessiert, er zerstritt sich mit dem großen Humanisten Erasmus von Rotterdam und er nahm die Entdeckungen der Naturforscher in ihrer Bedeutung nicht wahr. Luther war ein Fanatiker des religiösen Gefühls – nur deswegen konnten seine Gedanken vom Volk aufgegriffen werden. Er hat die elitäre lateinische Herrschaftskommunikation durch eine schlichte Frömmigkeit, verbreitet in seinem genialen Lutherdeutsch, in Verlegenheit gebracht. Luther war ein Fanatiker, jeder sollte nur die Bibel lesen können. Schließlich wollte jedermann lesen lernen, um mitreden zu können - erst über den Glaubensstreit, später über die politische Ordnung.
Kapitel 9 – Der moderne Sisyphos
Menschen brauchen eine Aufgabe, um ihr Leben als „ausgefülltes Leben“ empfinden zu können. Und sie brauchen Gemeinschaft. Nicht nur die Familie, sondern auch eine große Gemeinschaft, die mehr sein muss als ein nüchterner vertraglicher Zweckverband, wenn sie viele Sippen dauerhaft zusammenschweißen soll.
Säkularisation bedeutet, dass Gemeinschaftsgefühle sich andere Erzählungen als die klassischen Religionen suchen müssen. Vor allem die „Nation“ entwickelte sich in der europäischen Neuzeit zu zivilen Ersatz-Religion. Seit der Französischen Revolution wird die Nation als Volksgemeinschaft im Krieg gegen Fremde geschmiedet. Karl Mark stellte der nationalen „Volksgemeinschaft“ seinen Klassenbegriff entgegen, übernahm aber Elemente der religiösen Verheißung. In diesem Sinne können sowohl Kommunismus wie Nationalsozialismus als „Säkularreligionen“ verstanden werden, die die Gefühlsbasis der klassischen Religionen durch eigene Körperrituale ersetzen und eine weltanschauliche Alternative zum „Ewigen Leben“ anbieten.
Kapitel 10 - Populismus in der aufgeklärten Moderne
Das gefühlsmäßige Potential, aus dem sich die Religionen speisten, ist im modernen Europa heimatlos geworden. Es äußert sich in individuellen Patchwork-Kulten wie auch in populistischen Moden – außerhalb der schwindenden Bedeutung der großen Kirchen und neben den Sphären der Rationalität, die das Leben der Menschen in ihrem Alltag bestimmen. Auch die Gründungs-Metaphorik der deutschen Grünen hatte mit ihrer quasireligiösen Endzeit-Vorstellung des „5 vor 12“ säkularreligiöse Elemente – immerhin sollte Gottes Schöpfung gerettet werden.
Neu ist, dass keine nationale Informationselite mehr das selektieren und steuern kann, was die Menschen über die Welt denken und empfinden. Am Anfang der Demokratiegeschichte wollten alle einmal in vier Jahren mitwählen, heute wollen alle täglich mitreden. Die Zeiten, in denen eine „Mediokratie“, eine Symbiose von Politik und Medien die politischen Überzeugungen vorsortierte, sind mit der digitalen Gesellschaft vorbei.
Im Herrschaftsbereich des Islam erleben wir eine Renaissance eines archaischen Islam, die man nur als wütenden Protest angesichts des Scheiterns an den Globalisierungserfordernissen der modernen Welt begreifen kann. Im Kulturbereich des christlichen Europa gibt es für den Populismus keine religiösen Angebote mehr, er artikuliert sich politisch, wenn auch ohne soziale Utopie. „Verfassungspatriotismus“ jedenfalls ist zu vernünftig und daher zu wenig als gemeinschaftsstiftende Kraft.
Kapitel 1
Wie der Geist in den Kopf kam
Was ist die Substanz des Gehirns? Lauter Kohlenstoff-Verbindungen.Wurde mit der Aufklärung das mythische Denken überwunden? Keineswegs. Den Urgrund des Denkens bilden nicht die logisch anmutenden Wort-Konstruktionen, die wir wie Wäsche an der Leine zu Sätzen aufreihen können, sondern innere Bilder, schwankende Gestalten voller Emotionen. Das diskursive Bewusstsein ist eine sekundäre Kulturtechnik, mit der der Mensch versucht, seinen phantastischen Geist zu disziplinieren.
Phantastische Vorstellungen gehören zur mentalen Grundausstattung des Menschen. Lebewesen reagieren reflexartig, wenn sie ihre rudimentären Sinneswahrnehmungen - ein Rascheln im Laub – als Signale einer Gefahr deuten. Solche Reaktionsmuster sind vielfach angeboren und bedürfen keines „Bewusstseins“. Der Mensch konstruiert in seinem Bewusstsein ein komplettes „Bild“ der Gefahr. Natürlich im Nachhinein, eine „vernünftige“ Analyse der Indizien zur Interpretation der Bedrohungssituationen und ihrer Wahrscheinlichkeit würde viel zu lange dauern. Wie ein „Nachbild“ sehen wir vor unserem geistigen Auge noch die Schlange im Laub, wenn wir längst zur Seite gesprungen und der Gefahr entronnen sind. Und eventuell feststellen, dass da keine Schlange war. Mit dem mentalen Nachbild rechtfertigt unser Geist geradezu, dass wir zur Seite gesprungen sind.
Dieser mentale Mechanismus funktioniert aber nicht nur in der nachträglichen Verarbeitung von reflexhaften Reaktionen. Aus Wahrnehmungselementen konstruiert das Gehirn das Wirklichkeits-Bewusstsein und „konfabuliert“ eine komplette Geschichte. Dieser Mechanismus des Gehirns ist die Grundlage mythischen Erzählens, mit dem das emotional Erlebte in Worte gefasst werden kann.
Das menschliche Gehirn hat geradezu Spaß daran, mit mentalen Symbolen zu jonglieren. Das menschliche Gehirn ist fähig, Sinneseindrücke schöpferisch zu verarbeiten und eine Vielfalt von phantastischen Ausdrucksformen, die die Sinneseindrücke symbolisch transzendieren, zu erschaffen. Wenn die Kontrollfunktion der Wahrnehmung der äußeren Realität nachlässt, im Traum, dann entfaltet das Gehirn unzensiert seine schöpferischen Qualitäten, in der es wie in der Meditation keine Trennungslinie zwischen Ich und sozialer Umwelt gibt, zwischen virtuellen Gedanken-Kreationen und harten Gegenständen.
Dank seines phantastischen Gehirns kann sich der Mensch Steine als Geister vorstellen und er kann geheimnisvolle geistige Kräfte und subjektive Empfindungen in materielle Gegenstände hineinphantasieren. Die Menschen bauten ihre eigenen Gehirn-Gespinste in ihre Wirklichkeits-Wahrnehmung ein, Götter und Engel sind „wirklich“ wie die Unwetter und die Schicksalsschläge, in denen sie angerufen werden. Das gilt für das entwickelte christliche Dogmengebäude wie für die religiöse Praxis der Schamanen. Für die Götter werden Tempel gebaut, Prozessionen organisiert und Tänze aufgeführt.
Sinn-Bedürfnis und Religion
Solange die Menschen noch ganz in ihrer Sippe integriert waren und diese Gemeinschaft ihre ganze Welt bildete, stellt sich die Frage nach Sinn nur für die Sippe und die Sippe ist unsterblich. Erst ein Mensch mit individuellem, rationalem Selbstbewusstsein, der sich neben seiner Gemeinschafts-Zugehörigkeit auch als Einzelner versteht, fragt nach dem Sinn seines Einzelschicksals – und nach dem Sinn seines individuellen Leidens. Erst der Mensch, der sich als Einzelwesen begreift, kann seinen individuellen Tod als etwas Bedrohliches begreifen. Noch in modernen Begräbnis-Ritualen steht im Zentrum, das verstorbene Individuum sozial einzubetten.In den alten Mythen stellte sich die Frage nach dem individuellen Schicksal nicht, erst in den mesopotamischen Schöpfungsmythen wird sie aufgeworfen. In Ägypten taucht um 2400 v.u.Z. die Frage nach dem menschlichen Heil auf, das auch das Leben nach dem Tod umschließt.
Die alten Religionen bieten einen Sinn, der die gesamte Gesellschaft durchdringt und für das kollektive wie das individuelle Leben mit seinen Institutionen, Gesetzen, Sitten und Gebräuchen Regeln rechtfertigt. Die religiösen Erzählungen müssen im Unglück einen Sinn erkennen. Das Bedürfnis nach Sinn war für die Menschen in diesem kulturellen Entwicklungsstadium offenbar stärker ausgebildet als das Bedürfnis nach Glück.
Meditierendes und diskursives Bewusstsein
Es gibt ein panoramaartiges, träumerisches Schauen, das gekennzeichnet ist von großer Offenheit gegenüber der Umwelt. Dieses träumerische Bewusstsein lässt die Gedanken treiben, es meditiert. Dieser paradiesische Blick (er-)kennt weder gut noch böse. Dieses meditierende Bewusstsein unterliegt nicht dem Raster der linearen Zeit, es unterscheidet nicht zwischen aufsteigenden vergangenen Erlebnissen und momentanen Wahrnehmungen - gefühlsmäßig scheinen beide gleich, auch gleich intensiv. Auf Erinnerungen an Vergangenes können wir gefühlsmäßig heftig reagieren - als wäre es aktuell passiert. Menschen, die zu dieser Kontrolle ihrer aus der Erinnerung aufsteigenden Bewusstseins-Inhalte nicht fähig sind, werden als wahn- und krankhaft beschrieben.
Das geschulte, kultivierte, „diskursive“ Bewusstsein ist dagegen ein waches Bewusstsein, basiert auf gezielt ausgerichteter Wahrnehmung, auf Hinhören und nicht nur Hören, Hinsehen und nicht nur Sehen oder (beiläufigem) Schauen. Das gezielte Hinsehen identifiziert einzelne Elemente des Gesehenen, sortiert im Sehen nach Erwartungen, Erinnerungen und Gedanken. Es verarbeitet das Wahrgenommene – es ist denkendes Wahr-nehmen. Das denkende Erkennen klassifiziert den alten Zustand als vorgeschichtlich – als „Paradies, aus dem der Mensch vertrieben wurde, als Zerstörung der Einheit von Göttlichem und Menschlichen. Eine andere Metapher beschreibt den Übergang als Verstummen der Götter. Buddha lehrte die Meditation als Methode, dieses diskursive Denken zu überwinden, auszuschalten und zurückzufinden zu einer paradiesischen Verschmelzung mit der Umwelt – Nirwana.
Die unaufhörliche Wiederholung von Mantras kann die Verbindung gesprochener Worte zu ihrem Inhalt kappen und an Trance-Zustände heranführen. Das wache Bewusstsein kann solche Erfahrungen als Wahn- oder Traumvorstellungen klassifizieren, in denen Hinweise auf den zeitlichen Bezug und örtliche Kontext-Elemente, die der Wahrnehmungs-Kontrolle dienen, fehlen. Aber das subjektive ICH-Erleben ist ein spätes Produkt in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Wie es entstanden ist im Zusammenhang von Evolution und Sprachentwicklung beschreibt der amerikanischen Psychologe Julian Jaynes.
Wort-Laute, Zeige-Gesten, sinnliche Wahrnehmung
Kognitive Fähigkeiten entstehen als affektiv-emotionale Verarbeitungs-Mechanismen, der Mensch sortiert Wahrgenommenes nach Affekten, Emotionen und nach Zeichen. Ernst Cassirer nähert sich der Frage nach den ursprünglichen Wahrnehmungen des Gehirns mit so vagen Ausdrucksweisen wie ‚Bewegungsgestalten’ und ‚Raumformen’. Das Gehirn unterscheidet ‚Raschheit’ und ‚Langsamkeit’, ‚Eckigkeit’, ‚Wucht’, ‚Hast’, ‚Gehemmtheit’, ‚Umständlichkeit’ und ‚Übertriebenheit’. Unser Gehirn merkt sich solche „Seeleneigenschaften“ von Wahrnehmungssituationen und erschließt damit die Welt, lange bevor eine Übersetzung in Worte und Begriffe passiert. Die „sprachliche Verlautbarung” durch „Sachbegriffe“ findet erst nach der Vermittlung von „Eindruckserlebnissen“ statt, formuliert Cassirer.
Das Bewusstsein der Wildbeuter-Menschen, deren Fetische die Archäologen auf Zeiten bis vor 30.000 Jahren bestimmen, können wir uns nur als meditierendes, tagträumendes Bewusstsein vorstellen. Da verschwimmen aufsteigende Erinnerungen mit momentanen Wahrnehmungen, beides scheint oft gleich intensiv und präsent. Um die aufsteigenden Tagträume deuten zu können, brauchten diese Menschen offenbar die Schnitzfiguren und die Vorstellung, dass die Figurinen zu ihnen reden. Das Symbolisierte ist im meditativen Bewusstsein verwoben mit dem Symbol. Das meditative Bewusstsein kennt auch keine klare Grenze eines „Ich”. Die buddhistische Meditations-Kultur erscheint inspiriert von einem nostalgischen Zurück-Sehnen nach solchen Formen des archaischen Bewusstseins.
Vorsprachliche Magie
Wir kennen solche Kommunikations-Zustände von zwei- oder dreijährigen Kleinkindern. Auch kleine Kinder haben ein „mythisches“ Bewusstsein, sie nehmen Träume und Märchen so wahr wie ihre Umwelt und können äußere und innere „Geschehnisse“ nicht unterscheiden.
Die Psychoanalytikerin Selma Fraiberg hat das „magische“ Denken des Säuglings beschrieben: Die ersten Klangformen eines Kindes sind „magische Zauberformeln“, die eine Stimmung ausdrücken und ein Ergebnis herbeiführen sollen. Das Kind weiß nicht genau, was beispielsweise „mamma“ ist - es experimentiert mit dieser Lautkombination, probiert Effekte aus. „Mamma“ funktioniert zum Beispiel als Einschlaf-Mantra, es hat etwas Beruhigendes. Wolken regnen, weil sie traurig sind. Ist Mamma krank, weil ich böse war? Liegt der Ball unter der Kommode, weil er schlafen will? In dieser Art der Weltwahrnehmung durch Wortklang-Magie beginnt sich ein Wirklichkeits-Bewusstsein zu bilden. „Rationale“ Prozesse im modernen Sinne setzen erst mit der differenzierten Sprachentwicklung ein. Es ist für ein Kind wirkliche Arbeit, sein auf wildes Denken vorbereitetes Gehirn umzuprogrammieren für die selektiven Muster, die unsere aufgeklärte Gesellschaft als „vernünftig“ akzeptiert, Grenzen zu ziehen zwischen Traum und Wirklichkeit, Eindrücke zu sortieren nach Ort und Zeit.
Wie sehr die Erinnerungsfähigkeit und die bewusste Unterscheidung von Märchen, Erinnerung und gegenwärtigem Erleben an die Sprachfähigkeit gekoppelt sind, zeigen Kinder im vierten und fünften Lebensjahr: Sie beginnen von Erlebnissen zu erzählen und lieben es, wenn ihnen erzählt wird, was sie erlebt haben, und erwerben damit die sprachlichen Möglichkeiten, nicht nur direkt zu reagieren, sondern das Erleben sprachlich zu repräsentieren und zu symbolisieren. Dies ist auch die Voraussetzung bewusster Selbstwahrnehmung, die bei Kindern in der dritten Person beginnt.
Signallaute der Jäger- und Sammler-Kultur
Viele Säugetiere bewegen sich in Gruppen, im Schutz dichter Wälder reichen vielleicht sechs, die Gibbons im offenen Gelände bewegen sich in Gruppen von bis zu 80 Tieren. Mit Signallauten koordinieren die Tiere ihr instinktives Verhalten, bei den Primaten gibt es taktile Kommunikation (Körperpflege, Umarmung, Stupsen mit der Schnauze), stimmliche Kommunikation mit Grunz-, Bell- und Kreischtönen. Es gibt nichtvokale Lautsignale wie etwa Zähneknirschen oder das Patschen auf Zweige. Unterschiedlichste Gesichtsausdrücke und das drohende Auge-in-Auge-Starren gehören zu den visuellen Signalen.
Das Signal-Spektrum kommuniziert besondere Situationen der äußeren Bedrohung und weist auf Nahrungs-Funde hin, Signale dienen aber auch der Kommunikation in inneren Gruppen-Angelegenheiten. Bestimmte Vögel-Arten begrüßen morgens mit ihrem Gezwitscher den Tag und sammeln sich mit „Gesang” für ihre langen Flüge, um dann wie auf ein Kommando in aerodynamischen Mustern loszufliegen. Auch Paviane verständigen sich über Laute und bilden bei ihren Wanderungen ein streng geometrisches Muster. Bei Gorillas entfernen sich Gruppenmitglieder nie mehr als 50 Meter von dem dominanten Tier, die Silberrücken signalisieren ihren Dominanz-Anspruch durch strenge Gerüche. Man darf annehmen, dass die Frühformen des Homo sapiens in ähnlichen Strukturen lebten. Sie verfügten wie alle anderen Primaten über eine Fülle von visuellen und stimmlichen Signalen. Wo ihre Gruppen aus Gründen der Verteidigung und der Jagd größer wurden, so vermutet der britische Psychologe Robin Dunbar, wurde die lauthafte Kommunikation für die Innenbindung der Gruppe wichtiger als das „Kraulen“ und „Lausen“ – das erklärt für ihn, „wie der Mensch zur Sprache fand“.
Aber das war sicherlich zu Beginn eine schlichte Kombination von Sprachlauten, die in ihrer Differenzierung nicht weit über die Kombination von Signallauten hinausgehen musste. Das mentale Bewusstsein der Menschen entwickelte sich mittels der Sprache in einem kumulativen Prozess kultureller Evolution, seine frühe Form war das Kollektiv-Bewusstsein. Die Frage ist also weniger: „Wie einzigartig ist der Mensch?“ (Roth) als vielmehr: „Wie einzigartig sind die Menschen“? Jaynes geht davon aus, dass die Gruppenkommunikation sich erst differenzieren und komplizierter, also komplexer werden musste, als die Jäger- und Sammler sich in sesshaften, ackerbauenden und damit größeren Gemeinschaften niederließen.
Im Zusammenhang der Entwicklung der Sprache und sprachbasierter Kultur hatte das menschliche Gehirn komplizierte Mechanismen entwickelt, um die sensorischen Informationen, die es aufnimmt, zu verarbeiten. Das Gehirn erschafft so auch das Bewusstsein - als Verarbeitungstechnik für die sensorischen Signale. Gedanken, Gefühle und Erinnerungen sind Hilfs-Konstruktionen, um die sensorischen Signale zu ordnen. Unser Gehirn kann nicht anders: Es gehört zur Eigenlogik des Gehirns, die Masse der Signale mit einem Sinn zu überbauen und zu verdrängen, was sich in seine Sinn-Konstruktionen nicht einfügen lassen will.
Das Heilige im Alltag
In archaischen Kulturen war das biologische Leben selbst für die Menschen mit Geist erfüllt, insbesondere die Erotik und die Nahrungsaufnahme. Mircea Eliade hat für das „Aufscheinen des Heiligen im Profanen“ 1949 den Begriff der „Hierophanie“ geprägt. Es ist auffällig, wie stark das gemeinsame Essen das Gemeinschaftserleben von Menschen prägt. Durch die Vorstellungswelt des Opfers wurde das Gemeinschaftsmahl in archaischen Kulturen zu einem heiligen Mahl.
Der französische Ethnologe Michel Leiris hat in seiner Vorlesung (1938) über „Das Heilige im Alltagsleben“ gefragt, was das Heilige für ein Subjekt bedeutet. Für ihn hatte der Zylinder seines Vaters etwas Heiliges, Ehrfurcht erregendes. Also nicht der Rohrstock, das Instrument der väterlichen Macht, sondern die für Kinder fremde Kopfbedeckung, die dem Vater unendlich wertvoll war und die er immer dann aufsetzte, wenn er sich in der Öffentlichkeit als Persönlichkeit von Rang inszenieren wollte. Das Heilige „für mich“ erscheint in Situationen, in denen eine besondere Bedeutung wie eine Atmosphäre den Raum erfüllt und in denen mir die Worte fehlen, um diese Bedeutung und die Besonderheit angemessen zu beschreiben.
Visionen haben etwas Heiliges, weil ich Dinge sehe, die es profan betrachtet nicht geben kann und die jemand, der neben mir steht, daher auch nicht sieht. Der visionäre Anblick der Heiligen Maria ergreift mich und macht mich sprachlos. Der „Heilige Geist“ ist ein unvorstellbarer Geist, der etwa im Pfingsterlebnis bewirkt, dass Menschen sich verstehen, die sich gar nicht verstehen können, weil sie verschiedene Sprachen sprechen. Der „Heilige Geist“ bewirkt, dass ein von Menschen gefasster Konzilsbeschluss zur göttlichen Wahrheit wird, irgendwie.Das Heilige erscheint im Alltagsleben als Metapher immer dann, wenn ich eine Erklärung haben will, die das „irgendwie“ mit einer besonderen Aura umgibt.
Irgendwie werden Menschen geboren, irgendwie sterben sie. Geburt und Tod sind seit den archaischen Stammeskulturen Sache von Schamanen, die das Heilige in seiner sozialen Bedeutung verwalten. Die spirituelle Zeremonie bietet für quälende Fragen hinreichend nebulöse Antwort-Formeln an.
Wohin ist das Alte gegangen? „Der Verstorbene ist weg" oder „zu Erde zerfallen" wäre nicht akzeptabel. Worte wie „Jenseits", „Hel" oder „Scheol" sind zwar auch nur Worte. Sie suggerieren aber, dass es da einen konkreten Ort gibt und sie ermöglichen kulturell geprägte Assoziationen, sei es von der Erdenmitte oder dem Himmel über den Wolken. Wenn die Ahnen im „Scheol“ sind und durch einen Gipsabdruck in der Wohnung symbolisiert wurden, konnte man vor diesem Abdruck Speisen für sie bereitstellen, obwohl es natürlich die Erfahrung gab, dass diese nicht „abgeholt“ werden. Das Wort „Scheol" bringt letztlich also keine alltagstaugliche Klarheit - die Menschen akzeptieren aber die große Unbestimmtheit der spirituellen Antworten auf Ihre grundlegenden Lebensfragen. Solche Unbestimmtheiten würde niemand akzeptieren, wenn die Frage schlicht wäre: Warum ist dein Bruder nicht zum Abendessen vom Spielen hereingekommen? Spirituelle Zeremonien füllen Lücken dort, wo die Alltags-Vernunft vor den großen Fragen der Existenz und des Zusammenlebens kapituliert und keine akzeptablen Antworten kennt und der Mensch sich damit abgefunden hat, dass er auch keine erwarten kann.
Alle schriftlichen Zeugnisse archaischer Kulturen, von China bis zu den mittelamerikanischen Kulturen, malten das ungeheuerliche Bedrohungspotential der Natur aus und führten rätselhafte Schicksalskräfte an, mit denen das Ausgeliefertsein an die Naturkräfte benannt und gebannt und damit „erklärt“ werden sollte. Der Sinn dieser Erzählungen war natürlich nicht die Information über ein Ausgeliefertsein an übermächtige Naturkräfte, das die Menschen kannten, sondern mit der Benennung war konkret eine Unterwerfung unter die Ordnungen derer verbunden, die solche Erzählungen überbrachten. Es gab meist auch einen kleinen Hoffnungsschimmer mit der praktischen Botschaft, wie durch dieses oder jenes Ritual und Opfer die feindlichen Mächte wohlgesonnen gestimmt werden könnten. Indem das alltäglich erfahrene Ausgeliefertsein ausgesprochen und nach Ursache und Wirkung gegliedert wurde, verwandelte sich das natürlich Chaotische in etwas geistig Geordnetes. Nur das so geordnete Chaos erlaubte die Vorstellung von Hebeln, die die Chance eröffneten, die Bedrohung abzuwenden. Erzählungen, die solche Hebel anbieten, werden bis heute gern geglaubt und angenommen.
So sehr diese Hebel auch „Placebo“-Charakter haben – mit ihnen stellt sich der Mensch den Naturgewalten entgegen, er begehrt auf. In den alten jüdischen Erzählungen wird dies teilweise sehr deutlich, wo besondere Männer – „Propheten“ – ihrem Gott widersprechen oder von ihm ultimativ Wunder einfordern.
Das phantastische Gehirn
Aus der neurobiologischen Forschung ist die faszinierende und beinahe zwanghaft sinnstiftende Arbeit des Geistes bekannt. Die Komplexität des Gehirns bringt es mit sich, das der homo sapiens sich abstrakt über Gefahren Gedanken machen kann und Vorsorge trifft. Diese Vorsorge kann praktisch sein – oder rein geistig: Der Mensch legt Vorräte an und schafft sich einen „Vorrat“ guter Werke für das ewige Leben. Überall wo es um unerträgliche Beunruhigungen geht, die praktisch nicht zu bewältigen sind, versucht der Geist durch eine Sinn-Konstruktion, die Ängste zu bannen. Der Geist verringert so die unerträglichen Beunruhigungen, die von nicht beherrschbaren Gefahren ausgehen.
Selbst der Hund, das fiel schon Charles Darwin auf, bellt einen sich bewegenden Schatten an wie einen Fremden. Lieber hundert Mal einen Schatten verbellen als einmal einen bösen feindlichen Akteur übersehen, weil man ihn für einen Schatten hält, sagen Evolutionsbiologen. Auch wenn die Skeptiker und die mythologischen Agnostiker Recht haben sollten – evolutionsgeschichtlich erfolgreicher waren immer die, die an Mythen glauben. Die religiösen Vergemeinschaftungen setzen sich als Sozialformen durch, weil sie verbindlichere Vertrauens- und Kooperationsstrukturen ermöglichen. Völlig selbstlos kämpft man nur für die eigene Familie und für den Gott, der mit dem Einzug in den Himmel winkt. Personalisierte mythologisierte Akteure können Menschen weit erfolgreicher als abstrakte Prinzipien oder willkürliche Gesetze dazu motivieren, sich einem Gruppenwillen anzuschließen, gemeinschaftsfördernde Leidenschaften zu entwickelt oder Konflikte zu reduzieren („Nächstenliebe“). Der Glaube, dass es einen kontrollierenden Beobachter gibt, der alles sieht, fördert ungemein das Verhalten im Sinne der kollektiven Moral-Vorgaben. Im Zentrum religiöser Aufmerksamkeit stehen in großer Regelmäßigkeit Sexualvorschriften, die die soziale Kontrolle der Fruchtbarkeit und die erfolgreiche Aufzucht der Kinder („Treue“) fördern. Auch deshalb sind religiös begründete Vergemeinschaftungen evolutionär erfolgreicher. Die mythologischen Erzählungen binden die sozialen Vorschriften und ethischen Normen in Geschichten von den transzendenten Akteuren ein, die in religiösen Ritualen praktiziert und weitergegeben werden können und gleichzeitig Antworten geben auf alle möglichen philosophischen Fragen.
Menschliches Bewusstsein ist in seinem Ursprung und Urgrund ein gemeinschaftliches Bewusstsein. Es versorgt die Gruppe mit gemeinsamen Sichtweisen und Erzählungen. Nur als gemeinschaftliche handelnde Gruppe waren die Horden der frühen Menschen ihren Fressfeinden überlegen. Die alten Mythen sind Familien-Erzählungen und Stammes-Erzählungen, es gab kein menschliches Ich-Bewusstsein, das sich dem Kollektivbewusstsein hätte entgegenstellen oder entziehen können. Die Akteure in diesen Mythen waren übernatürliche Kräfte, Geister, Götter. Das war das goldene Zeitalter, in dem die Menschen mit den Geistern rechneten, um sie zu besänftigen, und mit den Göttern redeten. Die Götter wohnten in den von den Menschen gebauten Tempeln, nicht in einem fernen „Himmel“. Sie konnten mit den Göttern einen Umgang „auf Augenhöhe“ pflegen. Daran erinnern auch die griechischen Mythen. Da gab es reichlich Schnittstellen zwischen der Sphären des Göttlich-Heiligen und des profanen Menschlichen. So gelang es Sisyphos, den Herrscher des Unterwelt zu überlisten: Er bekam von seiner Frau keine Totenopfer bereitgestellt und so bat er Hades darum, noch einmal einen Tag in die Menschenwelt zurückkehren zu dürfen, um seiner Frau zu befehlen, für ihn die Totenopfer zu bringen. Aber zurück in seinem Haus genoss der Sisyphos das Leben an der Seite seiner Frau und spottete über den Gott der Unterwelt.Nicht lange, wie wir wissen.
Die heiligen Rituale der sozialen Ordnung
Die Fähigkeit, mit phantastischen Konstruktionen kulturelle Muster für die Entfaltung seines gemeinschaftlichen Lebens zu bilden, hat den homo sapiens bei der Bewältigung seines Alltags erfolgreich gemacht.
Nicht zufällig haben die großen Religionsstifter Regeln für das gemeinschaftliche Zusammenleben festgelegt und sich manchmal um banale Dinge gekümmert. „Du sollst nicht stehlen“ ist so ein göttliches Gebot. Ein menschliches Gesetz würde nicht reichen, weil es den Ausweg offen lassen würde: „Lass dich jedenfalls nicht erwischen.“ Aber Gott sieht alles. Der Gott Mohammeds diktierte sogar, wie die Menschen ihre Geldgeschäfte durch Zeugenschaft absichern sollen: Zwei männliche Zeugen sollten dabei sein. „Und wenn es keine zwei Männer gibt, dann ein Mann und zwei Frauen von denen, die euch als Zeugen geeignet erscheinen“, so steht es in Sure 2 Vers 282 und wirft heute Fragen der Gleichberechtigung auf. So kümmert Allah sich um alle wichtigen Probleme, könnte man spotten. Aber die Zuschreibung zum Bereich des Heiligen erhebt die Regel über jegliche Diskussion. Polyandrie hat dieser Gott streng verboten, Polygamie geregelt. Keine Diskussion. Der Schutz des Eigentums ist seit der Entstehung der sesshaften Agrargesellschaft eine Angelegenheit des Göttlichen. Die Rituale der Wildbeuter-Gesellschaften mussten nur die Verfügung über die Frauen regeln und die Verteilung der Jagd-Beute.
Es gibt keine Macht ohne öffentliche Inszenierung, keine soziale Ordnung ohne spirituell inspirierte Rituale. Die Rituale des gesellschaftlichen Zusammenhaltes erhalten ihre Verbindlichkeit durch spirituelle Zeremonien. Wie schafft es eine Gemeinschaft, einen Menschen, den manche aus dem gewöhnlichen Alltag kennen, von einem Tag auf den anderen als Priester oder Herrscher zu akzeptieren und die Erfahrung „der Prophet gilt nichts in seinem Heimatdorf“ zu überwinden? Das profane Überziehen eines besonderen Kleidungsstückes, verbunden mit einer spirituellen Zeremonie schafft diese Verwandlung - ein penibel festgelegtes Ritual, das nicht ohne entscheidende Anleihen aus der Schatzkammer der Götter auskommt. Kein Schwur gilt ohne das rituelle Erheben der Hand.
Rituale sagen nicht nur etwas aus, sie tun auch etwas: Sie machen den einen zum König, dem anderen zum Doktor; sie stiften Ehen und Frieden; mit Ritualen werden Menschen aus ihrer Gruppe ausgeschlossen und in eine fremde, neue Gruppe aufgenommen. Rituale können Brüche heilen und symbolisch Dauer herstellen – gegebenenfalls mit rituellen Konsensfassaden. Und man kann manches Ritual umgekehrt ablaufen lassen – die symbolische Umkehrung macht die Wirkung des ursprünglichen Rituals ungeschehen.
Die symbolischen Elemente der Zeremonie sind Zeichen, die die Mitglieder einer Kultur kennen wie die gemeinsame Sprache. Wichtige symbolische Codes sind der Kuss, der Schwur, die Verneigung vor einem, der höher thront, oder das auf die Knie gehen. In vormodernen Zeiten war die Salbung ein wichtiger symbolischer Akt, das Hand-Auflegen wird heute noch praktiziert. Die Handauflegung symbolisiert Geist-Übertragung, bei der christlichen Bischofsweihe wird das aufgeschlagene Evangelienbuchüber dem Kopf gehalten oderauf denNackengelegt.
Das Ritual als gelebte Gemeinschaftspraxis macht mythischen Erzählungen sinnlich erfahrbar. Die Rituale haben Bestandteile des Erlebens, Zuhörens, und der eigenen Körperpraxis, der Verneigung, des Wechselgesangs mit den „Priestern“ oder profanen Machthabern. In Ritualen tradiert sich das Ordnungsgefüge der Macht und sie vermitteln den rituellen Subjekten das Gefühl von Geborgenheit und Vertrautheit. Das Ritual vermittelt den teilnehmenden Menschen eine bekannte Erfahrung und bestätigt bekanntes Wissen in bekannten Formen. Das Ergebnis des Rituals steht vorab fest. Je mehr das Ritual existentielle Fragen thematisiert - Unwetter, Krankheit und Tod - umso mehr schafft es das Gefühl existentieller Sicherheit. Das leistet der Ruf „Allahu Akbar“ – Gott ist groß - in Kombination mit einer demütigen Verbeugung. Das leistet genauso das rituelle „Vater unser“, in dem auf das demütige „Dein Wille geschehe“ sofort die Bringschuld formuliert wird: „Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld.“ Der Christ braucht seinen Gott für beides gleichermaßen.
Ordnung ist in der Regel Ordnung von Ungleichheit. Die Ungleich-Ordnung, die die Rituale erzeugen und bestätigen, wird durch das Ritual als eine Heilige Ordnung verstanden und inszeniert, „von Gott gewollt“. Nach dem Ritual wird oft mit einem gemeinsamen Mahl gefeiert, zum Beispiel mit dem „Leichenschmaus“.
Die Krone ihrer Schöpfungen sind die Mythen
Der Mensch begreift sich als „Krone der Schöpfung“ dank seines einzigartigen Verstandes, der sich in einem großen Gehirn entwickeln konnte. Aber warum vergrößerte sich das Gehirnvolumen unserer Vorfahren so außergewöhnlich? Darüber können die Anthropologen nur spekulieren. Die Schädelknochen, die gefunden wurden, geben Auskunft über die Masse des Gehirns, aber die weiche graue Masse ist nirgends erhalten. War es ein schlichter Zufall, eine Mutation bei Gen „ARGHAP11B“ vor rund 500.000 Jahren? Der Urmensch war ein schlechter Jäger, deswegen musste er sich in größeren Gruppen zusammentun - vielleicht ist die frühe Kultur als Kunst des Zusammenlebens entstanden. Die Entwicklung von Werkzeugen war jedenfalls ein späterer Nebeneffekt der wachsenden Möglichkeiten, sich des Verstandes zu bedienen.
So groß die offenen Fragen sind bei der Erklärung der Ursachen der Gehirnvergrößerung, so klar ist, was der Mensch mit seinem wachsendenden Verstand vor allem und zuerst gemacht hat: Er hat angefangen, wundersame Geschichten zu erzählen. Als hätte es nichts Wichtigeres gegeben! Aber solche Geschichten, „Erzählungen“, wie der Kulturwissenschaftler Albrecht Koschorke sagt, sind entscheidend für den Zusammenhalt größerer Horden. Was unsere Vorfahren in der Steinzeit sich erzählt haben, wissen wir nicht, wir haben nur symbolische steinerne Zeugen ihrer Phantasie, Löwenmenschen, Schlangenwesen. Erhalten haben sich Schmuckstücke und Knochenflöten. So müssen die Ethnologen sich von ihren Kenntnissen der Aborigines-Kulturen in Australien, der Maori in Neuseeland oder der indigene Kulturen Südamerikas leiten lassen, wenn sie Rückschlüsse auf frühe Stadien der Kulturentwicklung des Menschen ziehen.
Die archaischen Schnitz-Bilder wurden behandelt wie göttliche Zeitgenossen. Der ein Götterbild betrachtende Mensch ließ sich von dessen Wahrheit anrühren. Durch das körperliche Berühren einer Bildstatue verband sich der Leib des Betrachters mit der magischen Kraft des Dargestellten. Das Symbol war Teil des Symbolisierten. Die handwerkliche Kunst dieser Jäger und Sammler versinnbildlichte die Schöpfungen ihrer Phantasie und diente dazu, die tiefere Wahrheit der Imaginationen visuell erfahrbar zu machen. Der steinzeitliche Löwe war der gefährlichste Gegner des steinzeitlichen Menschen, die Schnitzfigur diente vermutlich dazu, seine Kraft zu bannen.Wenn es ein Götterbild war, dann hatte der Gott Menschengestalt und die Kraft des Löwen. In der Steinzeit-Kultur wurden auch andere Tiere, in den trockenen Wüsten Mesopotamiens oft die gefährlichen Schlangen, als Fabelwesen ausphantasiert.
Die Evolution des Ist-Bewusstseins
Fasziniert stehen die Anthropologen vor den Zeugnissen der frühesten menschlichen Totem-Kulturen, in denen Sippen sich mit Tier-Symbolen identifizierten und den Tieren magische Kräfte zusprachen. Die Tiere waren Symbole für das Kollektiv-Bewusstsein der Sippe. Es gab kein „Ich”, sondern nur ein „Wir“. Irgendwann begannen die Menschen, sich als Herrscher über die Tiere zu begreifen, und es tauchten menschenähnliche Gestalten zwischen den Tier-Fetischen auf: Die Imagination der Menschen schuf „Götter“ nach ihrem Bilde. Das waren Götter, die unter den Menschen lebten und mit denen die Herrscher auf Augenhöhe reden konnten.
Die ersten Schriftzeugnisse der Religionen erzählen dann von einer dritten Phase im Selbstverständnis des Homo sapiens, von der Vertreibung der Menschen aus diesem Paradies: Die Götter wohnten fortan nicht mehr in den von den Menschen gebauten Tempeln, sondern im Himmel. Das Selbst-Bewusstsein der Menschen differenzierte sich, sie waren Verstoßene und konnten sich durch die Brille der Götter als „frei” sehen - frei zur Sünde und zu Schuldgefühlen.
Das sind die ersten Zeichen dafür, wie in der Evolution des Geistes die Ahnung eines individuellen Ich-Bewusstseins entstanden ist. Diese Evolution des Geistes war gebunden an die Schriftkultur und die Sprache der Schriftkultur. Lange war es eine Kultur kleiner Eliten.
Das Modell der Tiernachahmung übertrugen die archaischen Menschen insbesondere auf Sonne und Mond. Die Veränderung der Gestalt des Mondes, die Farben bei Sonnenauf- und Untergang, die Einhüllung der Sonne durch Regenwolken oder das „Untertauchen“ der Gestirne und ihr Aufstieg auf der anderen Seite waren völlig unerklärlich. Was war das, was am Tag leuchtete und Wärme spendete, was schaute nachts in dieser und dann wieder in einer anderen Gestalt auf die Menschen herunter? Das waren Phänomene, die man nicht berühren oder befühlen und also nicht „begreifen“ konnte. Die Phänomene müssen als unheimlich und bedrohlich, geheimnisvoll und unfassbar gewirkt haben. Möglicherweise hat die Sichel-Form des Mondes die Menschen dazu bewegt, hier eine Analogie zu den Hörnern eines Tieres zu sehen. Zu den „lunaren“ Tieren des Totemismus gehören jedenfalls das Rind (Kuh oder Stier), aber auch Widder, Ziegen, Hirsche, Antilopen oder Rentiere. Mit den „Waffen“ dieser Tieren konnte eine Ähnlichkeit zum Bild des Mondes hergestellt werde. Diese Ähnlichkeit bildete die mentale Brücke.
Denn das mit den Fern-Sinnen Wahrgenommene mußte in Verbindung gebracht werden zu Objekten des „Mesokosmos“, mit greifbaren und somit begreifbaren Objekten. Dinge und Erscheinungen, die sich den erkennenden Tastversuchen entzogen, blieben unheimlich, solange sie nicht durch Analogien mental „gebannt“ werden konnten. Ähnlichkeit war so für das archaische Denken das Mittel, um das Unbekannte durch Bekanntes zu erklären. Die Totem-Kulte waren Versuche, die Welt zu ordnen und Orientierung in einer mental geordneten Welt zu ermöglichen.
Schöpfungsmythen der „Traumzeit”
Archaische Mythen müssen normalerweise aus ihren späteren Verschriftlichungs-Formen rekonstruiert werden. Die, die sie aufgeschrieben haben, waren versucht, den Mythen ihre Formen von Logik aufzudrücken. Anders die Traumzeit-Geschichte der australischen Aborigines, die bis ins 19. Jahrhundert mündlich tradiert wurde und so von den Forschern direkt aus ihrer „oralen“ Form in die europäische Kolonial-Schriftsprache übersetzt und fixiert werden konnte. Die Geschichte handelt von „Altjiranga Ngambakala“, was soviel wie „aus der eigenen Ewigkeit entstanden“ bedeutet. Die Ekstase ermöglicht es, in diese „Traumzeit“ einzutauchen, also in die Zeit, für die die Bibel die Erde als „wüst und leer“ beschreibt, bevor Schöpfung und Sündenfall in die Welt kamen. Der australische Mythos erzählt die Schöpfungsgeschichte als Begründung für einen archaischen Schlangenkult: Die gefürchtete große Schlange ist in Wirklichkeit die Mutter allen Lebens:
„Während der Traumzeit lag die ganze Erde in tiefem Schlummer. Auf ihrer Oberfläche wuchs nichts, und nichts bewegte sich auf ihr, und über allem lag eine große Stille. Die Tiere, auch die Vögel, schliefen noch unter der Erdkruste. Doch eines Tages erwachte die Regenbogenschlange aus diesem großen Schlaf. Sie drängte sich mit Macht durch die Erde nach oben, und an der Stelle, an der ihr gewaltiger Körper die Erdkruste durchstieß, schob er die Felsen zur Seite. Dann begann die Große Schlange mit ihrer Wanderung. Sie zog in allen Richtungen über das Land, und während sie wanderte, hinterließ sie ihre Spuren auf der Erde, denn ihr Körper formte die Landschaft an vielen Orten. [...] Nun erwachten alle Tiere, kamen ans Licht und folgten der Regenbogenschlange, der Großen Mutter allen Lebens, durch das ganze Land. [...] Nun erließ die Große Schlange Gesetze, die für alle Wesen Gültigkeit hatten [...]. Manche Wesen gehorchten aber nicht, sondern stifteten Unruhe und stritten untereinander. Da wurde die Mutter allen Lebens zornig [...]. Die Frevler wurden also in Stein verwandelt, sie wurden zu Felsen, Hügeln und Bergen. [...] Dann verwandelte die Große Schlange diejenigen, die sich an die Gesetze hielten, in Menschen.“
Alles kann sich da in alles verwandeln, diese Erzählung macht plausibel, dass alles mit allem zusammenhängt und zwar in einer Weise, die in jeder Phase der Geschichte überraschend ist und keine Muster erkennen lässt. In solchen Mythen und ihren Symbolisierungen artikuliert sich noch Ganzheit in ihrer sinnlichen Fülle.
Die mythischen Schöpfungen der frühen Menschen
Die Cassirer-Schülerin Susanne K. Langer nennt diese unteilbaren Bilder „präsentative Symbole“: Sie sind Bilder für menschliche Empfindungen, die der Sprache und der logischen Zergliederung unzugänglich sind. Am Beginn der Sprach-Entwicklung ergänzten die frühen Menschen ihre Zeige-Gesten mit Rufen und Wort-Lauten, um auf etwas in ihrer Umwelt aufmerksam zu machen oder auf etwas hinzudeuten – die Kommunikation war auf sinnliches Wahrnehmen angewiesen. Wie dieses mythische Denken tickt, lässt sich aus der Warte des logisch-diskursiven Denkens meist nur als Defizit beschreiben. Mythisches Empfinden unterwirft sich nicht der Rationalität. Mythisches Denken bindet sich an kein logisches Gesetz der Identität. Gegenstände können sich verwandeln, werden vom Frosch zum König, wechseln bei Bedarf ihre Eigenschaften, sie schweben frei im Raum und in der Zeit, haben ihre Gegenwart in verschiedenen Räumen und Zeiten. Sachen haben Geister, Träume und Wirklichkeit können verschwimmen so wie die Geburt als Wiederkehr und der Tod als Fortdauer erscheinen kann, die Sphäre der Lebenden ist nicht getrennt von der des Todes. Diese gemeinsame Welt ist durchsetzt von Dämonen, die gut oder böse wirken, schutzbereit oder arglistig, mal so, mal so. Die Kräfte der Natur begreift der Mythos als dämonische Willensäußerungen, und der mythisch denkende Mensch kann sich mit dämonischen Kräften „verbünden“, um Macht über die Wirklichkeit herbeiphantasieren. Diese Verbindung entsteht durch reinen Willensakt oder vermittelt durch Rituale und Zeichen. Der Mythos entspringt nicht nur dem Bedürfnis, die erlebte Macht als sinnvoll zu erklären, sondern auch dem Wunsch nach Macht: Das „Opfer" ist der Hebel, um auf das Schicksal Einfluss zu nehmen. Alles steht in Beziehung zu allem, eben auch eine Sache mit ihrem Zeichen und wer das Bild schlägt, schlägt das Abgebildete. Darauf beruht der „Analogiezauber“. Im mythischen Denken verschmelzen „Ich“ und „Welt“ zu einem gefühlt Gemeinsamen. Die Gemeinschaft ist in den heiligen Zeremonien zugleich am eigenen Leib sinnlich spürbar und mental repräsentiert.
Die frühen Höhlenmalereien sind in diesem Sinne nicht Abbilder, sie wollten nicht „realistisch“ sein und profane Tierzeichnungen darstellen. Sie machten Traumgestalten zu Realgestalten und sie erlaubten es, wilde Tiere, die nicht präsent waren, mit Hilfe von „Zeigegesten“ zu Wirklichkeit werden zu lassen. Artefakte machten für diese Menschen das Abgebildete präsent, Figurinen und Idole machten das Erinnerte gegenwärtig. Dieser Geisteszustand spiegelt sich noch in der alttestamentarischen Erzählung, nach der der allmächtige Schöpfer-Gott - eifersüchtig wie alle Menschen - die handwerkliche „Schöpfung“ eines Lebewesen-Abbildes als Herausforderung seiner Allmacht betrachtete und daher untersagt wissen wollte.
Der französische Ethnologe Claude Levi-Strauss hat die archaischen Fähigkeiten des menschlichen Geistes bei den indigenen Stämmen des Amazonas wiedergefunden und, weil es uns so fremd ist, als „wildes Denken“ und „bricolage“ beschrieben, als Bastel-Denken. Das „wilde Denken“ ist ein Gemeinschaft verbindendes Denken, es erfasst die Lebenswelt und sucht in den Naturdingen interpretierende Botschaften, die es mit Strukturelementen der sozialen Lebenswelt verknüpft. So entsteht ein Denk-System, dass über Mythen und Riten die Katastrophen des Lebens - Kriege, Seuchen, Überschwemmungen, Geburt und den Tod – in ein Geschehen einordnet, in denen es personifizierte Täter gibt. Mit diesen Gedankenbildern kann man Katastrophen so behandeln wie Clan-Konflikte - man kann Frieden stiften durch Gaben oder Opfer und ihnen damit den Schrecken nehmen, sie wenigstens geistig normalisieren. Dieses eigentlich gar nicht „wilde“ Denken durchtränkt die greif-bare Wirklichkeit mit einer geistigen, virtuell-mythischen Welt.
Der homo sapiens scheint von seinem besonderen Verstand getrieben, seine Welt so zu begreifen, wie er handelnde Personen erfahren hat.
Als die Götter noch unter uns waren
Wie tickten die Menschen, bevor sie aus dem Paradies vertrieben wurden, als sie unter den Göttern lebten und ihren Stimmen ohne distanzierendes, reflexives Selbstbewusstsein gehorchten? Jaynes sucht danach in den ältesten Schrift-Zeugnissen der menschlichen Kultur. Er fragt: „Welche ‚Mentalität’ – welches Stadium der Psychoevolution – zeigt sich in den frühesten Schriftdokumenten der Menschheit?“ Da die Hieroglyphen kaum mit der dafür erforderlichen Sensibilität in ihrer Bedeutung für die ägyptischen Zeitgenossen entzifferbar sind, befragt er die alten hebräischen Dokumente, in denen manche der älteren Traditionen durchscheinen, und die homerischen Gesänge, die als „Ilias“ um 1000 v.u.Z. tradiert und schließlich aufgeschrieben wurden. Die Worte und Begriffe, die in der klassischen Übersetzung für Bewusstsein und einzelne Aspekte des Mentalen stehen, haben in der Ilias eine andere Bedeutung, sie beziehen sich auf Aspekte der leiblichen Dingwelt. „Psyche“ steht für Lebenssubstanzen, die wir als Blut und den Atem benennen. Thymos bedeutet Bewegung. ‚Der thymos verlässt die Glieder’ bedeutet, der Mensch bewegt sich nicht mehr. Auch die tobende See hat thymos. Das Wort soma, das später Körper bedeutet und einen Kontrapunkt zur Seele (psyche) bildet, steht bei Homer im Plural für die toten Gliedmaßen, den Leichnam. Die Helden der Ilias kennen keinen „Willen“, sie entscheiden nicht – sie hören auf die Stimmen der Götter. Wo wir subjektive Empfindungen unterstellen würden, wirken in der Ilias die Götter. „Die Menschen der ‚Ilias’ kannten keine Subjektivität wie wir“, fasst Jaynes zusammen. Noos, das Wort, das später (als nous) „Geist“ bedeutet, steht in der Ilias für „wahrnehmen“, „wiedererkennen“. Die Erklärung für Affekte und Handlungsimpulse werden externalisiert, projiziert. Für eine Beschreibung von inneren Empfindungen gab es noch keine Sprache.
„Eine Göttin flößt mit ihrem Geflüster das süße Verlangen nach der alten Heimat ins Herz der Helena…, stets ist es ein Gott, der die Heere in die Schlacht führt“, bemerkt Jaynes: „Die Götter spielen die Rolle des Bewusstseins.“ Der große Achill erklärt gegen Ende des trojanischen Krieges: „Nicht ich habe die Handlung verursacht, sondern Zeus … Es tut ja alles die Göttin ...“ Sogar die Dichtung ist Gesang der Göttin, den der Rezitator vernommen hat.
Diese alten Götter redeten mit den Menschen „von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet“ (2. Mose 33, 11), so hallen diese mythischen Erzählungen noch als wehmütige Erinnerung nach in den Schriften des „Tanach“ nach, ein Korpus aus alten überlieferten und neuen Texten, mit dem die jüdischen Priester vor gut 2600 Jahren ihre Tradition fixieren wollten.
Und noch der babylonische Herrscher Hammurabi redete mit seinem Gott Marduk von Angesicht zu Angesicht – davon gibt es auf der Stele des Codex Hammurabi ein Reliefbild, das beide Männer - in ähnlicher Pose sich gegenüberstehend - zeigt. Die Menschen kamen zu der babylonischen Stele „zu hören meine Worte“, wie es am Fuß der Stele heißt. Noch mit der Schrift sprach der Herrscher zu den Menschen, das war schon der Übergang zu den großen Religionen der „Achsenzeit”.
Diese Götter sind Bestandteile des menschlichen Bewusstseins. Sie treten nicht in großer Distanz unter Blitz- und Donner-Begleitung auf, nicht umrahmt von schreck-lichen Naturgewalten, sondern wie Menschen. Die Menschen halluzinieren und verbalisieren ihre Halluzinationen als Götter. Der amerikanische Psychologe Julian Jaynes kennt dieses Phänomen aus der Praxis als Gehörs-Halluzinationen und Gesichts-Halluzinationen. In der Psychologie werden solche Halluzinationen als Krankheitsbild klassifiziert, Künstlerpersönlichkeiten wieRobert Schumann litten darunter. Jaynes vermutet, dass sie in der Jungsteinzeit „normale“ Begleiterscheinungen der Anstrengungen des Hörverstehens und der Rechtfertigung des eigenen Handelns waren. Bewertungen, Entscheidungen, Antriebe oder moralische Skrupel wurden auf die Stimmen der Götter, bezogen, nicht als „eigene” Entscheidungen auf ein „Selbst“, eine „Seele“, ein „Ich“.
In den überlieferten Texten aus dem alten Mesopotamien sind es die Worte der Götter, die darüber entscheiden, was zu tun ist. Auf einem Kegel aus Lagas liest man: „Mesilin, König von Kiš, errichtete auf Geheiß seiner Gottheit Kadi, betreffend die Bepflanzung jenes Feldes, eine Stele an jenem Ort. Uš, Patesi von Umma, um sich ihrer zu bemächtigen, fertigte Zauberformeln an; jene Stele zerbrach er in Trümmer; in die Ebene von Lagaš rückte er vor. Ningirsu, der Held des Enlil, auf dessen rechtmäßiges Geheiß führte Krieg gegen Umma. Auf das Geheiß des Enlil schnappte sein großes Netz zu. An jenem Ort auf der Ebene errichtete er ihren Grabhügel.“ (Zitate nach Jaynes)
Die Stimmen der Götter Kadi, Ningirsu und Enlil geben die Anweisungen, die Herrscher hören und nur weitergeben. Wie kann die Schrift einer Stele bei Nacht entziffert werden? „Die Glätte ihrer Oberfläche gibt ihm sein Hören kund; die eingemeißelte Schrift gibt ihm sein Hören kund; das Licht der Fackel hilft ihm besser hören.“ Hören! Lesen der Keilschrift wurde wahrgenommen als Hören. Das Halbrelief zeigt Hammurabi und Marduk, wie sie sich auf Augenhöhe anblicken, es gibt kein Zeichen von Demut angesichts des Gottes. Was Marduk diktiert, ist der Wille Hammurabis, oder anders gesagt: Was Hammurabi will, ist der Wille des Gottes (Marduk/Šamaš).
In der Keilschriftliteratur finden sich immer wieder sprechende Götter. Die sprechenden Götter wurden rituell gepflegt mit Mundwaschungen. Auf den sumerischen Keilschrift-Tafeln sind für die Gottheiten sehr ausführlich komplizierte Zeremonien der Mundwaschung vorgeschrieben, mit denen die Redegabe der Götter erneuert werden sollte. „Beim Licht tropfender Fackeln trug man den Gott mit seinem Intarsiengesicht aus Juwelen zum Flußufer, und dort wurde ihm unter Zeremonien und Beschwörungen mehrmals der Mund ausgewaschen, wobei das Gesicht nacheinander gen Osten, Westen, Norden und schließlich gen Süden gewandt war. Das benutzte Weihwasser war ein Sud von vielerlei Zutaten: Tamariskenrinde, verschiedene Gräser, Schwefel, verschiedene Gummis, Salze und Öle, dazu Dattelhonig sowie verschiedene kostbare Steine. Nach weiteren Beschwörungen wurde der Gott ‚an der Hand’ zurück auf die Straße ‚geleitet’, wobei der Priester ein litaneiartiges ‚Fuß, der vorwärtsschreitet – Fuß, der vorwärtsschreitet ...’ intonierte. Am Tempeltor wurde dann nochmals eine Zeremonie abgehalten. Darauf nahm der Priester den Gott ‚bei der Hand’ und geleitete ihn zu seinem Thron in der Nische, wo ein goldener Baldachin aufgeschlagen war und der Mund der Statue abermals ausgewaschen wurde.“ (zitiert nach Jaynes)
Auch im alten Ägypten galten die Hieroglyphen generell als „Schrift der Götter“. Das Horusauge, auch Udjat-Auge genannt, ist das altägyptische Sinnbild des Lichtgottes Horus. Dem entsprechenden Hieroglyphen-Zeichen wurde magische Bedeutung zugeschrieben. Als Amulett getragen schützt es bis heute gegen den „bösen Blick“, es bringt Kraft und Fruchtbarkeit.
Osiris war die halluzinierte Stimme eines verstorbenen Königs, dessen Belehrungen noch immer etwas galten und der weiterhin die Überflutungen des Nils kontrollierte. So machte es Sinn, den Körper einzubalsamieren und mit Speis und Trank, mit Sklaven und Frauen auszustatten. Horus als der Sohn des Osiris ist gleichzeitig seine wesensgleiche „Verkörperung“, weil in ihm die halluzinierte Stimme des Königs fortlebt. Auch in den alten ägyptischen Vorstellungswelten sind die Herrscher gottgleich und die Götter menschengleich.
Das Verschwinden der Götter in den Himmel
Und dann gibt es einen um das Jahr 1230 errichteten Steinaltar, der den Tyrannen von Assyrien, Tukulti-Ninurta I., abbildet. Wie in einem Schulbuch wird da das neue Götterbild erklärt: Der Tyrann steht, stolz und aufrecht, aber er ist ein zweites Mal abgebildet, kniend. Er geht auf die Knie - wovor? Nicht vor seinem Gott, sondern vor dessen leeren Thron. Der Gott ist abwesend, der Mensch wird demütig. „In der ganzen vorherigen Geschichte wird kein König jemals kniend dargestellt. In der ganzen vorherigen Geschichte gibt es keine bildliche Darstellung, die auf einen abwesenden Gott hindeutet“, konstatiert Jaynes. Alle Abbildungen Hammurabis zeigen einen aufrecht dem Gott gegenüberstehenden und lauschenden König, die früheren Rollsiegel zeigen den irdischen Herrscher von Angesicht zu Angesicht mit einem menschengestaltigen Gott. Auf den Rollsiegeln der neuen Zeit wird die Gottheit durch ein Symbol vertreten.
Aus der Zeit des Ninurta-Steinaltars ist das babylonisches Gedicht „Ludlul bel nemeqi“ (Ich will preisen den Herrn der Fertigkeiten) überliefert, dass eine Gottesverzweiflung ausdrückt, wie sie später in den Psalmen des Alten Testaments immer wieder auftaucht. Da heißt es:„Mein Gott hat mich verlassen und entschwand, Meine Göttin hat mich im Stich gelassen und hält sich fern. Der gute Engel, der mir zur Seite schritt, ist auf und davon.“ Auch Gebete und Opfer haben nicht geholfen. Erst im Tempel des Marduk, der seine „Verfehlungen im Wind zerstreute“, wird ihm Hilfe zuteil – er wird gesund.
Auch wenn die alten Götter mit Sonne, Mond und Sternen assoziiert worden waren - sie hatten auf Erden gemeinsam unter den Menschen „gewohnt“ und hatten im Tempel ihr Domizil, wo man sie pflegte und ernährte. Erst als die göttlichen Stimmen nicht mehr gehört wurden, wurde die Erde zum Tummelplatz von Engeln und Dämonen – die unsichtbaren, unnahbaren Götter wurden in der Sphäre der Wolken imaginiert. Nur die geflügelten Engel konnten Zugang zu ihnen haben.
Als im siebten Jahrhundert die Geschichte von der Großen Flut, von der später auch das Alte Testament als „Sintflut“ erzählt, in den Gilgamesch-Zyklus eingegliedert wurde, wurde damit der Wegzug der Götter von der Erde mit der Naturkatastrophe begründet: „Selbst die Götter wurden von Entsetzen ergriffen angesichts der Flut. Sie flüchteten sich hinauf in den Himmel des Anu.“
Der Wille der schweigenden Götter musste fortan indirekt ermittelt werden - über Omen-Texte, Losorakel oder über eine Augurienschau. Omentexte kombinieren zwei Erscheinungen, die assoziativ zusammen gedacht werden in der Art: „Wenn ein Mann unabsichtlich auf eine Eidechse tritt und sie tötet, dann wird er über seinen Gegner obsiegen.“ (Babylonisches Omen)Riesige Sammlungen solcher Sprüche wurden im ersten Jahrtausend zusammengetragen. Omen-Texte befassten sich mit den Unwägbarkeiten der Geburt. Die Medizin gründete in solchen Erfahrungen, welches Ereignis mit welchem Phänomen zusammentritt. Und die Astrologie: Der Stand der Gestirne bei der Geburt, interpretiert nach Mustern der Omen-Analogie, verrät bis heute das Schicksal des neuen Menschen. Träume wurden als göttliche Zeichen und Wahrsagungen verstanden, seit der spätassyrischen Periode werden sie in Traumbüchern gesammelt. Ähnlich füllt die Kultur der Los-Orakel den verwaisten Platz der göttlichen Stimmen. Aus der Praxis, den präsent gedachten Göttern Nahrungs-Opfer darzureichen, wurden die mehr und mehr symbolischen Opfer-Rituale für abwesende Götter.
Frühe Zeichen des menschlichen Selbst-Bewusstseins
Die großen Religionen der Achsenzeit erzählen von der Vertreibung der Menschen aus dem Paradies – der Mensch war „schuldig“ geworden, als er begann, ein individuelles Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Gleichzeitig zeigt sich in den Quellen ein subjektives Selbst-Bewusstsein der Herrscher. Jaynes zeigt dies mit einem Vergleich zwischen assyrischen und altbabylonischen Briefen. „Die Briefe Hammurabis sind tatsachenorientiert, konkret, behavioristisch, formelhaft, befehlshaberisch und grußlos.“ Die Schrift der Tontafeln wurde „gehört“ von ihren Adressaten, es sind Befehle des Herrschers. Zum Beispiel so:
„Zu Sinidinnam sprich: so spricht Hammurabi. Ich schrieb dir und hieß dich, den Enubi-Marduk zu mir zu schicken. Warum hast du ihn also nicht geschickt? Wenn du diese Tafel siehst, schicke den Enubi-Marduk vor mich. Sorge dafür, daß er Tag und Nacht unterwegs ist, damit er eilends eintrifft.“
Oder folgender Brief:
„Zu Sinidinnam sprich: so spricht Hammurabi. Ich schicke nun den Amtmann Zikirilisu und den Dugab-Amtmann Hammurabibani, die Göttinnen von Emutbalum zu holen. Laß die Göttinnen in einer Prozessionsbarke wie in einem Heiligtum nach Babylon reisen. Und das Tempelweib soll ihnen folgen. Zur Ernährung der Göttinnen wirst du Schafe bereitstellen (...). Sorge dafür, daß sie ohne Aufenthalt eilends in Babylon eintreffen.“
Der Brief unterstellt als selbstverständlich, dass die Götterstatuen auf ihrer Reise etwas zu sich nehmen wollen.
In den assyrischen Staatsbriefen des siebten Jahrhunderts, also rund 1.000 Jahre später, erscheint eine Welt von Empfindlichkeiten, Ängsten, Habgier, Widerborstigkeit und Bewusstheit. In dem Brief eines assyrischen Herrschers an seine ungebärdigen babylonisierten Statthalter im eroberten Babylonien aus der Zeit um 670 zeigt sich sogar Sarkasmus:
„Botschaft des Königs an die Pseudo-Babylonier. Ich bin wohlauf. (...) Ihr habt euch also – der Himmel helfe euch – in Babylonier verwandelt! Und fort und fort erhebt ihr gegen meine Diener Anschuldigungen – falsche Anschuldigungen –, die ihr euch zusammen mit eurem Meister ausgekocht habt. (...) Das Dokument, das ihr mir geschickt habt (nichts als zudringliches hohles Geschwätz!), sende ich euch neueingesiegelt wieder zurück. Jetzt werdet ihr natürlich sagen: »Was sendet er uns da zurück?« Von den Babyloniern schreiben mir meine Diener und Freunde: Wenn ich das Siegel erbreche und lese, o welche Wohlgeratenheit der Heiligtümer, Sündenvögel ...“
Diese Briefe zeigen beispielhaft eine neue Subjektivität, eine Veränderung der Mentalität.
Archäologie des Bewusstseins im Alten Testament