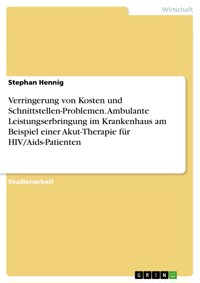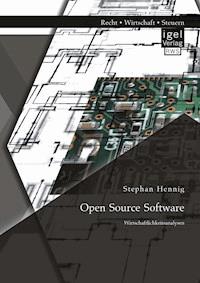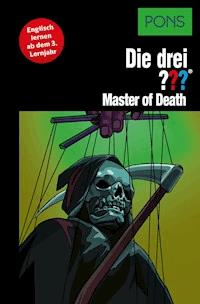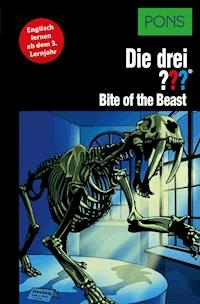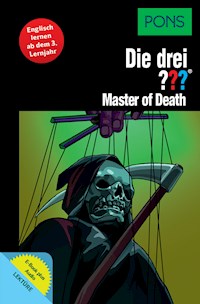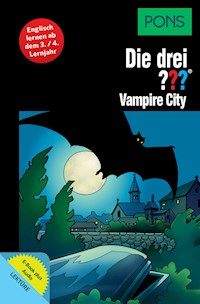Konzept zum selbstgesteuerten Lernen im Bildungsgang "Informationstechnische Assistenten FHR" durch den Einsatz der Lernplattform Moodle E-Book
Stephan Hennig
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Pädagogik - Berufsbildung, Weiterbildung, Note: 2,3, Studienseminar für Lehrämter an Schulen Arnsberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Konzept des selbstgesteuerten Lernens nimmt seit geraumer Zeit einen immer bedeutsameren Stellenwert in der pädagogischen Diskussion ein und findet in der beruflichen Bildung große Beachtung. Dies mag unter anderem damit zusammen hängen, dass sich sowohl die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft in einem permanenten, sich ständig beschleunigenden Strukturwandel befinden. Die Arbeitswelt verändert sich rapide und ist durch ständig neue Anforderungen an die Bewältigung offener Handlungsvollzüge und die Strukturierung von Arbeitsabläufen geprägt. Die Anforderungen an die beteiligten Fachkräfte steigen und verlangen ein wachsendes Maß an Selbststeuerung und Eigenverantwortung. Vom einzelnen Mitarbeiter wird dabei eine immer größere Bereitschaft erwartet, sich den veränderten Konstellationen der Arbeitswelt selbstständig und eigenverantwortlich zu stellen, an den Veränderungen mitzuwirken, stärker Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und sich selbstständig neues Wissen anzueignen, wenn dies erforderlich ist. Neben diesen Tendenzen in der Berufswelt können auch weitreichende Veränderungen in der Gesellschaft ausgemacht werden, die von einer Erhöhung der Mobilität, von schnellem und stetigem Wertewandel und Planungsunsicherheiten sowie von Veränderungen in der Familie, die in einer zunehmenden Individualisierung münden, geprägt sind. Zur erfolgreichen Gestaltung der eigenen Lebensführung sind in hohem Maße Fähigkeiten zur Selbstreflexivität und Selbstorganisation notwendig, die in den meisten Fällen von jungen Menschen erst noch erworben werden müssen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Page 4
Abbildungsverzeichnis
Page 1
1. Einleitung
Das Konzept des selbstgesteuerten Lernens nimmt seit geraumer Zeit einen immer bedeutsameren Stellenwert in der pädagogischen Diskussion ein und findet in der beruflichen Bildung große Beachtung.1Dies mag unter anderem damit zusammen hängen, dass sich sowohl die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft in einem permanenten, sich ständig beschleunigenden Strukturwandel befinden.2Die Arbeitswelt verändert sich rapide und ist durch ständig neue Anforderungen an die Bewältigung offener Handlungsvollzüge und die Strukturierung von Arbeitsabläufen geprägt. Die Anforderungen an die beteiligten Fachkräfte steigen und verlangen ein wachsendes Maß an Selbststeuerung und Eigenverantwortung. Vom einzelnen Mitarbeiter wird dabei eine immer größere Bereitschaft erwartet, sich den veränderten Konstellationen der Arbeitswelt selbstständig und eigenverantwortlich zu stellen, an den Veränderungen mitzuwirken, stärker Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und sich selbstständig neues Wissen anzueignen, wenn dies erforderlich ist.3Neben diesen Tendenzen in der Berufswelt können auch weitreichende Veränderungen in der Gesellschaft ausgemacht werden, die von einer Erhöhung der Mobilität, von schnellem und stetigem Wertewandel und Planungsunsicherheiten sowie von Veränderungen in der Familie, die in einer zunehmenden Individualisierung münden, geprägt sind. Zur erfolgreichen Gestaltung der eigenen Lebensführung sind in hohem Maße Fähigkeiten zur Selbstreflexivität und Selbstorganisation notwendig, die in den meisten Fällen von jungen Menschen erst noch erworben werden müssen.4Außerdem werden lerntheoretische Begründungen des selbstgesteuerten Lernens angeführt, indem auf die vorhandene Unterschiedlichkeit der Lernvoraussetzungen,fähigkeiten und -stile seitens der Schüler verwiesen wird. Diese Heterogenität macht individuelle Anregungen erforderlich, welche die Lernenden in die Lage versetzen, ihr Lernen selbst in die Hand zu nehmen. Hierzu muss zunächst eine hinreichende Lernkompetenz erworben werden, die es ermöglicht, gemäß dem vorliegenden Lerntyp geeignete Lernstrategien sowie Lern- und Arbeitstechniken anzuwenden. Lernen ist unter der konstruktivistischen Sichtweise ein aktiver und konstruierender Prozess. Der Lernende erwirbt Wissen i.d.R. nicht, indem er eine hundert prozentige Kopie des Wissenstransfers speichert. Vielmehr fügen sich viele einzelne Wissens-1vgl. LANG/ PÄTZOLD 2009
2vgl. BLK 2004, 5ff.; KMK 2001
3vgl. PÄTZOLD 2008
4vgl. KONRAD/ TRAUB 1999, S. 23