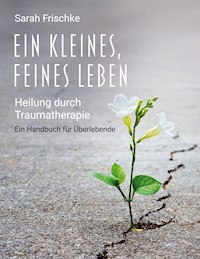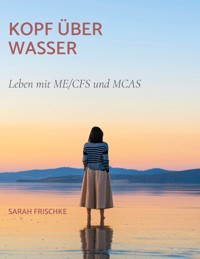
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dieses Handbuch richtet sich an Menschen, die an ME/CFS, MCAS, Long/ Post Covid oder dem Post Vacc-Syndrom erkrankt sind. Als Ratgeber hat es das Ziel, über die Erkrankungen aufzuklären und praktische Hilfestellung zu geben. Das Buch soll Menschen unabhängig von ihrem Einkommen eine Möglichkeit geben, sich ihr eigenes Brain Retraining-Programm und Pacing-Programm zusammenzustellen, um ihre Symptome zu lindern. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung von praktischen Tipps und Übungsvorschlägen. Hierfür greift die Autorin u.a. auf ihre eigenen Erfahrungen sowie ihr fundiertes Wissen zurück, über das sie dank ihrer langjährigen eigenen Therapie verfügt. Des Weiteren erläutert die Autorin einzelne Hilfsangebote sowie Therapie-Möglichkeiten aus dem schulmedizinschen und ganzheitlichen Bereich, bevor sie ihren eigenen Weg und ihren Umgang mit der Erkrankung schildert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gott,
gib mir
die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut,
Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vorbemerkungen
Hinweise zu diesem Buch
ME/CFS und Long Covid
Hauptsymptome
Diagnostik
Das Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS)
Mögliche Symptome
Diagnostik
Therapie
Wo finde ich Hilfe und Unterstützung?
Ambulanzen von Krankenhäusern
Privatärzte
Verbände, Vereine und Hilfsorganisationen
(
Online-)Selbsthilfegruppen
Medizinische Unterstützung vor Ort
Psychotherapie und Ergotherapie
Physiotherapie
Osteopathie
Pflege
Rechtsberatung
ME/CFS und Reha?
ME/CFS Genesungsprogramme
Blogs und Podcasts
Pacing
Herzfrequenzmesser/ Pulsuhr
Sauerstoffsättigung
Die Löffel-Methode (Spoon-Therapie)
Der kaputte Akku
Pausen
Die Pomodoro-Technik
Langsamkeit als Schlüssel
Die 30-Sekunden-Regel
Adrenalin vermeiden
Digital Detox: Verzicht auf Online-Medien
Schlafen
Weitere Vorsichtsmaßnahmen
Grundlagen für das Brain Retraining
Funktionen des menschlichen Gehirns
Das autonome Nervensystem
Die Neuroplastizität des Gehirns
Nervus Vagus-Therapien
Atemübungen
Weitere Nervus-Vagus-Übungen
Vagusnerv-Stimulatoren
Neuroathletik
Körper- und Entspannungsübungen
Vagusvit-Infusionen
DBT-Therapie: Skill-Orientierung
DBT
Verschiedene Skills
Notfall-Koffer und Notfall-Listen
Ressourcenorientierung
Was sind Ressourcen?
Übungen zur Ressourcenfindung
Schwierigkeiten und Lösungsansätze
Imaginationsübungen
Grundsätzliches
Geeignete Imaginationsübungen für zuhause
Imaginationsübungen für die Innenarbeit
Schwierigkeiten bei Imaginationsübungen
Meditationen
Geführte Meditationen
Freie Meditationen
Affirmationen und Visualisierungen
Funktionen von Affirmationen
Wie formuliere ich Affirmationen?
Grenzen der Affirmationen
Visualisierungen
Emotionale Selbstfürsorge
Grenzen setzen
Ein wohlwollendes Umfeld auf- und ausbauen
Muße tut der Seele gut
Mit der Natur verbunden
Spiritualität: Der Sinn im Leben
Ihr Charakter entscheidet über Ihre Bedürfnisse
Der Umgang mit belastenden Gefühlen
Grübelstopps
Trauer
Wut
Schuldgefühle
Suizidgedanken - Achtung: Trigger!!!
Ernährung und Darmgesundheit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Verbesserung der Verdauung
Leaky Gut und Dysbiose
Zahngesundheit
Mikronährstofftherapie
Weitere Therapiemöglichkeiten
Medikamentöse Offlabel-Therapien
Chronische Infektionen
Hormontherapie
Entgiftungsstörungen und Schadstoffbelastung
HPU-Therapie
Blutwäschen
Schimmelbelastung
Mitochondrientherapie
Coimbra-Protokoll
Nikotinpflaster-Therapie bei Long Covid
Low Dose Lithium
Schmerztherapien
Stellatum-Blockade
Ketamin-Infusionen
Instabile Halswirbelsäule
Meine Erfahrungen
Wie es anfing (2002 bis 2004)
Vor den Trümmern meiner Existenz (2007)
Mein Leben als EM-Renterin (2008 bis 2018)
Krise und Verwirrung (2019)
Die Suche nach Klarheit – eine Odyssee (2019 bis 23)
Mein heutiges Leben
Ist Heilung möglich?
Anhang
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Quellenverzeichnis
Einleitung
Vorbemerkungen
In den letzten vier Jahren beschäftigte ich mich aufgrund eigener Betroffenheit intensiv mit ME/CFS und MCAS sowie den unterschiedlichen Begleit- und Folgeerkrankungen. Die Diagnostik, die bei mir 19 Jahre zu spät kam, nahm einen sehr großen Platz ein. Obwohl ich bereits seit 2003 schwerkrank bin, wurden bei mir bis 2019 die meisten Symptome auf eine psychische Ursache geschoben. Daher war für mich vieles unbekannt und neu. Genauso neu waren dann auch viele (ganzheitliche) Behandlungsmethoden und Brain Retraining-Programme. Aber in Hinblick auf die Neuroplastizität des Gehirns traf ich alte Bekannte aus meiner Traumatherapie wieder. Egal, ob es sich um Nervus Vagus-, Atem- oder Imaginationsübungen drehte: Ich kannte bereits alles und konnte auf mein altes Wissen und damit auf einen großen Fundus an Übungen zurückgreifen.
Verwundert war ich jedoch darüber, wie teuer manche Online-Genesungsprogramme sind, die sich größtenteils auf das Brain Retraining konzentrieren. Selbst wenn diese kein Coaching-Angebot beinhalten, kosten sie im Jahr 2024 in der Regel zwischen 300,- bis 400,- EUR – obwohl viele Inhalte und Übungen im Internet sowie in Büchern sehr viel kostengünstiger zu bekommen sind. Zudem sind individuelle Therapien manchmal unabdingbar, da Standardrezepte aus den Online-Programme oft nicht greifen – oder im schlimmsten Fall sogar schädigen können. Hier tut Aufklärung Not, damit Betroffene die jeweiligen Angebote überprüfen und angemessen anwenden können.
Daher entschied ich mich, ein Buch für ME/CFS-, Long/ Post Covid- und MCAS-Betroffene zu schreiben. Ich will Menschen eine Möglichkeit geben, sich ihr eigenes Genesungs-Programm zusammenzustellen, um mit ähnlichen Voraussetzungen ihre Symptome lindern zu können. Gleichzeitig möchte ich über die Grenzen und Gefahren von einigen Online-Programmen aufklären. Mein Schwerpunkt liegt dabei auf der Vermittlung von praktischen Tipps und Übungsvorschlägen. Hierfür greife ich u.a. auf mein Wissen zurück, das ich dank meiner langjährigen Traumatherapie besitze. Die theoretische Grundlage bilden die aktuellen Kenntnisse in der Psychotraumatologie und dem Brain Retraining, welche ich durch eigene konkrete Erfahrungen ergänze.
Selbstverständlich ist mir dabei bewusst, dass das Brain Retraining nur ein Baustein bei der Behandlung sein kann. Großen Raum nimmt daher auch das Pacing ein. Die Notwendigkeit, die durch die Krankheit eng gesetzten Grenzen nicht zu überschreiten, erfordert m.E. eine unmenschliche Härte gegenüber sich selbst. Darüber hinaus ist ein drastisches Umdenken hinsichtlich des Begriffs „Disziplin“ angesagt. Gerade leistungsorientierte Menschen tun sich damit schwer. Pacing wird jedoch inzwischen als das wichtigste Instrument im Umgang mit ME/CFS betrachtet, um die Erkrankung in Schach zu halten.
ME/CFS und MCAS sind zugleich multisystemische Erkrankungen, die sich bei jeder bzw. jedem von uns sehr individuell zeigen. Daher bedarf es meist einer Vielzahl weiterer Diagnostik- und Behandlungsmaßnahmen, um schrittweise wieder ins Leben zurückkehren zu können. Im weiteren Verlauf des Buches gehe ich daher auf die einzelnen Therapiemöglichkeiten und Probleme ein.
Zum Schluss möchte ich meinen eigenen bisherigen Weg schildern. Dieser war (und ist nach wie vor) eine Berg- und Talfahrt, die teilweise einem Hürdenlauf ähnelt. Aufgrund der Chronifizierung meiner Erkrankung und der gleichzeitig bestehenden Mastzellsymptomatik muss ich grundsätzlich vorsichtig und sanft vorgehen. Viele mögliche Therapien sind in meinem Fall zu riskant und überfordern den Körper. Aber auch mit kleinen Schritten komme ich voran: Ich kann heute wieder zwei Stunden am Tag spazieren gehen, lesen und Bücher schreiben. Einiges ist wieder möglich, wobei ich jedoch nach wie vor in sehr eng gesteckten Grenzen und Strukturen leben muss. Viele Lebensentwürfe musste ich auf diesem Weg begraben. Andere Träume wurden endlich wahr. Heute führe ich ein „kleines, feines Leben“, das ich mir mit Unterstützung meiner therapeutischen und medizinischen Helfer sowie meinem privaten Umfeld erkämpft habe.
Mein Ziel ist es, Mut zu machen und aufzuzeigen, dass es möglich ist, Hürden zu überwinden und neue Wege zu gehen, um wieder schrittweise ins Leben zurückkehren zu können. Dabei gehe ich auch auf die Stolpersteine, Schwierigkeiten und Umwege ein. Denn diese gab es bei mir zuhauf.
Bitte achten Sie jedoch darauf, dass mein Weg nicht 1:1 übertragen werden kann. Vieles, was mir half und hilft, kann für andere Betroffene zu riskant sein. Eine gründliche Analyse der eigenen Situation ist daher unabdingbar. Das gilt insbesondere für die schwer Erkrankten.
Schön wäre es, wenn auch Unterstützer und Behandler von diesen Schilderungen profitieren. Denn es gibt meines Erachtens bis auf wenige Ausnahmen nach wie vor zu wenig Mediziner und Behandler, die sich eingehend mit den Auswirkungen und der Behandlung von ME/CFS und MCAS beschäftigen. Diese Lücke muss unbedingt gefüllt werden, um die Not vieler Menschen zu lindern.
Beppo, der Straßenkehrer
„… Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, denkt man.
“Er (Beppo) blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort: „Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen."
Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: "Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten."
Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: "Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein." Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort: "Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste."
Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: "Das ist wichtig."
Michael Ende aus „Momo“1
Hinweise zu diesem Buch
Folgende Anmerkungen dienen zum besseren Verständnis und zur optimalen Handhabung des vorliegenden Buches. Bitte berücksichtigen Sie diese vor der Lektüre.
Dieses Buch beruht auf meinen ureigenen Erfahrungen, die ich mit den beiden Erkrankungen ME/CFS und MCAS gemacht habe. Die Informationen, Hinweise und Tipps in diesem Buch wurden in den letzten Jahren umfassend recherchiert und überprüft. Ich erhebe in diesem Buch jedoch keinen Absolutheits- und Vollständigkeitsanspruch, da mein Wissen natürlich subjektiv beeinflusst und auf meinen Erfahrungshorizont basiert.
Bitte berücksichtigen Sie, dass ich in diesem Buch aus pragmatischen Gründen nur den Begriff „ME/CFS“ verwende, damit aber Erkrankungen mit diesem Symptomkomplex und damit „Long Covid“, „Post Covid“ sowie „Post Vacc-Syndrom“ mit einbeziehe.
Sie können dieses Buch auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Primär ist es als Ratgeber oder als Nachschlagewerk gedacht. Sie können das Buch von Anfang bis Ende durchlesen, sich aber auch nur bestimmte Kapitel und Übungen herauspicken, die Sie interessieren. Wichtig ist, dass Sie für sich den bestmöglichen Nutzen daraus ziehen. Markieren Sie, machen Sie Notizen, schreiben Sie Ihre Erfahrungen dazu. Alles ist erlaubt. Es ist Ihr Buch.
Dieses Buch enthält eine Fülle von Möglichkeiten, das autonome Nervensystem zu beruhigen und zur Linderung von ME/CFS und MCAS beizutragen. Damit biete ich Ihnen eine Art „Werkzeugkoffer“. Wie Sie diesen Werkzeugkoffer nutzen wollen, bleibt Ihre freie Entscheidung. Sie müssen weder einen von außen aufgestellten „Plan“ erfüllen noch eine Reihenfolge bei den Übungen beachten. Entscheidend ist, dass Sie neugierig sind, einzelne Übungen testen – und für sich selbst herausfinden, welche Übungen in Ihrer persönlichen Situation geeignet sind.
Achten Sie bei der Auswahl der Übungen auf Ihre eigene Belastbarkeit, hören Sie auf Ihren Körper und überfordern Sie sich nicht. Idealerweise sprechen Schwer- und Schwersterkrankte vorab mit ihren Behandlern ab, welche Übungen sie in welchem Rhythmus und Pensum durchführen können.
Auch andere – v.a. emotional aufwühlende - Übungen sollten unter gewissen Umständen nur mit Hilfe von Behandlern durchgeführt werden. Bitte fangen Sie vor allem nicht in instabilen Zeiten oder bei parallel bestehenden psychischen Erkrankungen allein damit an. Beachten Sie zudem, dass für die praktische Anwendung der enthaltenen Hinweise und Tipps keine Haftung übernommen werden kann.
Mir war einerseits wichtig, mit diesem Ratgeber und Erfahrungsbericht eine Hilfestellung zu bieten, die so wenig Triggerpotential wie möglich enthält. Andererseits wollte ich Tabus nicht aussparen wie z.B. das Thema „Sterbehilfe“. Daher finden Sie Triggerwarnungen und -zeichen wie z.B. bei dem Begriff „Sui***“.
Aus stilistischen und praktikablen Gründen habe ich in diesem Buch auf das Gendern verzichtet. Daher bezieht sich die gewählte männliche Form immer zugleich auf weibliche und männliche Personen.
Meine eigenen Erfahrungen sind zum einen im Ratgeber-Teil kursiv gedruckt, zum anderen am Ende des Buchs in einem Kapitel zu finden.
Quellenverweise sind im Literaturverzeichnis am Ende des Buches zu finden. Dort habe ich alle Quellen aufgelistet, mit denen ich in den letzten Jahren verstärkt gearbeitet habe. Weitere Literaturtipps befinden sich in den einzelnen Kapiteln.
Da ich mich durch die eigene Erkrankung bedingt bereits seit vielen Jahren mit den einzelnen Themen beschäftige, konnte ich leider nicht immer im Nachhinein herausfinden, auf welche Autoren mein Wissen und meine Erfahrungen zurückzuführen sind. Vieles habe ich in meinen Therapien oder durch Selbsthilfegruppen – zum Großteil in Gesprächen oder Chats – erfahren. Ich bitte daher um Verständnis, falls die eine oder andere Quelle vergessen wurde. Für diesbezügliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
Dieses Handbuch kann weder (Fach-)Arzt- und Therapiebesuche noch eine gründliche Diagnostik und Behandlung ersetzen. Die Erkrankungen zeichnen sich durch eine starke Komplexität, individuelle Betroffenheit und unterschiedliche Symptome aus. Daher sind eine gründliche Diagnostik und Behandlung unabdingbar. Jeder von Ihnen hat zudem seine eigene Geschichte, eigene Schwächen und Stärken sowie Ressourcen. Die Therapie von ME/CFS und MCAS ist somit immer individuell. Was der einen Person schadet, kann für die andere Person ein Gamechanger sein. Daher bitte ich Sie, so achtsam wie möglich zu sein und Ihr Bewusstsein für sich und Ihren Körper zu stärken. Denn nur so können Sie sich leiten lassen durch den Dschungel der vielfältigen Therapiemöglichkeiten.
Medikamente gehören in die Hände von Fachleuten. Aus diesem Grund bitte ich Sie, keine Medikamente ohne fachärztliche Beratung einzunehmen. Im weiteren Sinne trifft dies auch auf Nahrungsergänzungsmittel (NEMS) zu. Viele NEMS haben genauso wie Medikamente Nebenwirkungen und Kontraindikationen. Daher sollte vor jeder NEM-Einnahme eine gründliche Recherche und Diagnostik vorangestellt werden, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Dies gilt umso mehr für die MCAS-Betroffenen, die mit diversen Unverträglichkeiten rechnen müssen.
ME/CFS und Long Covid
ME/CFS steht für „Myalgische Enzephalomyelitis/Chronische Fatigue-Syndrom“, nicht zu verwechseln mit dem Fatigue-Symptom, das bei Krebs, MS und Co auftreten kann. Hinter der Abkürzung verbirgt sich eine schwere multisystemische und neuroimmunologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad der Behinderung, Arbeitsunfähigkeit sowie Bettlägerigkeit führt.2 Als Auslöser sind v.a. Infektionen (EBV, Borrelien, Herpes, Corona, andere Viren, Bakterien, Pilze), Impfungen, Krebserkrankung mit Chemotherapie und/ oder Bestrahlung, langanhaltende psychische Belastungen sowie eine instabile HWS bekannt. Nur in wenigen Fällen wird kein direkter Auslöser gefunden.3 Bereits seit 1969 stuft die WHO als neurologische Erkrankung ein. Aber erst durch die Folgen von Covid wird die ME/CFS in der Öffentlichkeit und auch im Gesundheitssystem langsam wahr- und ernstgenommen. Vor der Covid-Pandemie waren in Deutschland ca. 250 000 Menschen an ME/CFS erkrankt. Nach der Pandemie gehen die Schätzungen inzwischen davon aus, dass in Deutschland inzwischen mindestens 1 Mio. Menschen an Long Covid und ME/CFS erkrankt sind.4 Weltweit geht man von 17 Millionen ME/CFS-Erkrankten und 400 Millionen Long Covid-Erkrankten aus.5 Damit zählt diese schwere Erkrankung schon längst nicht mehr zu den seltenen Erkrankungen. Trotzdem ist die Versorgung der Betroffenen in Deutschland nach wie vor katastrophal.
Der Begriff Long COVID steht wiederum für eine Vielzahl von Symptomen, die nach einer akuten Covid-19-Erkrankung neu auftreten und mindestens vier Wochen anhalten. Halten die Symptome über drei Monate an, wird von einem Post Covid-Syndrom gesprochen. 6 Manche Long Covid- und Post Covid-Betroffene haben das große Glück, dass ihre Symptome nur vorübergehender Natur sind und im Laufe der Zeit abklingen. Bei anderen Erkrankten hingegen chronifiziert sich die Erkrankung. Wenn die Beschwerden nach sechs Monaten noch nicht abgeklungen sind, sollte über eine ME/CFS-Diagnostik nachgedacht werden. Dies gilt auch für das Post Vacc-Syndrom, dessen Ursache in der Impfung zu suchen ist.
Bitte berücksichtigen Sie, dass ich in diesem Buch aus pragmatischen Gründen nur den Begriff „ME/CFS“ verwende, damit aber alle Erkrankungen mit diesem Symptomkomplex mit einbeziehe.
Hauptsymptome7
Da die ME/CFS sowohl das autonome Nervensystem (ANS) als auch das Immunsystem stark beeinträchtigen, sind die Symptome vielfältig, diffus und teilweise schwer beeinflussbar. Auch die Hormonachse ist stark betroffen. Kardinalsymptom ist jedoch eine starke geistige sowie körperliche Erschöpfung, die die Lebensqualität und den Radius stark einschränkt. Die schwere Erschöpfung und körperliche Schwäche zeigen sich v.a. in der Post-Exertional Malaise (PEM) oder PENE (Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion), die durch eine ausgeprägte und anhaltende Verstärkung aller Symptome nach meist geringer körperlicher oder geistiger Anstrengung gekennzeichnet ist. Umgangssprachlich wird dieses Symptom auch oft als „Crash“ bezeichnet.
PEM/PENE8
PEM/ PENE ist typisch für ME/CFS und zeigt sich in einer starken körperlichen und geistigen Erschöpfung nach alltäglichen Aktivitäten und Belastungen. Gerade bei Schwerbetroffenen können schon Zähneputzen, Duschen oder Kochen einen Crash auslösen. Viele Symptome können sich während eines solchen Rückfalls bzw. Crash verschlimmern, wobei hier v.a. Schmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, starke Reizempfindlichkeit sowie grippeartige Symptome zu nennen wären. Heimtückisch ist, dass diese manchmal nicht sofort, sondern erst mit einer Verzögerung von einigen Tagen auftreten kann. Dies hat zur Folge, dass sich die Betroffenen oft übernehmen, ohne es zu spüren.
Ist ein Crash erst einmal eingetreten, kann dieser tage- oder wochenlang (oder sogar länger) andauern. Oft wird danach eine anhaltende Zustandsverschlechterung festgestellt, was sich in einer noch niedrigeren Belastbarkeit zeigt. Daher gilt es bei der Krankheitsbewältigung vor allem darum, PEM/ PENE zu vermeiden. Zu diesem Zweck wurde die Methode „Pacing“ entwickelt, um die eigenen Energiegrenzen nicht zu überschreiten.I
ORTHOSTATISCHE INTOLERANZ9/ POTS-SYNDROM
Bei Menschen, die an einer orthostatischen Intoleranz leiden, kann sich der Körper kreislauftechnisch nicht mehr aufrecht halten. Daher können viele Betroffene nicht mehr lange oder kaum mehr sitzen oder stehen. Wenn sie dies versuchen, werden sie schwächer. Ihnen wird schwindelig und sie verlieren ihr Gleichgewicht. Das Herz rast und klopft, der Blutdruck gerät aus dem Gleichgewicht. Blässe und Atemnot kommen hinzu. Je nachdem wie schwer diese Intoleranz ausgeprägt ist, wird das Leben der Betroffenen dadurch stark beeinträchtigt. Viele verbringen ihren Alltag mehr oder weniger liegend. Festzustellen ist die orthostatische Intoleranz durch den Schellong-Test, den NASA-10min-Lean-Test oder die Kipptisch-Untersuchung.10
Eine Sonderform der orthostatischen Intoleranz ist das posturale Tachykardie-Syndrom (POTS). Hier steigt der Puls beim Aufrichten bzw. Aufstehen um mind. 30 Schläge an. Herzrasen, Schwindel und ein Schwächegefühl in den Beinen sind die Folge. Der Blutdruck sinkt jedoch meist nicht ab.11
NEUROLOGISCHE SYMPTOME
Hierzu zählen schwere Kopfschmerzen, Muskelzuckungen und -krämpfe, Taubheitsgefühle, Einschlaf- und Durchschlafstörungen trotz extremer Müdigkeit, Brain Fog (neurokognitive Symptome wie Konzentrations-, Merk- und Wortfindungsstörungen) und eine starke Intoleranz in Hinblick auf jegliche Reize. Dies führt u.a. dazu, dass schwer und Schwerstbetroffene Tag und Nacht im Dunkeln liegen müssen und kaum Geräusche ertragen. Andere entwickeln eine starke Duftstoffunverträglichkeit.
STÖRUNG DES IMMUNSYSTEMS
Hier ist zuallererst die erhöhte Infektanfälligkeit aufgrund eines stark verschobenen Immunsystems zu nennen. Infolgedessen kommen ein starkes Krankheitsgefühl, schmerzhafte und geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen und Atemwegsinfekte hinzu. Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto tauchen genauso häufig auf wie Unverträglichkeiten, neue Allergien, MCAS und Co.
STARKE SCHMERZEN
Viele Betroffene leiden unter extremen und zermürbenden Kopfschmerzen, die neuartiger Natur und daher schwer einzuordnen sind. Aber auch Migräne wird oft als Begleiterkrankung genannt. Darüber hinaus treten starke Muskel- und Gelenkschmerzen auf, was oft zu einer Fibromyalgie-Diagnose führt. Nervenschmerzen sind in der Regel auf die Small Fiber Neuropathie (SFN) zurückzuführen, die nach wie vor viel zu selten diagnostiziert wird.
Darüber hinaus bestehen bei ME/CFS meist etliche Begleit- und Folgeerkrankungen und -störungen. Ein Neurologe erklärte mir letztens, dass er Patienten mit bis zu 100 Symptomen betreut. Vor allem die Fehlfunktion des autonomen Nervensystems (ANS) bedingt etliche funktionelle Störungen wie Verdauungsstörungen, Reizblase oder Reizdarm.
Diagnostik
Da noch keine Biomarker für die ME/CFS bekannt sind, wird die Diagnose mit Hilfe der Ausschlussdiagnostik und anhand des klinischen Erscheinungsbildes gestellt. Eine gründliche Anamnese bekommt daher einen großen Stellenwert, in der die kanadischen Konsenskriterien abgefragt werden. Diese sind in einem Leitfaden bzw. Fragenkatalog zusammengestellt. Theoretisch kann jeder Behandler das kanadische Interview durchführen. Dafür ist es von Ihrer Seite hilfreich, ein Symptomtagebuch zu führen.
KANADISCHE KRITERIEN
Der deutsche Fragebogen für das kanadische Interview wird u.a. von Prof. Dr. Stark im Netz zur Verfügung gestellt. Er ist unter folgendem Link zu finden: https://profstark-selbsthilfe.de/cfs-diagnose. Sie können dort den Test auch erst einmal für sich durchführen, bevor Sie einen Arzt ansprechen.
WEITERE UNTERSUCHUNGEN
Darüber hinaus sollte immer
eine körperliche Untersuchung
ein Test auf Kreislaufbeschwerden beim Aufstehen (Schellong-Test)
Blut- und Urinuntersuchungen sowie
eine Handkraft-Messung
vorgenommen werden.
Auf weitere Belastungsprüfungen wie z.B. einen Ergometer-Belastungstest sollte aufgrund der hohen Risken verzichtet werden. Eine gründliche Ausschlussdiagnostik macht jedoch weiterführende Untersuchungen wie EKG, Ultraschalluntersuchungen, Röntgen oder MRT notwendig. Sinnvoll ist v.a., unterschiedliche rheumatische und neurologische Erkrankungen abzuklären und auszuschließen. Auch ein Besuch beim Endokrinologen ist notwendig, da die Hormonachse stark gestört ist und Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse nicht selten sind. Ein Gefäßmediziner wiederum untersucht die entholiale Dysfunktion und kann diesbezüglich Medikamente verschreiben. Und zu guter Letzt kann die Erregerdiagnostik, also die Suche nach (versteckten) Infektionen, Klarheit bringen. Aber spätestens beim letzten Punkt machen einige Schulmediziner bereits dicht. Es bleibt dann nur noch die Möglichkeit, einen erfahrenen Privatmediziner aufzusuchen, der sich mit chronischen Infektionen gut auskennt.
Ähnliche Symptome wie ME/CFS weisen u.a. folgende Erkrankungen auf, die jedoch auch als Begleiterkrankung von ME/CFS auftreten können:12
Chronische Infektionen wie Hepatitis oder Lyme-Borreliose
Schilddrüsenerkrankungen
Magen-Darm-Erkrankungen wie Zöliakie oder Morbus Crohn
psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen
neurologische Erkrankungen wie multiple Sklerose oder schwere Muskelschwäche
Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder das Sjögren-Syndrom
Krebs
Blutarmut (Anämie)
Nebenwirkungen von Medikamenten wie Antidepressiva
Schlafstörungen wie eine Schlafapnoe
chronische Schmerzerkrankungen
schädlicher Drogen- oder Alkoholkonsum
HOHE NEUROTRANSMITTER-AUTOANTIKÖRPER
Eine Sonderrolle spielt die Messung der Autoantikörper (AAk) gegen Neurotransmitter-Rezeptoren wie β-adrenerge Rezeptoren und muskarinerge AcetylcholinRezeptoren (mAChR). Diese können bei ca. 30 Prozent aller ME/CFS-Patienten gefunden werden. Sie gelten jedoch nicht als Beweis für die Erkrankung.13
Die Neurotransmitter Rezeptoren gehören zur Gruppe der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPGR) wie adrenerge und muskarine Rezeptoren. Auch bei Long-COVID konnten zahlreiche AAk gefunden werden, unter anderem gegen verschiedene GPGR.14 GPCR sind in der Zellmembran zuständig für die Wahrnehmung und Weiterleitung von Reizen ins das Zellinnere. Dadurch beeinflussen sie auch das autonome Nervensystem. AAk gegen mAChR werden mit Muskelschwäche und neurokognitiven Störungen in Verbindung gebracht.
In Hinblick auf die hohen Autoantikörper gibt es bisher noch keine erfolgreiche Therapie. Teure Blutwäschen wie Immunadsorptionen können manchen Personen helfen, wobei jedoch inzwischen deutlich wird, dass diese bei einer Großzahl von Betroffenen regelmäßig wiederholt werden müssen. Gleichzeitig wird bei MCAS von diesen Methoden aufgrund der hohen Risiken abgeraten.15
Einige Forschungen laufen zurzeit zu dem vielversprechenden Medikament BC007 in der Uniklinik Erlangen. An Probanden wurden jedoch nur Long Covid-Patienten ohne Komorbiditäten zugelassen. Das Medikament ist inzwischen zum Politikum geworden, da eine Studie für ME/CFS geplant war, jedoch nicht durchgeführt wurde. Inwieweit BC007 irgendwann auf den Markt kommt, steht noch in den Sternen.16 Und auch dann wird es vermutlich nur Long Covid-Patienten zur Verfügung gestellt werden. Für die ME/CFS-Betroffenen wäre es wieder einmal nur „Off Label“ Therapie, also auf eigene Kosten und eigenes Risiko, erhältlich. Daher ist es aktuell am sinnvollsten, sich bei hohen Autoantikörpern auf den autoimmunen Charakter von ME/CFS zu besinnen und z.B. mit dem Coimbra-Protokoll zu arbeiten, das bei Multipler Sklerose und anderen Autoimmunerkrankungen sehr gute Effekte erzielen konnte. Auch einige Heilpilze wie der Agaricus Blazeii können bei Autoimmunerkrankungen sehr hilfreich sein. Bei MCAS sollte wiederum sorgfältig abgewogen werden, inwieweit diese Versuche vertretbar sind.
Der Schweregrad und die Behinderung durch die Erkrankung wird durch die Bell-Skala festgelegt. Für einige Patienten ist es aber sinnvoller und genauer, den Schweregrad nach der britischen NICE-Leitlinie festzustellen, die eine Einteilung in mild, mittel, schwer und sehr schwer betroffen vornimmt. Entscheidend dabei ist, dass Betroffene im Laufe der Zeit unterschiedliche Schweregrade der Erkrankung erfahren können.
BELL-SKALA17
100
Keine Symptome in Ruhe oder bei körperlicher Belastung; insgesamt ein normales Aktivitätsniveau; ohne Schwierigkeiten in der Lage, Vollzeit zu arbeiten.
90
Keine Symptome in Ruhe; leichte Symptome bei körperlicher und geistiger Belastung; insgesamt ein normales Aktivitätsniveau; ohne Schwierigkeiten in der Lage, Vollzeit zu arbeiten.
80
Leichte Symptome in Ruhe; die Symptome verstärken sich durch Belastung; nur bei Tätigkeiten, die anstrengend sind, ist eine geringfügige Leistungseinschränkung spürbar; mit Schwierigkeiten in der Lage, an Arbeitsplätzen, die Kraftanstrengungen erfordern, Vollzeit zu arbeiten.
70
Leichte Symptome in Ruhe; deutliche Begrenzungen in den täglichen Aktivitäten spürbar; der funktionelle Zustand beträgt insgesamt etwa 90% der Norm – mit Ausnahme von Tätigkeiten, die einer Kraftanstrengung bedürfen; mit Schwierigkeiten in der Lage Vollzeit zu arbeiten.
60
Leichte Symptome in Ruhe; deutliche Begrenzungen in den täglichen Aktivitäten spürbar; der funktionelle Zustand beträgt insgesamt etwa 70%—90% der Norm; unfähig, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen, wenn dort körperliche Arbeit gefordert wird; aber in der Lage, Vollzeit zu arbeiten, wenn es um leichte Arbeiten geht und die Arbeitszeit flexibel gehandhabt werden kann.
50
Mittelschwere Symptome in Ruhe; mittelschwere bis schwere Symptome bei körperlicher Belastung oder Aktivität; der funktionelle Zustand ist auf 70% der Norm reduziert; unfähig, anstrengende Arbeiten durchzuführen, aber in der Lage, leichte Arbeiten oder Schreibtischarbeit für 4-5 Stunden täglich durchzuführen, wobei Ruhepausen benötigt werden.
40
Mittelschwere Symptome in Ruhe; mittelschwere bis schwere Symptome bei Belastung oder Aktivität; der funktionelle Zustand ist auf 50%-70% der Norm reduziert; unfähig, anstrengende Arbeiten durchzuführen, aber in der Lage, leichte Arbeiten oder Schreibtischarbeit für 3-4 Stunden täglich durchzuführen, wobei Ruhepausen benötigt werden.
30
Mittelschwere bis schwere Symptome in Ruhe; schwere Symptome bei jeglicher Belastung oder Aktivität; der funktionelle Zustand ist auf 50% der Norm reduziert; in der Regel ans Haus gefesselt; unfähig, anstrengende Arbeiten durchzuführen, aber in der Lage, leichte Arbeiten oder Schreibtischarbeit für 2-3 Stunden täglich durchzuführen, wobei Ruhepausen benötigt werden.
20
Mittelschwere bis schwere Symptome in Ruhe; schwere Symptome bei jeglicher Belastung oder Aktivität; der funktionelle Zustand ist auf 30%-50% der Norm reduziert; bis auf seltene Ausnahmen unfähig, das Haus zu verlassen; den größten Teil des Tages ans Bett gefesselt; unfähig, sich mehr als eine Stunde am Tag zu konzentrieren.
10
Schwere Symptome in Ruhe; die meiste Zeit bettlägerig; ein Verlassen des Hauses ist nicht möglich; deutliche kognitive Symptome, die eine Konzentration verhindern.
0
Ständig schwere Symptome; immer ans Bett gefesselt; unfähig zu einfachsten Pflegemaßnahmen.
NICE-LEITLINIE18
Mildes ME/CFS:
Mild Erkrankte sind im Vergleich zu früher deutlich eingeschränkt. Sie sind jedoch noch weitestgehend selbstständig, benötigen aber eventuell Unterstützung bei Haushaltstätigkeiten. Oft sind sie in ihrer Mobilität eingeschränkt, arbeiten jedoch noch. Dafür bezahlen sie aber teilweise einen hohen Preis, da sie meist auf Freizeitaktivitäten verzichten müssen. Darüber hinaus ist es in der Regel unabdingbar, die Arbeitszeiten zu reduzieren und auf Erholungsphasen zu achten.
Moderates ME/CFS:
Personen mit mittelschwerem ME/CFS sind in Mobilität und Alltag stark eingeschränkt. Beruf oder Ausbildung sind normalerweise nicht mehr möglich. Typisch sind Schwankungen im Symptomverlauf. Außerhaustermine führen in der Regel zu PEM/ PENE. Daher ist Pacing das A und O.
Schweres ME/CFS:
Rund 25 Prozent der ME/CFS-Patienten sind schwer oder sehr schwer betroffen. Für sie sind nur noch minimale Tätigkeiten wie die tägliche Hygiene oder Zähneputzen möglich. Viele alltägliche Aktivitäten (wie zum Beispiel Kochen, Duschen, Haare waschen, Putzen) können nicht mehr selbständig durchgeführt werden, ohne PEM/ PENE auszulösen. Aufgrund der starken orthostatischen Intoleranz und Schwäche benötigen sie in der Regel einen Rollstuhl. Sie sind ans Haus bzw. an das Bett gebunden. Darüber hinaus besteht eine hohe Intoleranz gegenüber äußeren Reizen.
Sehr schweres ME/CFS:
Betroffene sind ans Bett gebunden und benötigen Unterstützung bei der persönlichen Hygiene und der Nahrungsaufnahme. Eine extreme Empfindlichkeit gegenüber Reizen (Licht, Geräusche, Gerüche, Berührungen) ist typisch. Viele können kaum noch sprechen und werden teilweise über die Sonde ernährt.
.Therapie
Bisher gibt leider noch keine anerkannten Therapien. Da es nach wie vor viel zu wenig Mediziner gibt, die sich mit der Erkrankung auskennen oder beschäftigen wollen, sind die meisten Betroffenen mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Eigenrecherche nimmt einen großen Platz bei der Krankheitsbewältigung ein. Eigeninitiative und Disziplin sind in Hinblick auf Stressmanagement, Pacing und Co. gefragt. Medikamente wiederum werden v.a. eingesetzt, um Symptome und Begleiterkrankungen zu lindern.
Leider gilt ME/CFS bisher als nicht heilbar, auch wenn immer wieder Ausnahmen bekannt werden, die sich von der Erkrankung gänzlich erholen konnten. Bei Long und Post Covid können sich die Symptome mit der Zeit abmildern bzw. völlig verschwinden, wobei man inzwischen jedoch bei 50 Prozent der Erkrankungen von einer Chronifizierung ausgeht.
Weiterführende Informationen zu ME/CFS finden Interessierte unter dem link me/cfs.de. Dort ist u.a. auch eine Anleitung zur Betreuung von Schwerstkranken zu finden.19 Behandler können sich inzwischen dank des Online-Schulungsangebots an der Charité unkompliziert weiterbilden. Die einzelnen Module sind on demand verfüg bar und unter dem link mecfs.de/was-ist-me-cfs/informationen-fuer-aerztinnen-und-aerzte/on-demand-fortbildung zu finden.
Dieses Buch befasst sich eingehend mit den einzelnen Therapiemöglichkeiten und auch mit unterschiedlichen Heilversuchen, die unter ME/CFS-Betroffenen und in der Fachwelt diskutiert werden. Mehr dazu finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.
I Diese Methode wird später im Kapitel „Pacing“ detailliert erläutert.
Das Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS)
Das Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) ist eine komplexe und in Deutschland noch sehr unbekannte Multisystemerkrankung. Experten gehen jedoch davon aus, dass etwas etwa 17 % der Bevölkerung mehr oder weniger von MCAS betroffen sind.20
Bei dieser Erkrankung sind die Mastzellen überaktiv. Diese sind Teil des Immunsystems und befinden sich in allen Organen unseres Körpers. Im Normalfall schützen sie uns vor Krankheitserregern. Bei Überaktivierung hingegen können sie auf alle möglichen Umweltreize reagieren und schütten im Ernstfall 200 verschiedene Mediatoren wie z.B. Histamin und Leukotriene aus. Dadurch entstehen Entzündungen und allergische Symptome auf vielfältigste Weise. Viele Betroffene leiden unter gastrointestinalen Symptomen.21 Aber auch Hautsymptome sind oft vorzufinden. Beides führt dazu, dass die MCAS anfangs oft mit einer Histaminintoleranz (HIT) verwechselt wird. Wenn dann keine weiterführende Diagnostik durchgeführt wird und nur Histaminverzicht empfohlen wird, werden wichtige Therapien nicht durchgeführt, was zu einer weiteren Verschlechterung führen kann. Denn die Mastzelldegranulation schreitet ohne Stabilisierung leider fort.
Die Symptomvielfalt bei MCAS ist niederschmetternd und diffus. Dabei können die Symptome von leichten, kaum merkbaren Problemen bis hin zu schweren Erkrankungen reichen, welche die Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit stark einschränken können.
Mögliche Symptome22
Allgemeinsymptome: Fatigue, Fieber, Frösteln, Gewichtsverlust oder -zunahme, Allergien, Ödeme, Hitzewallungen, chronische Entzündungen des Gewebes, Thromboseneigung
Nervensystem: Schwindel, Kopfschmerzen und Migräne, Konzentrationsstörungen und Wortfindungsstörungen, Schlafstörungen, Depressionen, Parästhesien, Tinnitus
Herz/ Kreislauf: Brustschmerzen, Blutdruckentgleisungen, Schwindel, Ohnmachtsanfälle, Schwäche, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen
Magen/ Darm: Nausea, Erbrechen, Übelkeit, Appetitverlust, Sodbrennen und Magenschleimhautentzündung sowie stiller Reflux, Analekzeme, Juckreiz am After, Globusgefühl bzw. Schluckbeschwerden, Blähungen, Bauchschmerzen und -krämpfe, Darmentzündungen, Dünndarmfehlbesiedlung, Durchfall, Obstipation, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, unzureichende Verdauung von Nährstoffen, Verklebungen von Eingeweiden und Bauchfell etc.
Atemwege: Hustenreiz, Asthma, Verengung der Bronchien, Schnupfen/ Laufende Nase, Chronische Heiserkeit, Nasennebenhöhlen- und Stirnhöhlenentzündungen, Räusperzwang
Haut: Flush, Juckreiz, Urtikaria, Schwellungen, Bindehautentzündungen und - reizungen
Geschlechtsorgane/ Blase: Häufiger Harndrang, Dysurie, Urethritis, Zystitis (interstitielle Zystitis), Vaginitis, Schmerzen im kleinen Becken
Immunsystem: Anaphylaktische Reaktionen, Infektanfälligkeit, Grippegefühle, Schwellung der Lymphknoten, Zahnschmerzen
Hormonsystem: Menstruationsbeschwerden, Endometriose, Hormonstörungen
Muskeln/Knochen: Fibromyalgie, Neigung zu Osteoporose
Weitere Symptome: Neigung zu Aphthen, Ohrenentzündungen, Leber- und Milzvergrößerung…
Leider wird die MCAS sehr spät entdeckt und anfangs oft als psychosomatische Erkrankung diagnostiziert. Daher haben die meisten Betroffenen bereits eine längere Leidensgeschichte mit unterschiedlichen Diagnosen hinter sich, bevor sie endlich „gesehen“ werden.
Diagnostik
Die Diagnostik ist bei MCAS recht schwierig. Einerseits gibt es kaum Anlaufstellen in Deutschland, andererseits sind diese über Monate und Jahre ausgebucht oder überfüllt. Einige Experten widmen sich inzwischen ausschließlich Forschung (z.B. Moldrings, Mücke), andere machten Privatpraxen auf. Und nicht zu guter Letzt sind durch Long Covid sehr viele neue MCAS-Patienten hinzugekommen. Folglich sind die Anlaufstellen in Deutschland völlig überlastet.
Gleichzeitig hält sich bei einigen Ärzten nach wie vor die Meinung, dass bei einer MCAS die Tryptase im Blut erhöht sein muss, während inzwischen klar sein sollte, dass dies nur auf die Mastozytose zutrifft und auch bei niedriger Tryptase eine MCAS vorliegen kann.23 Dies ist v.a. dann der Fall, wenn sich die Betroffenen bei den Testungen bereits histaminarm ernähren und sich in keinem Schub befinden.
Aus diesem Grund sollten Sie – wenn möglich – zumindest die Blut- und Urin-Diagnostik bei Ihrem Hausarzt oder einem anderen Behandler durchführen. Als Argumentationsgrundlage für Ihren Hausarzt gibt es einen Fragebogen der Uniklinik Bonn, der von Prof. Dr. Moldrings entwickelt wurde.II Bitte beachten Sie dabei, dass dieser Fragebogen keine Diagnostik ersetzen und nur einen ersten Anhaltspunkt bieten kann. Darüber hinaus können Sie über mcas-hope.de Info-Broschüren für Ihren Hausarzt anfordern oder ihm anbieten, sich auf mcas-hope.de oder mastzellenhilfen.dezu informieren.
Sollte Ihr Hausarzt jedoch kein Verständnis haben, bleibt Ihnen immer noch die Erst-Diagnostik über private Behandler. Über das Labor IMD Berlin können diese sowohl die Histaminintoleranz als auch die MCAS über Blut- und Urinproben abklären, wobei hier nur das Minimum an Werten untersucht wird. Den dazugehörigen Patientenflyer können Sie sich auf der Website von IMD-Berlin unter dem Reiter „Für Patienten“ ausdrucken.
Folgende Untersuchungen sollten normalerweise gemacht werden24:
BLUTUNTERSUCHUNGEN
Serum-Tryptase
Serum-Chromogranin A
Gekühltes Plasma auf Prostaglandin D2, und/oder 11-β-PGF2α.
Gekühltes Plasma auf Histamin
Gekühltes Plasma auf Heparin
Großes Blutbild
Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, müssen diverse Medikamente vorher abgesetzt werden. Auch muss dem Arzt mitgeteilt werden, wenn bereits histaminarm gegessen wird. Lesen Sie daher unbedingt vorher nochmals unter dem link https://www.mastzellenhilfe.de/testen-mcas nach, worauf geachtet werden muss.
URINUNTERSUCHUNGEN
N-Methylhistamin
Prostaglandin D2
Leukotriene
sowohl im Sammelurin über 24 Stunden als auch in einer einzelnen Urinprobe. Dabei muss der Urin gekühlt werden.
WEITERE UNTERSUCHUNGEN
Wenn diese Ergebnisse auffällig sind, sollten die Differentialdiagnostik angestrebt werden, um z.B. einige andere Erkrankungen wie IGE-Allergien etc. auszuschließen. Sie finden die Liste der auszuschließenden Krankheiten auf dem bereits genannten Fragenbogen der Uniklinik Bonn. Einige dieser Erkrankungen können jedoch auch als Begleiterkrankungen der MCAS auftreten.
U.a. müssen folgende Erkrankungen abgeklärt werden25:
Diabetes mellitus
Porphyrie
Hereditäre Hyperbilirubinämien
Schilddrüsenerkrankungen
Morbus Fabry
Helicobacter-positive Gastritis
Infektiöse Enteritis
Parasitosen
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Primäre Zöliakie
Laktose- oder Fruktoseintoleranz
Mikroskopische Colitiden
Amyloidose
Briden, Volvulus u. ä
Hepatitis
Cholecystolithiasis
Dunbar-Syndrom
Carcinoidtumor
Phäochromozytom)
Pankreatische endokrine Tumoren
Primäre gastrointestinale Allergien
Hypereosinophiles Syndrom
Hereditäres Angioödem
Vaskulitis
Intestinale Lymphome
BIOPSIEN
Darüber hinaus ist eine Magen-/ Darmspiegelung mit Schichtbiopsie und Auszählung der Mastzellen sinnvoll, um den letzten Beweis für eine MCAS zu erbringen. Idealerweise arbeiten die Gastroenterologen, die die Spiegelung durchführen, mit einem Labor zusammen, das sich mit Mastzellendiagnostik auskennt. Darüber hinaus können die Proben später noch an kundige Labore in Erlangen und München geschickt werden. Informationen über das notwendige Prozedere inkl. der Adressen finden Sie unter dem link https://mcas-hope.de/mcas/mcas-diagnostik/.
Weitere Details zur MCAS-Diagnostik finden Sie in dem Buch „Systemische Mastzellerkrankung“ von Prof. Dr. Moldrings und Prof. Dr. Mücke sowie in dem E-Book von Dr. Nina Kreddig.III
Therapie
Die Therapie besteht in erster Linie darin, die mastzellaktivierenden Trigger zu vermeiden. Dies kann die Lebensqualität sehr einschränken, da Trigger allerorts zu finden sind und viele Lebensbereiche betreffen. Die Auslöser für einen Schub sind sehr individuell, was meist eine akribische Detektivarbeit erfordert. Da eine Reaktion der Mastzellen oft nicht direkt, sondern bis zu 72 Stunden später auftreten kann, ist es zudem teilweise sehr schwierig, im Nachhinein die Auslöser für einen Mastzellschub herauszufinden. Führen Sie daher gerade am Anfang am besten Tagebuch, um Ihre individuellen Trigger zu erkennen.
POTENZIELLE TRIGGER
Nahrungsmittel
Andere Unverträglichkeiten wie Salicylat- oder orale Nickelintoleranz
Getränke
Kosmetik
Medikamente
Zusatzstoffe in Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln
Jahreszeiten-, Temperatur- und Wetterwechsel
Sonne
Kälte
Stress
Körperliche oder geistige Überanstrengung
Sport
Lange Autofahrten/ Reisen
Operationen
Hormonwechsel (Regel, Wechseljahre)
Duftstoffe und Gerüche
Die medikamentöse Basistherapie sieht eine Kombination von Antihistaminika (H1 und H2-Antihistaminika) und Mastzellstabilisatoren vor. Moldrings und Mücke raten vorzugsweise bei den H1-Antihistaminika zu den verschreibungspflichtigen Medikamenten Rupatadin oder Fexofenadin, da diese keine Nebenwirkungen am Herzen zeigen. Aber grundsätzlich eignen sich auch alle anderen H1-Antihistiminika,27 wobei die Produkte der zweiten Generation generell verträglicher sind.
H2-Histaminika (Famotidin) sind schwieriger. Einerseits helfen sie gegen die durch Histamin überschießende Magensäureproduktion und damit gegen Refluxerkrankungen. Andererseits können sie auch kontraproduktiv wirken, wenn aufgrund eines destabilisierten ANS zu wenig Magensäure produziert wird und eine chronischrezidivierende Dünndarmfehlbesiedlung besteht. Dann sollte im Zweifelsfall eher darauf verzichtet werden.
Zuletzt kommen die Mastzellstabilisatoren ins Spiel. Vorzugsweise wird hier Cromocyclinsäure (Allergoval, Pentatop) empfohlen, die jedoch bei einer gleichzeitigen Salicylatintoleranz meist unverträglich ist. In solchen Fällen wird auf Ketotifen zurückgegriffen. Unbedingt eingenommen werden sollte zusätzlich täglich 750 mg Vitamin C (in Retard-Form oder über den Tag verteilt). Darüber hinaus können pflanzliche Stabilisatoren wie Quercetin sehr hilfreich sein. Bei einer gleichzeitig vorliegenden Salicylatintoleranz muss jedoch auch auf diese verzichtet werden.
Wichtig ist, jedes Medikament einzeln einzuschleichen und die Dosierung anzupassen. Dafür bedarf es sehr viel Geduld und auch Mut, denn nicht selten sind einige Medikamente oder Zusatzstoffe unverträglich und lösen erst einmal einen Rückschlag aus. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass nicht wenige Betroffene auf die Trägerstoffe der Medikamente reagieren können. Daher kann es sinnvoll sein, die Medikamente als Reinstoffe z.B. von der Klösterl Apotheke in München über ein spezielles Rezept zu beziehen. Diese stellt MCAS-Behandlern inzwischen auch ein Testset mit den wichtigsten Medikamenten zur Verfügung, wobei Rupatadin bisher leider nicht inbegriffen ist. Fragen Sie bei Interesse direkt bei der Klösterl Apotheke in München nach, deren Personal sehr hilfsbereit ist.IV
Darüber hinaus raten Moldrings und Mücke zu einer Ernährungsumstellung für die ersten Wochen, in der auf Produkte mit Gluten, Rindfleisch, Kuhmilcheiweiß und Backhefe verzichtet werden sollte.28 Andere Experten setzen auf histaminarme Kost, wobei unbedingt auch die Histaminliberatoren berücksichtigt werden müssen. Hilfestellung hierzu finden Sie über die SIGHI-Lebensmittelliste.V
Die Dosis der Basismedikamente kann und muss auch oft bis auf die Maximaldosis erhöht werden. Darüber hinaus kann die Medikation symptomorientiert ausgeweitet werden. Sollte dies nicht ausreichen oder sollten die Medikamente nicht vertragen werden, muss über andere Therapieoptionen nachgedacht werden. Spätestens dann ist es meist unerlässlich, eines der Kompetenzzentren für MCAS aufzusuchen, was für manche Betroffene lange Fahrten notwendig macht.
Weiterführende Informationen zu MCAS finden Sie u.a. auf den Webseiten mcas-hope.de oder mastzellenhilfe.de. Darüber hinaus bietet die App „Systemisches MCAS“ Hilfestellung und Unterstützung für unterwegs.VI
In dem Buch von Moldrings und Mücke „Die systemische Mastzellerkrankung“ sowie in dem E-Book von Dr. Nina Kreddig "Der MCAS-Wegweiser - Antworten und Aktionspläne für Menschen mit dem Mastzellaktivierungssyndrom" werden grundlegende Informationen zur Diagnostik und Behandlung der Erkrankung zur Verfügung gestellt. Letztere bietet auf ihrer Website mastzellenhilfe.de zudem Beratung sowie ein Fachnetz für Behandler an.VII
II Dieser Fragebogen ist unter folgendem link abrufbar: https://www.humangenetics-bonn.de/wp-content/uploads/2024/01/Fragebogen-englisch-1-15-20-LW-GJM.pdf.
III Dieses ist unter folgendem link erhältlich:https://mastzellenhilfe.myelopage.com/s/mastzellenhilfe/ebook-diagnosekriterien-fachpersonal
IV Die Kontaktdaten der Klösterl Apotheke finden Sie auf deren Webseitewww.kloesterl-apotheke.de
V Diese können Sie unter folgendem link herunterladen:https://www.mastzellaktivierung.info/downloads/foodlist/11_FoodList_DE_alphabetisch_mitKat.pdf
VI Die App ist auch sowohl in den gängigen App-Stores als auch unterhttps://systemisches-mastzellaktivierungssyndrom-mcas.de/MCAS/Was-ist-MCAS als Download erhältlich.
VII Das Fachnetz ist zu finden unter https://www.mastzellenhilfe.de/fachnetz-mcas.
Wo finde ich Hilfe und Unterstützung?
In Deutschland finden Betroffene nach wie vor nur sehr wenige Anlaufstellen für ME/CFS. Zudem belassen die dort angestellten Ärzte es auf bei einer Diagnostik und schicken die Patienten dann mit dem Verweis nach Hause, sich an einen Hausarzt zu wenden.
Auch für MCAS gibt es kaum Spezialisten. Die wenigen Fachleute sind überlaufen und haben teilweise Wartezeiten von Jahren, wenn sie überhaupt noch Neupatienten aufnehmen. Daher ist allein schon die Diagnostik für manche Betroffene ein großes Abenteuer, für das sie kaum Kraft haben. Manche reisen Hunderte von Kilometern, um einen Termin bei einem der wenigen Ärzte zu bekommen, die ME/CFS und MCAS diagnostizieren können. Andere bezahlen viel Geld für private Behandler, weil im Kassensystem kein Raum für die hochkomplexen Erkrankungen vorhanden ist. Das ist leider Fakt.
Und auch wenn das Gesundheitsministerium verspricht, deutschlandweit entsprechende Anlaufstellen einzurichten, so ist die Versorgung von ME/CFS- und Long Covid-Patienten nach wie vor sehr schlecht aufgestellt. Bei MCAS sieht es ähnlich aus. Daher tun Betroffene zurzeit gut daran, sich über andere Wege Hilfe und Unterstützung zu suchen. Leider ist dies oft mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Aber ein paar Lichtblicke gibt es vielleicht doch.
Ambulanzen von Krankenhäusern
Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung wurde versprochen, das Versorgungsnetz für ME/CFS und Long Covid auszubauen. Aber nach wie vor besteht hier noch großer Handlungsbedarf.
Unter folgendem link finden Sie eine Übersicht über die Post Covid-Ambulanzen in Deutschland: https://longcoviddeutschland.org/ambulanzen. Bitte erkundigen Sie sich vorab, ob diese auch Post Vacc-Syndrome sowie ME/CFS behandeln dürfen. Denn es kam bereits vor, dass Ärzte anders Erkrankte wegschicken mussten. Des Weiteren sollten Sie vorab in den Selbsthilfegruppen nachfragen, nach welchem Konzept die einzelnen Post Covid-Ambulanzen arbeiten. Nach wie vor wird der psychosomatische Ansatz in Deutschland von manchen führenden Ärzten und Krankenhäusern vertreten, obwohl inzwischen bewiesen sein dürfte, dass Post Covid eine körperliche Erkrankung ist. Für die Erkrankten ist dieser Ansatz wenig hilfreich und stigmatisierend.
Bei einem Post-Vacc-Syndrom gelten wiederum die neurologische Post-COVID-19-Sprechstunde der Charité Berlin oder das darauf spezialisierte Zentrum an der Uniklinik Marburg als wichtigste Anlaufstellen.
Für ME/CFSler sieht es nach wie vor nicht so gut aus. Die Charité Berlin bzw. das Charité Fatigue Zentrum als Hauptzentrum nimmt nur ME/CFS-Patienten aus dem Umkreis Berlin oder Brandenburg auf. Für Kinder und Jugendliche ist das MRI Chronische Fatigue Centrum für junge Menschen (MCFC) in München die einzige Anlaufstelle in Deutschland.
Ähnlich sieht es bei MCAS aus: Einige Adressen werden unter dem link https://www.mastzellenhilfe.de/adressen-aerzte-mcas genannt. Ich weiß jedoch von Aufnahmestopps bei einigen der genannten Ambulanzen und Ärzte sowie von sehr langen Wartezeiten. Daher rate ich anderen Betroffenen immer wieder dazu, die Diagnostik mit den verfügbaren Ärzten vor Ort durchzuführen.
Privatärzte
Aufgrund der mangelnden Versorgung in der Kassenmedizin bleibt vielen Betroffenen nur der Weg zu Privatärzten, die sich u.a. auf ME/CFS oder MCAS spezialisiert haben. Meist sind dies Behandler mit einem ganzheitlichen, funktionellen oder integrativen Ansatz, welche die Diagnostik durchführen und mit den Betroffenen gemeinsam die vielen Fragen und Themen schrittweise abarbeiten. Hier ist es ratsam, auf die Mundpropaganda zu setzen und sich über die Selbsthilfegruppen nach geeigneten Ärzten zu erkundigen. Darüber hinaus stellt das Portal me-cfs.net eine Datenbank für registrierte Mitglieder zur Verfügung, in der auch einige Privatärzte zu finden sind.29
Ich selbst habe sehr viel Geld ausgegeben, um überhaupt meine Diagnosen nach der langen Zeit zu erhalten. In Norddeutschland existieren nach wie vor kaum Anlaufstellen für ME/CFS und MCAS. Daher blieb mir nur der Weg über Privatärzte, deren Namen ich über die einschlägigen Selbsthilfeforen erhielt. Selbst die Diagnostik der Small Fiber Neuropathie über die Hautklinik Münster habe ich selbst bezahlt, da sich hier in Hamburg kein Facharzt fand, der bereit war, diese mit mir durchzuführen bzw. zu veranlassen.
Verbände, Vereine und Hilfsorganisationen
Die Hilfsorganisationen für ME/CFS und MCAS leisten in Deutschland wertvolle Arbeit. Sie sind nicht nur politisch aktiv und kämpfen für Forschung und eine bessere Versorgung der Erkrankten, sondern stellen Behandlern, Angehörigen und Erkrankten auch eine Vielfalt an wichtigen Informationen zur Verfügung.
Allen voran ist die deutsche Gesellschaft für ME/CFS (mecfs.de) zu nennen. Während diese Informationen zu Diagnostik, Pacing, Behandlungsmethoden und Co. online zur Verfügung stellt, hat der Bundesverband für ME/CFS mit dem Namen fatigatio (fatigatio.de) eine umfangreiche Schriftenreihe zu ME/CFS veröffentlicht.30 Die einzelnen Hefte werden gegen einen geringen Kostenbeitrag an Interessierte versendet und eignen sich hervorragend für die Kommunikation mit Behandlern.
Rein politisch aktiv sind die Organisationen #Millions Missing und "NichtGenesen". Diese organisieren Schuh-Aktionen und Liegend-Demos in unterschiedlichen Städten, Vorträge sowie Betten- und Rollstuhl-Aktionen, um auf die Erkrankten und deren Schicksale aufmerksam zu machen.
Der Verein ME-Hilfe hat einen anderen Ansatz und möchte als kompetenter Ansprechpartner in allen Notlagen die Situation von Betroffenen nachhaltig verbessern.31
Und dann gibt es noch den relativ neuen Verein ME/CFS research, der Gelder für wissenschaftliche Studien sammelt sowie Register über Studien und Publikationen zur Verfügung stellt (https://mecfs-research.org/mrr/).
In Hinblick auf MCAS ist der Verein MCAS-hope.de sowie die Initiative von Dr. Nina Kreddig mit dem Namen mastzellenhilfe.de zu nennen.
(Online-)Selbsthilfegruppen
Wenn fachkundige professionelle BehandlerInnen rar sind, wird Erfahrungsaustauschunter Betroffenen umso wichtiger. Andere Erkrankte kennen aufgrund ihrer Erfahrungen die wichtigsten Anlaufstellen, Behandler, Rechtsanwälte und Co. und geben diese Tipps gern weiter. Des Weiteren gibt es inzwischen zu fast jeder spezifischen Fragestellung eine Online-Selbsthilfegruppe in den sozialen Medien, unabhängig ob es sich um einzelne Erkrankungen (Leaky Gut, SIBO/ Dünndarmfehlbesiedlung, MCAS, ME/CFS etc.), allgemeine Fragestellungen (Gene, Mitochondrien) oder um bestimmte Therapien (z.B. Coimbra-Protokoll, LDN, LDA) handelt. Und gerade bei Detailfragen in Hinblick auf Verträglichkeit vieler Substanzen ist z.B. eine MCAS- oder Salicylatintoleranz-Gruppe sehr hilfreich.
Darüber hinaus gibt es auch Plauder-Gruppen für Betroffene, die sich unabhängig von fachspezifischen Fragen austauschen wollen. In der Online-Community ME space z.B. werden regelmäßig Online-Entspannungsrunden und Schweigestunden angeboten. Mehr Informationen finden Sie in den entsprechenden Einträgen im Community Kalender: https://link.mecfs.space/kalender. Anmeldungen sind über den folgenden link möglich: https://link.mecfs.space/relaxme-anmeldung
VORTEILE VON ONLINE-GRUPPEN
Informationen sind sehr schnell und 24/7 verfügbar.
Das Schwarmwissen vieler Betroffenen hat einen unschätzbaren Wert.
Sie können Kontakte zu anderen Betroffenen pflegen.
Der Service ist kostenlos.
Aber wie immer gibt es Licht und Schatten. Nach über vier Jahren kenne ich auch die Nachteile solcher Gruppen.
NACHTEILE VON ONLINE-GRUPPEN
Viele Betroffene berichten in den Foren über ihre Erfahrungen. Die wenigsten haben dabei jedoch einen übergeordneten Weitblick und genügend Wissen, um sich in die unterschiedlichen Nutzer einfühlen und die individuelle Situation eines Einzelnen richtig bewerten zu können. Das führt manchmal zu Fehleinschätzungen und wenig brauchbaren, wenn nicht sogar gefährlichen Ratschlägen.
Darüber hinaus ist die Eigendynamik mancher Gruppen anfangs schwer einzuschätzen. „Reife, erwachsene“ Gruppen, die differenzierte Meinungen zulassen und anerkennen, dass jede Therapie auch Nachteile haben und damit auch für einzelne Betroffene unverträglich sein kann, sind zu bevorzugen. „Unreife“ Gruppen wiederum, die eine Schwarz/ Weiß-Sicht vertreten und z.B. heikle Fragen oder gar Kritik an manchen Therapien gar nicht zulassen sowie schwere Nebenwirkungen verleugnen (O-Ton „Das kann nicht sein“), sind m.E. mit Vorsicht zu genießen. Oft fehlt es dann v.a. den Administratoren an Wissen und an der Bereitschaft, Dinge in Frage zu stellen bzw. auch die Nachteile einer Therapie anzuerkennen. In solchen Fällen kommt es dann gern vor, dass Nutzer mit anderen Erfahrungen an die Seite gedrängt werden.
Zudem kann die Stimmung in einer Gruppe (pessimistisch, aufgeheizt, aggressiv etc.) stark schwanken. Hier gilt es gut auf sich zu achten, um nicht in einen Sog zu geraten und sich von den Stimmungen anstecken zu lassen. Und nicht zuletzt ist die Abhängigkeit von solchen Gruppen ein ernstzunehmendes Thema. Wenn Sie sich selbst ertappen sollten, allzu oft am Tag in diesen Gruppen nachzuschauen, was geschrieben wurde und sich in Themen verirren, die für Sie aktuell absolut nicht relevant sind, dann sollten Sie sich Pausen gönnen. Die Gefahr ist groß, sich zu lange mit einzelnen Krankheiten und Symptomen zu beschäftigen, anstatt sich im realen Leben auf die positiven Dinge und Aktivitäten zu konzentrieren. Die Beschäftigung mit der Erkrankung ist wichtig und richtig. Aber es ist nicht gut für das seelische Wohlbefinden, diesen Themen zu viel Beachtung zu schenken. Die Gruppen sind dazu da, um in einzelnen Fragestellungen Rat zu suchen und zu einem gewissen Grad auch andere Betroffene zu unterstützen. Sie sollten jedoch in der Regel kein soziales Netz ersetzen und als Freizeitbeschäftigung dienen. Der nachteilige Effekt liegt auf der Hand.
Aus diesem Grund ergibt es Sinn, gewisse Regeln bei der Nutzung der Online-Gruppen einzuhalten.
REGELN ZUR SELBSTHILFE IM INTERNET32
Sichern Sie Ihren eigenen PC sowie Ihr Smartphone mit einem aktuellen Virenschutzprogramm.
Nutzen Sie in der Regel nur geschützte W-LAN-Netzwerke. Sichern Sie Ihr eigenes Netzwerk.
Sicherheitshalber sollten Sie von keinem öffentlichen PC sowie in keinem öffentlichen Netzwerk schreiben. Auch sollten Sie nur Ihr eigenes Smartphone nutzen, um in Selbsthilfeforen zu schreiben.
Verwenden Sie sichere Passwörter für all Ihre Geräte und Netzwerke. Ändern Sie diese alle paar Monate.
Achten Sie bei der Nutzung Ihres Smartphones darauf, dass Ihre Mobilnummer nirgendwo auftaucht.
Wenn möglich, nutzen Sie geschlossene, geschützte und moderierte Foren. Bitte bleiben Sie aber auch hier achtsam. Niemand kann garantieren, dass trotz aller Vorsicht nicht doch sogenannte „Trolls“ (Störer) oder kriminelle Täter Zugang finden.
Wenn Sie sich für ein Selbsthilfeforum interessieren, lesen Sie für eine Weile erst einmal passiv mit und klären Sie für sich folgende Fragen:
Fragen Sie sich, wie Sie das Diskussionsforum weiter nutzen möchten und wie Sie mit persönlichen Nachrichten umgehen wollen. Wollen Sie kontaktiert werden?
Wenn Sie sich entschieden haben, in einem Forum zu schreiben, dann beginnen Sie bitte vorsichtig. Überlegen Sie sich vorher, wie Sie sich auch bei heiklen oder heftigen Diskussionen schützen und die Kontrolle behalten können.
Stellen Sie sich am besten ein imaginäres oder selbstgebasteltes Stopp-Schild auf, um beizeiten eine Pause einzulegen oder den PC auszuschalten. Lassen Sie sich nicht emotional zu Antworten hinreißen, die Sie nachher eventuell bereuen könnten. Die Kommunikation über soziale Netzwerke hat ihre Schwachstellen. Dazu gehören v.a. Missverständnisse und verbale Gewalt in den sozialen Medien. Um dies zu vermeiden, müssen wir alle achtsamer miteinander umgehen. Dies gilt vor allem auch für Twitter und Co. Denn in der Regel werden die Antworten nicht nochmals überprüft, sondern stehen sofort im Netz und werden somit für alle sichtbar.
Denken Sie daran, dass das Urheberrecht auch im Internet gilt. Unerlaubte Veröffentlichungen von Liedern, Vorträgen oder Bildern verletzen das Copyright!
Oft verpflichten sich Moderatoren eines Forums dazu, bei akuter Bedrohung eines Nutzers die zuständigen Stellen wie z.B. die Polizei oder Psychiatrie zu informieren. Dies tritt vor allem bei Suiziddrohungen, aber auch bei Berichten von aktuellen Straftaten ein. Die Moderatoren nehmen ihre Verantwortung hier sehr ernst. Tun Sie dies bitte auch.
Medizinische Unterstützung vor Ort
Vor Ort braucht es Haus- und Fachärzte, die zwar durch das Kassensystem nicht über viel Zeit verfügen, aber zumindest offen sind für die Belange der Betroffenen, notwendige Medikamente verschreiben und die Erkrankten bei sozialrechtlichen Fragen wie Arbeitsunfähigkeit, Rentenbegehren sowie Beantragung der Pflegestufe etc. unterstützen. Zum Glück gibt es auch nach wie vor noch Hausärzte, die Hausbesuche machen. Das ist für viele Betroffene bereits sehr viel wert. Aber die Suche nach diesen Ärzten ist manchmal sehr schwierig und kräftezehrend.
Auch die Unterstützung von Physiotherapeuten, Cranio-Sacral-Therapeuten, Osteopathen, Ergotherapeuten oder auch Psychotherapeuten sind immer eine Option, wenn es um Krankheitsbewältigung, Linderung von Schmerzen und Co. geht. Teilweise arbeiten diese mit Videokonferenzsystemen wie z.B. Zoom oder machen Hausbesuche.
Pflegekräfte, Nachbarschaftshilfen etc. spielen eine große Rolle, wenn es um tatkräftige Unterstützung im Alltag geht.
Insgesamt reicht diese Hilfestellung vor Ort jedoch meist nicht aus, da zu wenig über die einzelnen Erkrankungen bekannt ist – und der Großteil der Behandler noch keine Fortbildungen zu ME/CFS und MCAS besucht hat. In vielen Fragen bleiben die Betroffenen damit auf sich allein gestellt.
Seitdem ich die Diagnosen habe, sind einige Kassenmediziner sehr viel offener und fragen vermehrt nach. Auch wenn sich die wenigsten mit den Erkrankungen auskennen, so hat keiner bisher die Diagnosen in Frage gestellt. Mein Hausarzt unterstützt mich in allen Bereichen und stellt mir auch die Medikamente aus, die ich benötige. Wirklich weitergebracht haben mich zudem meine ganzheitlichen Behandler, die die ursächlichen Probleme erkannt haben und diese mit mir gemeinsam behandeln.
Eine umfassende Begleitung durch ganzheitliche BehandlerInnen hat einen großen Haken: Sie ist teuer. Dabei sind es nicht unbedingt die Behandlungskosten, die so viel Geld verschlingen, sondern eher die sehr kostenintensiven Laborkosten. Manche Betroffene umgehen daher den Schritt der Diagnostik und beginnen z.B. sofort mit der Therapie, ohne zu wissen, wo sie überhaupt stehen. Dies spart zwar anfangs Geld und Zeit, aber mittel- bis langfristig kann es schwierig und problematisch werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass es grundsätzlich – v.a., wenn es z.B. um die Darmgesundheit, NICOS, chronische Erreger oder die Nährstoffversorgung geht – zuallererst einer Analyse des Ist-Zustandes bedarf, um die richtigen Therapien wählen zu können. Ohne Analyse ist eine zielgerichtete Therapie fast unmöglich.
Psychotherapie und Ergotherapie
ME/CFS und MCAS sind schwere multisystemische und körperliche Erkrankungen. Daher stehen die biologisch-medizinische Versorgung sowie Verhaltensänderungen wie Pacing, Ernährungsumstellung und Co. immer im Vordergrund. Eine Psychotherapie oder Ergotherapie kann jedoch als Begleitmaßnahme und zur Krankheitsbewältigung sinnvoll sein – sofern sie freiwillig und nicht erzwungen ist.
Ziel der Behandlung sollte sein, dass die Patienten
mit der extremen psychischen Belastung durch die krankheitsbedingten Einschränkungen besser umgehen können (wie z. B. auch bei Multipler Sklerose oder Krebs) sowie
die Erkrankung besser handhaben können (z.B. mit Hilfe von Pacing, Nervus Vagus-Übungen, Schlafkonzepten etc.).
Für die Auswahl der einzelnen psychotherapeutischen Methoden ist wiederum die individuelle Ausgangslage der einzelnen Patienten entscheidend. Da auch starke Emotionen für Crashs sorgen können, liegt der Grundsatz des psychotherapeutischen Handelns auf der Hand: "Weniger ist mehr!“.
Völlig ungeeignet und unangebracht bei ME/CFS und MCAS sind Therapieformen wie GET (ansteigende Aktivierungstherapie bzw. engl. Graded Excercise Therapy) oder CBT (Cognitive Behavioral Therapy). Diese Behandlungsansätze beruhen auf einem – für ME/CFS und MCAS unzutreffenden – früheren psychosomatischen Krankheitsmodell, das angebliche aktivitätsvermeidende Verhaltensweisen und falsche Krankheitsüberzeugungen als Ursache der Erkrankungen definierte. Dieses Modell sollte nach all den Beweisen in den letzten Jahren inzwischen der Vergangenheit angehören. Aber leider gibt es nach wie vor noch genügend Behandler in Deutschland, die diese Einschätzung teilen und hartnäckig verteidigen.
Daher sollten Sie bei der Psychotherapie- und Ergotherapie-Suche genau hinschauen und den Wissensstand der einzelnen Therapeuten überprüfen. In einer für Sie geeigneten Psychotherapie sollte es v.a. darum gehen, Zustandsverschlechterungen zu vermeiden und die Krankheitsbewältigungsmethoden zu optimieren. Bei der Kommunikation mit den einzelnen Therapeuten könnte der Artikel „The Role of Psychotherapy in the Care of Patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome“VIII von Bettina Grande und Co. hilfreich sein.
Physiotherapie
Physiotherapie spielt für viele ME/CFS-Betroffene meist eine eher untergeordnete Rolle und kann aufgrund der Belastungsintoleranz allenfalls unterstützend wirken. Die herkömmlich empfohlenen körperlichen Rekonditionierungs-Maßnahmen wie z.B. die graduelle Leistungssteigerung GET sind kontraindiziert. Pacing steht an erster Stelle. Daher müssen auch viele Physiotherapeuten erst umdenken. Aufklärung durch Schulungen und Informationen tut Not.IX Aber noch kennen sich nicht alle Therapeuten mit dem Thema aus. Die Suche nach einer geeigneten Physiotherapie-Praxis kann daher länger dauern.
Wenn Sie sich selbst für eine Physiotherapie interessieren, sollten Sie sich vorab überlegen, welche Ziele Sie damit verfolgen.
Geht es um die Verbesserung der Atmung?
Wollen Sie Nervus Vagus-Übungen erlernen?
Leiden Sie unter hartnäckigen Verspannungen?
Wollen Sie lernen, wie Sie Muskel- und Gelenkschmerzen lindern und vorbeugen können?
Wollen Sie die aktuelle Muskelstärke aufrechterhalten und mobil bleiben?
Wollen Sie auch im körperlichen Bereich Pacing erlernen und mit Hilfe herausfinden, was Sie noch machen können?
Wenn für Sie die Zielsetzung und damit der Behandlungsauftrag klar ist, können Sie sich auf die Suche machen. Konzentrieren Sie sich dabei bitte auf Physiotherapie-Praxen, für die Pacing kein Fremdwort ist und die bereits Erfahrungen mit ME/CFS, Long Covid und Co. haben.
Sorgen Sie vor dem ersten Termin gut für sich:
Stellen Sie den Physiotherapeuten Informationen zu Pacing und Co. vor.
Achten Sie darauf, dass diese vorsichtig und achtsam vorgehen.
Sagen Sie im Zweifelsfall lieber einmal zu viel „Nein“.